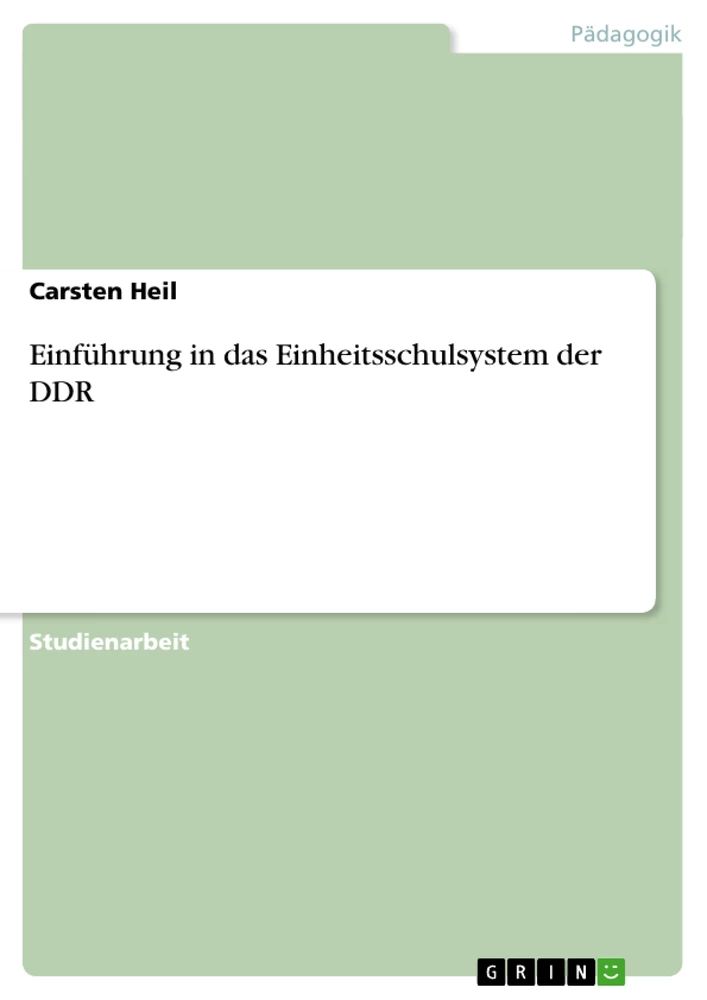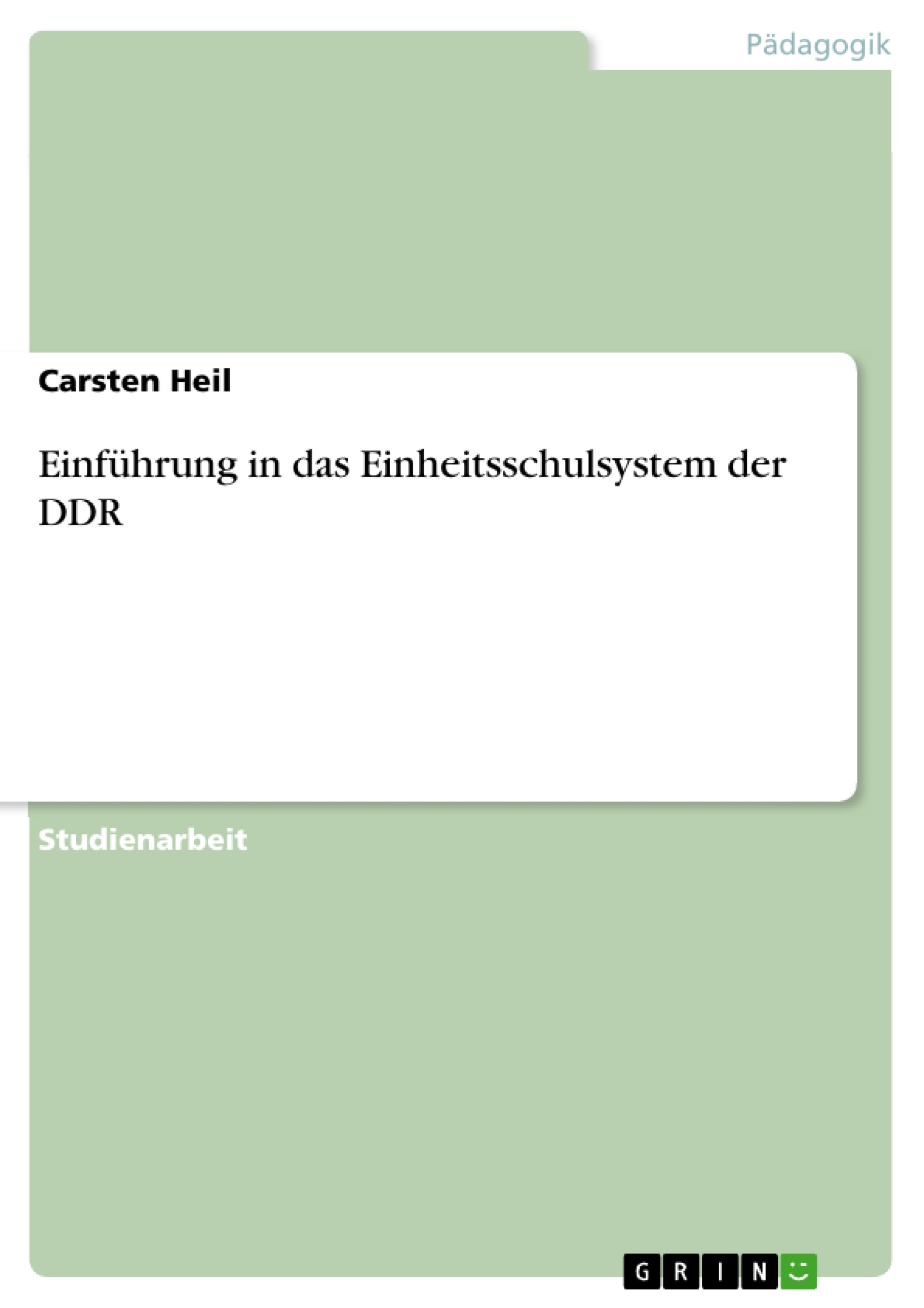Wie formte ein Staat seine Bürger durch Bildung? Tauchen Sie ein in die intrigenreiche Welt des DDR-Bildungssystems, ein Spiegelbild ideologischer Ambitionen und gesellschaftlicher Umwälzungen. Diese umfassende Analyse beleuchtet die theoretischen Fundamente des marxistischen Denkansatzes, der die Grundlage für die Gestaltung eines vermeintlich egalitären Bildungswesens bildete. Entdecken Sie, wie die Einführung der Polytechnischen Oberschule (POS) und die Rolle der "Neulehrer" die Bildungslandschaft prägten und welcheCurricula, durchdrungen von sozialistischer Ideologie, den Alltag von Schülern und Lehrern bestimmten. Untersuchen Sie die Ambivalenz der Wehrerziehung, die tief in den Lehrplänen verwurzelt war, und die Rolle der Jugendorganisationen wie der FDJ, die das Schulleben durchdrangen. Das Buch wirft ein Licht auf die Frage, inwieweit das Bildungssystem tatsächlich gleiche Chancen für alle sozialen Schichten bot und wie politische Loyalität und die Herkunft der Eltern die Bildungslaufbahn beeinflussten. Verfolgen Sie die Entwicklung von den Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems und der Etablierung der Einheitsschule. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen bei der Umsetzung der Einheit von Bildung und Arbeit und die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Analysieren Sie die Rolle der Staatssicherheit (Stasi) bei der Überwachung von Schülern und Lehrern und die Rekrutierung inoffizieller Mitarbeiter (IM) unter Jugendlichen. Abschließend wird ein kritischer Blick auf die Erfolge und Misserfolge des DDR-Bildungssystems geworfen und die Frage aufgeworfen, ob es tatsächlich ein Modell für mehr Chancengleichheit darstellte. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Bildungsgeschichte, DDR-Geschichte und die Mechanismen ideologischer Beeinflussung interessieren. Es bietet neue Einblicke in ein System, das darauf abzielte, den "neuen Menschen" zu formen und dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Schlüsselwörter: DDR, Bildungssystem, Polytechnische Oberschule, Neulehrer, Curricula, Wehrerziehung, FDJ, Staatssicherheit, Chancengleichheit, Marxismus, Einheitsschule, Bildungsgeschichte, Schulpolitik, Sozialismus, Jugendorganisationen, Ideologie, Erziehungswissenschaft, Schulordnung, Lehrerrolle, Schülerrolle, Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten, Lehrpläne, Militär, Bildungschancen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1.0 Theorien und Gesetzesgrundlagen zum Wiederaufbau des Schulsystems in der DDR
1.1 Der Marxistische Denkansatz
1.2 Schwerpunkte des ostdeutschen Bildungssystems
1.3 Gesellschaftliche Begründung des neuen Schulsystems
1.3.1 Reformen zur Überwindung des dreigliedrigen bürgerlichen Schulsystems
2.0 Die Entwicklung zur Polytechnischen Oberschule
2.1 Neulehrer
2.2 Die Entwicklung zur Sozialistische Einheitsschule
2.2.1 Einführung der Polytechnischen Oberschule
2.2.2 Arbeiter und Bauern Fakultäten
3.0 Die Demokratische Bildungsidee: Curricula in der DDR
3.1 Die Wissenschaftlichkeit der Bildung
3.2 Das Curriculum der DDR im Internationalen Vergleich
3.3 Direkter Internationaler Vergleich
4.0 Die Rolle der Lehrer und Schüler in der DDR
4.1 Aufgaben von Lehrern
4.1.1 Wehrerziehung im Schulischen Curriculum
4.2 Rolle der Schüler
4.2.1 Jugend und Staatssicherheit
5.0 Bildungschancen der sozialen Schichten Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1, Der Weg zur Einheitsschule
Abbildung 2, Aufbau des Bildungssystems in der DDR der 80er Jahre
Abbildung 3, Unterrichtsstunden der Klassen 1 - 4 im Vergleich zur BRD
Abbildung 4, Unterrichtsstunden der Klassen 5 - 10 im Vergleich zur BRD
Einleitung
Die DDR Gesellschaft entstand nach dem Ende des Nationalsozialismus und trug die durch diesen entstandenen Lasten. Radikale Schritte im Bereich der Politik und an den Schulen sollten zur ,,Bildung für alle" führen. Schulreformen erfolgten aber nur allmählich. Die Schulen standen unter dem Einfluss und dem Anspruch des Staates, einer Vereinheitlichung und Parteilichen Ausrichtung ihrer pädagogischen Bemühungen. In den Schulen der DDR wurde aber die Gleichheitsnorm schon sehr früh durchgesetzt, in einer Reihe von Reformen entstand die Einheitsschule mit zehn Jahrgängen, in der nahezu alle Kinder eine mehr oder weniger gleiche Bildung erfuhren.
Doch entstanden durch die parteiliche Ausrichtung deutliche Probleme, es war für die Schüler faktisch nicht möglich ihre Bildung frei zu gestalten, bestimmte soziale Klassen wurden bei der freien Bildungswahl privilegiert , so dass Kinder anderer sozialer Schichten zwangsläufig diskriminiert wurden.
Lehrer wurden durch die engen Vorgaben von Curricula und Schulordnungen einem starken bürokratischen Reglement unterworfen.
Der politische Einfluss des Staates war auch durch Gesetze deutlich geregelt, FDJ und Militär waren feste Bestandteile der Curricula in der DDR.
Lehrer und Schüler waren zur Mitarbeit in diesen Organisationen gezwungen, dies wurde in Schulordnungen nochmals detailliert geregelt.
In der Bildungspolitik der DDR kam dem Motiv der Einheit von Bildung und Arbeit eine große Bedeutung zu , seine Verwirklichung scheiterte jedoch an den Arbeitsverhältnissen. Die Theorien von K. Marx zu diesem Thema, blieben letztendlich nur ein formelles Programm zur ,, Bildung durch Arbeit" und konnten faktisch nicht in die Praxis umgesetzt werden. In dieser Arbeit werde ich nicht im Detail auf die oben genannten Probleme eingehen, da dies den Rahmen sprengen würde. Probleme entstanden jedoch zumeist aus entsprechenden Gesetzen und Verordnungen, denen die sozialistische Gleichheitsidee zugrunde lag. Diese Verordnungen und Gesetze sind erwähnt und können so zumindest den Weg zur Problementstehung aufzeigen.
Im Rahmen meiner Arbeit, möchte ich, auf die Grundlagen des DDR Bildungswesens eingehen. Hierzu habe ich meine Arbeit in vier Kapitel eingeteilt und einen Handlungsstrang, der von den Theoretischen Grundlagen hin zur Praxis führt, zugrunde gelegt. Beginnend mit dem darstellen der theoretischen und gesetzlichen Grundlagen. Sie sollen deutlich machen wie lange der Weg zu Einheitsschule war und welchen Einfluss der Staat auf die Schule nahm.
Die Folgenden Kapitel werden sich schließlich mit der Entwicklung hin zur Einheitsschule, den Curricula und den Rollen von Lehrern und Schülern beschäftigen.
1.0 Theorien und Gesetzesgrundlagen zum Wiederaufbau des Schulsystems in der DDR
Nach dem Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland waren die materiellen und geistigen Folgen der NS Diktatur zu überwinden und über den Weg des Neuaufbaus zu entscheiden. Die politischen Kräfte in der Sowjetischen Besatzungszone ( SBZ ) entschieden sich für einen Gesellschaftlichen Neuanfang, der eine Wiederholung der Fehler von 1918 und 1933 ein für allemal ausschließen und eine sozialistische Perspektive eröffnen sollte.
Auf Bildungspolitischer Ebene galt es durch demokratische Umerziehung die NS Ideologie zu überwinden und dem sozialistischen Gedankengut den Weg zur Bevölkerung zu bahnen. Den bisher benachteiligten Klassen und Schichten sollte der Weg zur höheren Bildung aufgetan werden und eine neue Intelligenz aus eben diesen Bevölkerungskreisen geschaffen werden.
1.1 Der Marxistische Denkansatz
Nach dem 2. Weltkrieg gab es in der DDR die Bestrebung ein Schulsystem aufzubauen, das auf Gleichheit beruhte. Bildung sollte die Welt der Arbeit nicht länger ignorieren, zu diesem Thema gab es in der DDR im wesentlichen die Bildungstheorie von K. Marx. Für die DDR stand die Marxsche Idee ,, Arbeit als Bildungsprozess" im Vordergrund. Marx ging davon aus, dass die Individuen in der Auseinandersetzung mit der Natur zusammen mit ihren äußeren
Lebensbedingungen zugleich sich selbst produzieren. Arbeit galt ihm deswegen auch als individueller Bildungsprozess.
,,Die wirkliche Ö konomie, Ersparung, besteht in der Ersparung von Arbeitszeit; ( ) diese Ersparung ist aber identisch mit Entwicklung der Produktivkraft. Also keineswegs Entsagen von Genuss, sondern Entwickeln von Power, von Fähigkeiten, von Produktion und daher sowohl der Fähigkeit wie der Mittel des Genusses. Die Fähigkeit des Genusses ist Bedingung für denselben, also erstes Mittel desselben und diese Fähigkeit ist Entwicklung einer individuellen Anlage, Produktivkraft" ( Marx, K., das Kapital )
Hieraus ergab sich die Forderung der Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit im Rahmen der Erziehung und Bildung. Dies wurde in der DDR mit dem Konzept der Polytechnischen Bildung umgesetzt. Sie sollte wissenschaftliche Grundsätze der Produktionsprozesse in Verbindung mit der Einübung der für diesen Prozess notwendigen Instrumente vermitteln.
Polytechnische Bildung
Schon bei Rousseau wird Arbeit als Medium von Bildungsprozessen reflektier ( Emiles Handwerkslehre ). Ebenso weist Pestalozzi auf die Bedeutung von Kopf, Herz und Hand hin, er hebt die Wichtigkeit der Methode im Bildungsvorgang hervor. In den Industrieschulen des späten 18. Jahrhunderts wurde erstmals Unterricht in systematischer Weise mit produktiver, ökonomischer Arbeitstätigkeit von heranwachsenden verbunden.
Dagegen formulierte die neuhumanistische Bildungstheorie die Differenz zwischen Bildung als Medium individueller Selbstentfaltung und Ausbildung als Instrument einseitiger gesellschaftlicher Notwendigkeiten.
Karl Marx versuchte diese beiden Anliegen systematisch zu verknüpfen. Neben geistiger Bildung und körperlicher Ausbildung hielt er zur Heranbildung allseitig entwickelter Individuen eine polytechnische Erziehung für notwendig.
Diese sollten die allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätze aller Produktionsprozesse mitteilen und gleichzeitig in den praktischen Gebrauch und die Handhabung der wichtigsten Instrumente einführen. Erstmals umgesetzt wurde der Gedanke der Polytechnischen Bildung ( Arbeitsschule ) nach der Jahrhundertwende durch Publikationen des Münchner Stadtschulrates Georg Kerchensteiner. Sein Pädagogisches Anliegen bestand darin, die Methoden, der im 19. Jahrhundert praktizierten ,,Drillschule" durch die Organisation einer von den Lernenden stärker selbst kontrollierten Lerntätigkeit zu ersetzen. Dabei sollten handwerklich strukturierte Arbeitsvorgänge durch unmittelbare Anschauung zum Ausgangspunkt der angestrebten ,,Selbstdisziplinierung" werde:
,,In der inneren Nötigung zur Selbstprüfung und der Möglichkeit dieser Selbstprüfung im erzeugten Gute haben wir das Grundmerkmal der rechten Arbeitsschule" ( Kerchensteiner, G., Begriff der Arbeitsschule S.81 )
Dieses Prinzip ist, in unterschiedlicher Form, für alle weiteren Arbeitsschulkonzepte maßgeblich.
Erziehungswissenschaften in der DDR
Die pädagogische Wissenschaft in der DDR unterschied sich insofern grundsätzlich von ihrem westdeutschen Pedanten, als direkte Einflussnahme von Seiten des Staates bereits im Rollensystem institutionalisiert waren. Bis 1948 gab es zunächst noch Versuche pädagogisch- philosophischen Traditionsbestand an die Erziehungswissenschaften anzubinden, ab 1948 gab es jedoch eine Orientierung hin zu der Pädagogik der Sowjetunion. Bis hin in die achtziger Jahre dominierte in der pädagogischen Wissenschaft der DDR ein ,,lineares Einwirkungsmodell" das von einer weitgehenden Kongruenz von staatlich legitimierten Intentionen und erzieherischen Wirkungen ausging. Zu Beginn der achtziger Jahre entstanden aber auch Freiräume für verschiedene Neuorientierungen die die Komplexität des pädagogischen Prozesses, die Bedeutung der Aneignung auf der Seite des Einzelnen und die Eigenständigkeit der pädagogischen Fragestellung betonten. Diese Neuorientierung erzeugte allerdings auf politischer Ebene nur geringe Resonanz.
1.2 Schwerpunkte des ostdeutschen Bildungssystems
Um die Theorien von Marx und den Gleichheitsgedanken umsetzen zu können, mussten bei dem Aufbau des ostdeutschen Bildungssystems gewisse Grundsätze festgelegt werden:
1) Das sozialistische Gleichheitsprinzip wurde ab 1946 im Bildungssystem durch die Schaffung von Einheitsschulen durchgesetzt. Hier kam es ab 1946 zu zahlreichen Bildungsreformen, die das ,,Endziel" Einheitsschule vor Augen hatten.( vgl. dazu den diesbezüglichen Abschnitt )
2) Staatsbürgerrolle und Berufsstatus wurden kurzgeschlossen, Arbeiter und Bauernkinder sollten privilegiert werden. Diese galten als vertrauenswürdige sozialistische Staatsbürger, weshalb sie mit Hilfe der Schule auf besondere Führungsrollen vorbereitet werden sollten. Es gelang der DDR schneller als der BRD, Arbeiterkindern den Weg in weiterführende Schulen zu eröffnen.
3) Der Begriff Gesellschaft, an dem sich die Bildungspolitik orientierte, ergab sich aus der Theorie von K. Marx ( siehe 1.1, der Marxistische Denkansatz ), bei dem man sich jedoch weniger an Marx hielt, als an die späteren Interpretationen von F. Engels.
4) Das marxistische Denken sollte auch in den Curricula manifestiert werden. Sie
sollten wissenschaftlichen Charakter haben, jedoch nicht zum nur methodisch kontrollierten unabhängigen Denken führen.
1.3 Gesellschaftliche Begründung des neuen Schulsystems
Sicherlich ist hier die Frage angebracht, weshalb ein neues Schulsystem in der DDR zum Tragen gekommen ist. Die Antwort ist zunächst in der sozialistischen Idee zu suchen, also dem Gleichheitsprinzip. Man unterschied Bildungsmonopole mit ständischem und kapitalistischen Charakter. Innerhalb einer ständischen Ordnung sollte die Ungleichheit der Bildungsmöglichkeiten unmittelbar dem sozialen Status der einzelnen Stände zuzuordnen und in den gesetzlichen Regelungen ( auch Curricula ) festgeschrieben sein. Diese sollten den Zugang zu Bildungsanstalten bestimmen.
In der bürgerlichen Klassengesellschaft ( Kapitalismus ), war die formale Gleichheit der Bildungschancen ( einheitliche Volksbildung ) festgeschrieben. Der Verwirklichung standen die ungleichen Lebensverhältnisse der sozialen Schichten entgegen, was den Interessen der herrschenden Klasse entspracht. Bildungsanstalten, deren Abschlüsse zu Führungspositionen in der Gesellschaft befähigten, sollen Kindern der unteren sozialen Schichten zwar formal, jedoch nicht faktisch zugänglich sein.
Dieses Bildungsmonopol trage zur Legitimität der kapitalistischen Klassenordnung bei.
,, Neben Besitz und Macht ist eine höhere Bildungsstufe wesentliche Grundlage des Prestiges der Oberklasse" ( Robert Alt, zur gesellschaftl. Begründung der neuen Schule S.15 )
Die Bildungstheoretiker der DDR leiteten aus dieser kultursoziologischen Kritik des bürgerlichen Bildungsmonopols die Forderung nach materialer Chancengleichheit ab. Hier war die Schaffung einer Einheitsschule naheliegend, da sie allen Kindern den Weg zur Bildung öffnete.
Gesetzliche Grundlagen zur Schaffung eines neuen Bildungswesens
Ähnlich wie die westlichen Besatzungsmächte, drängte auch die sowjetische Militärregierung auf eine Umgestaltung des Bildungswesens.
Man hatte erkannt, dass das deutsche Bildungswesen mit der Monopolstellung der oberen Klasse direkt zur nationalsozialistischen Diktatur geführt hatte.
Dies war in beiden Teilen Deutschlands unbestritten. Die BRD ging hier einen anderen Weg, es wurde ein Bildungssystem geschaffen, das durch wohlfahrtsstaatliche Elemente gestützt wurde, um so eine Umverteilung der Bildung von oben nach unten zu ermöglichen. Jedoch war dies durch die Reinsatallation des vorbürgerlichen dreigliedrigen Schulsystems, bestehend aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium, nur schwer möglich. In der DDR war die Umsetzung der Gleichheitsnorm von großer Wichtigkeit (siehe Kapitel 1.3, Gesellschaftliche Begründung ). Die Schulformen sollten im Geist des Antifaschismus und der Demokratie verändert werden. Durch die Einführung der Gleichheitsnorm in der Schulentwicklung gelang der DDR die Umgestaltung vom dreigliedrigen Schulsystem zur Einheitsschule.
1.3.1 Reformen zur Überwindung des dreigliedrigen bürgerlichen Schulsystems
Da die Entwicklung zur Einheitsschule ein nicht in sich abgeschlossener Prozess war, sondern sich in verschiedenen zeitlichen Episoden abspielte ( siehe Abb. 1, Der Weg zur Einheitsschule ), sollten hier die gesetzlichen Reformvorhaben bis zur entgültigen Errichtung der Einheitsschule 1983 erwähnt werden. Hierbei ist zwischen zwei Begriffen zu unterscheiden:
1) Gesetze: Wurden von der jeweiligen Regierung erlassen, im wesentlichen ist das Gesetzgebungsverfahren dem der BRD gleichzusetzen.
2) Befehle: Wurden von der sowjetischen Militärregierung erlassen. Diese hatten den selben Charakter wie Gesetze, waren aber ohne ein demokratisches Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt. Befehle im Bildungsbereich endeten weitestgehend mit der Gründung der DDR.
- 1946: Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schulen mit der Einführung der achtjährigen Grundschule
- 1946: Befehl Nr. 40, Entnazifizierung des Lehrkörpers. Lehrer wurden aufgrund ihrer Mitgliedschaft bzw. Nähe zur NSDAP entlassen: Bis zum Jahr 1945 waren schätzungsweise bis zu 72% des Lehrkörpers Mitglied der NSDAP.
- 1946: Befehl Nr. 162, Ausbildung von ,,demokratischen Söhnen und Töchtern des werktätigen Volkes", um einen Ausgleich für die im Zuge der Entnazifizierung entlassenen Lehrer zu erhalten, wurde die Ausbildung des Neulehrers geschaffen: Es war eine verkürzte pädagogische Ausbildung, die mehrere Monate dauern sollte, aus Lehrermangel wurden jedoch meist 6 Wochen - Kurse durchgeführt.
Sie bestand im wesentlichen aus der Vermittlung pädagogischer
Grundlagen und der Ausbildung in sozialistischer Theorie.
- 1946: Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schulen, dieses Gesetz ermöglichte den Einsatz von SED Vertretern und ihrer Organisationen in Schulen. Aus diesem Gesetz erwuchsen Unterrichte mit militärischen und politischen Bezügen;
- 1959: Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens, dieses Gesetz hatte die Einführung der Polytechnischen Oberschule begründet;
- 1965: Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem;
- 1969: Gesetz zur Auflösung der gymnasialen Oberstufe;
- 1983: Erweiterung des für alle Kinder gemeinsamen Bildungsprogramms auf zehn Jahre und Abschaffung der Vorbereitungsklassen an der erweiterten Oberschule ( EOS ).
Mit dem Verkündigen des gleichen Rechts auf Bildung für alle Jugendlichen, egal ob Stadt oder Landkinder und ohne Rücksicht auf das Vermögen der Eltern wurde der konstruierte Vermittlungszusammenhang der politischen und ideologischen Herrschaft einer kleinen Oberschicht zerschlagen ( R. Alt, zur gesellschaftl. Begründung der neuen Schule S.7 )
Abbildung 1, Der Weg zur Einheitsschule
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: L. Lenhardt, Schulentwicklung und Sozialstruktur in der BRD und der DDR
2.0 Die Entwicklung zur Polytechnischen Oberschule
Die Geschichte der Einheitsschule lässt sich nur vor dem Hintergrund der Gesellschaftlichen und Politischen Entwicklung in der DDR rekonstruieren ohne das diese hier ausführlich dargestellt werden könnte. Die Entwicklung zur Einheitsschule kann aber grob in Perioden eingeteilt werden, sie werden im folgenden dargestellt.
2.1 Neulehrer
Mit dem Befehl Nr. 162 des Militärrates der Sowjetunion in der DDR wurde einerseits der Weg für die politisch ideologische Ausbildung des Lehrkörpers geebnet und andererseits der seit der Entnazifizierung herrschende Lehrermangel eingedämmt.
Angesichts diese Mangels wurden die Ausbildungen zum Neulehrer in relativ kurzer Zeit durchgeführt: Waren zunächst ca. 6 Monate für die Ausbildung vorgesehen, war es Ende 1947 meist die Regel Neulehrer in 6 Wochen - Kursen auszubilden. Dies bedeutete für die neue Lehrergeneration eine durchgehende Unterqualifizierung, zumal bei den durchgeführten Lehrgängen politische Schulung im Vordergrund stand. Aus diesem Zusammenhang heraus wird deutlich, dass die politische Führung ein Druckmittel gegen den Lehrkörper in der Hand hatte: Der Lehrkörper wurde durch mangelnde Qualifizierung erpressbar und somit lenkbar.
Bereits 1947, also nur ein Jahr nach dem Erlass des Befehls 162, gehörten bereits mehr als die Hälfte aller in der DDR ausgebildeten Neulehrer der SED an. Die Neulehrer wurden zum Sprachrohr für den jeweiligen politischen Willen der SED.
1949 waren in der DDR 80 Prozent aller Lehrer Neulehrer ( ca. 40.000 ). Für die DDR Öffentlichkeit war dies der Inbegriff der antifaschistischen demokratischen Umwälzung.
Ideologische ,,Unzuverlässigkeiten" der Neulehrer
Für die politische Führung der DDR, ergab sich ein neues, im Vorfeld nicht bedachtes Problem: Der Neulehrer war als ,,Hebel für den ideologischen Einfluss auf die Öffentlichkeit gedacht, dies ging aus dem, 1945 vom ZK der SED erlassenen 2 Jahresplan hervor:
Die Einheitlichkeit der politisch, wirtschaftlichen, sozialen und ideologischen Umgestaltung von Staat und Gesellschaft ist die vorrangige Aufgabe der Pädagogen. ( ZK der SED , zwei Jahresplan von 1945.
Er war nicht in der Lage die Gesellschaft so maßgeblich zu verändern, wie dies geplant war.
Der Neulehrer verfügte nur selten über Überzeugungskraft und die rhetorisch ideologische ,,Festigkeit", um gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und ein neues sozialistisches Gesellschaftsbild zu schaffen.
Dies wurde der politischen Führung mit dem Volksaufstand 1953 deutlich vor Augen geführt: Der Lehrkörper wurde als abwartend und neutral eingestuft.
Man hatte, bedingt durch die dem Pädagogen zugewiesene Rolle, ein ,,Eingreifen" auf rhetorischer Ebene erwartet. In der zentralen Konferenz zur Vorbereitung des neuen Schuljahres 53 / 54, wurde das Verhalten des Lehrkörpers als kollektives Versagen im Bereich der pädagogischen Intelligenz eingestuft. Deshalb entschloss man sich zu einer umfassenden Neuregelung im Bereich der pädagogischen Ausbildung, die Ausbildung für Neulehrer wich der akademischen Ausbildung zum Pädagogen an der neu zu Gründenten Akademie der Pädagogischen Wissenschaft. Diese wurde jedoch erst rund zwanzig Jahre später gegründet.
2.2 Die Entwicklung zur Sozialistische Einheitsschule
Sozialistische Grundideen bezeichneten die normativen Ideen, mit denen sich die DDR dem internationalen Model nationaler Bildungssysteme näherte, nämlich der Einheitsschule. Jedoch wurde die Einheitsschule nicht in einem Schritt proklamiert, sondern wurde in einem langwierigen Prozess zwischen Reformversuchen und Gesetzen erst 1983 entgültig dem Volk vorgestellt.
1946 wurde erstmals in Deutschland eine für alle Kinder gleichermaßen geltende 8 Jährige Grundschule eingeführt und damit die gemeinsame Schulzeit verdoppelt. Allerdings gab es in den Klassen 7 und 8 ein differenzierendes Kurssystem, dessen Absolventen je nach Bildungsgang in die drei Jahre dauernde obligatorische Berufsschule oder in die vier Jahre dauernde Oberschule überwechselten.
Die Oberstufe und damit verbunden das Abitur blieb, ebenso wie die Gliederung der Oberstufe, in einen altsprachlichen und neusprachlichen Zweig und einen mathematischen und naturwissenschaftlichen Zweig bestehen.
Jedoch hatte das in der BRD wieder aufkommende dreigliedrige Schulsystem in der DDR seine Bedeutung verloren
2.2.1 Einführung der Polytechnischen Oberschule
1959 wurde ein weiterer Schritt hin zur Einheitsschule vollzogen: Der Gesetzgeber führte die Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule als Pflichtschule ein. Die gemeinsame wissenschaftliche Bildung wurde um 2 Jahre verlängert, die Ausdifferenzierung der Bildungsgänge, die zur Oberstufe führten wurden hinausgeschoben. Waren die Ausdifferenzierungen in der 8 Jährigen Grundschule bereits im 8 Schuljahr vollzogen, setzten sie nun erst im 9 Schuljahr ein.
Die Oberstufe, die jetzt die Bezeichnung ,,Erweiterte Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule ( EOS )" hatte, wurde von vier auf zwei Klassenstufen verkürzt. 1969 / 70 erhielten die elften und zwölften Klassen der EOS einen einheitlichen Lehrplan. Dieser trat an die Stelle der traditionellen Zweige der Oberschule ( siehe dazu 2.2.1 ). Unterstützend wirkte hier das Gesetz über das Einheitliche Sozialistische Bildungssystem von 1965:
Der Ü bergang aus der achten Klasse in die Berufsbildung oder direkt in ein Arbeitsverhältnis wird nur noch in Ausnahmefällen genehmigt.
Diese Regelung ließ den Anteil von Jugendlichen, die von der achten Klasse in die neunte Klasse übergingen, rasant ansteigen. ( siehe Tabelle 1, Übergang in die EOS)
Tabelle1 Übergang in die EOS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12% aller Jugendlichen 72% aller Jugendlichen 91% aller Jugendlichen
( Lötsch / Meier, Das Verhältnis zw. körperlicher und geistiger Arbeit; 1988 )
Dies zeigt deutlich, dass sich in der DDR die sozialistische Gleichheitsnorm im Bildungswesen nachdrücklich durchgesetzt hat.
,,Zieht man eine Bilanz der Politik der Einheitlichkeit im Schulwesen der DDR, so muss zunächst die Tatsache respektiert werden, dass esüber so viele Jahre gelungen ist, leistungsm äß ig sehr heterogene Klassen fast ausschließlich im Klassenverband zu unterrichten, und zwar bis einschließlich zur 10 Klasse" (Waterkamp, Schule in der DDR; 1990 )
1983 schließlich, wurde die ,,Auslese" für die EOS auf die zehnte Jahrgansstufe verlegt. Eine für alle einheitliche Bildung war damit auf zehn Jahre herangewachsen. ( siehe Abb. 2, Aufbau des Bildungssystems der DDR )
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2, Aufbau des Bildungssystems in der DDR der 80er Jahre
Quelle: Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994, S.28
Unzulässigkeit von kirchlichen Schulen
Da die DDR dem Bildungssystem den sozialistischen Einheitsgedanken zugrundelegte, war es nur eine Frage der Zeit, dass eine alte Forderung der Arbeiterbewegung vor dem 2. Weltkrieg durchgesetzt wurde: kirchliche und private Schulen sollten im Bildungswesen keinen Einfluss haben.
Die im Jahr 1949 verkündete Verfassung der DDR bestimmte die Unzulässigkeit von Privaten und Kirchlichen Schulen.
Die Kirchen behielten aber noch das Recht auf Erteilen von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Dies wurde in den frühen 50er Jahren wieder untersagt.
Geschlechterrolle innerhalb der Schülerschaft
Innerhalb des neu geschaffenen Schulsystems sollte auf eine Teilung der Geschlechter verzichtet werden. Dies entsprach dem Gedanken an die gesellschaftliche Gleichheit aller Bürger.
Der Einheitsschulgedanke zog von vornherein einer Diskriminierung der Geschlechter enge Grenzen.
Es darf jedoch nicht unterstellt werden, dass die traditionellen Geschlechtsrollen durch die Schaffung der Einheitsschulen von vornherein außer Kraft gesetzt werden konnten. Dieses Problem konnte nicht über Nacht gelöst werden.
In den 70er Jahren war die Diskriminierung der Mädchen jedoch weitgehend überwunden. 1986 waren sogar 56% der Schüler an den 12 Klasse der EOS Mädchen. Der Anteil in der Berufsausbildung mit Abitur betrug 34% an weiblichen Schülern.
Lediglich an der Auswahl der Fächer waren Unterschiede der Geschlechter zu erkennen. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die traditionelle Bildungsvorstellung, nicht gänzlich ihr Geschlechtsrollenstereotyp verloren hatte, obwohl nach außen hin die Bedingungen für eine Gleichstellung geschaffen waren.
Landschulen
Probleme zwischen dem ländlichen und dem städtischen Unterschied des Schulwesens erwiesen sich als äußerst beständig. Zwar gelang es dem Osten schneller als dem Westen die einklassigen Landschulen abzuschaffen, doch bestanden die erheblichen Unterschiede zwischen Land und Stadtschule weiterhin. Die Differenz zwischen Stadt und Land hinsichtlich der Möglichkeiten, das Abitur zu erlangen waren bis zum Ende der DDR weiterhin gegeben. Es wirkte sich vor allem das größere Angebot an Abiturklassen in der Berufsausbildung aus: Die Ausbildung in Industrieberufen war häufiger als die Ausbildung in landwirtschaftlichen Berufen, mit der Möglichkeit zum Erwerb eines Abiturs verknüpft.
Die achtjährige Grundschule an den wenig gegliederten Landschulen wurde zum großen Teil von schlecht ausgebildeten Neulehrern ( siehe 2.1, Neulehrer ) geleitet. Somit gab es zunächst eine Verschärfung des Chancengefälles zwischen Stadt und Land. Dies führte dazu, dass die Zahl der einklassigen Grundschulen zwischen 1946 und 1957 von 2000 auf 23 reduziert wurde.
2.2.2 Arbeiter und Bauern Fakultäten
Mit der Einführung der allgemeinen achtjährigen Grundschule wurde das Problem der Bildungsgleichheit und damit der Wettbewerbsgleichheit reduziert.
Der Anteil der Arbeiter und Bauernkinder wurde in den Klassen 9 bis 12 wesentlich erhöht: Waren 1945 nur ca. 4% aus diesen Schichten, waren es 1949 bereits 31%, die eine Klasse der Oberschule besuchten. (Der Aufbau, 1952, S. 52)
Um den Anteil der Unteren Klasse an den Hochschulen zu erhöhen, waren schon 1946 spezielle Einrichtungen zum Vorstudium gegründet worden, sie wurden als sogenannte ,,Vorstudienanstalten" den Universitäten angelagert.
Arbeiter und Bauern, so die Richtlinien, sollten in einem Kurs von drei Jahren die Zugangsvoraussetzungen für ein Hochschulstudium erwerben.
Hierdurch wuchs der Anteil der ,,Arbeiter und Bauernkinder" an den Studenten beträchtlich. ( siehe Tabelle 2, Anteil der Arbeiter Klasse an den Studierenden )
Tabelle2 : Anteil der Arbeiter Klasse an den Studierenden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Geißler, Umbruch und Erstarrung in der Sozialstruktur der DDR
1949 wurden die Vorstudienanstalten umgewandelt, jetzt waren sie als so genante Arbeiter und Bauern Fakultäten (ABF ) den Universitäten direkt angegliedert
3.0 Die Demokratische Bildungsidee: Curricula in der DDR
Die Curricula der DDR waren schon sehr früh auf die sozialistische Grundidee abgestimmt. Sie sollten die Trennung von höherer und niederer Bildung beenden. Ebenso sollten Curricula wissenschaftlichen Charakter aufzeigen und den Schülern demokratisches Handeln vermitteln. Gleichzeitig sollten die Schüler zu guten Arbeitskräften herangebildet werden. Die Curricula wurden als Wiederspiegelung von Notwendigkeiten deklariert und bürokratisch sanktioniert.
1946 gab es erstmals die Forderung den gesamten Unterricht, auf allen Stufen nach Lehrplänen zu erteilen ( Gesetzesnovelle 1946, zum Bildungssystem der DDR, S.4 ). Der Charakter der Curricula wurde direkt mit der zukünftigen Rolle der Schüler als Bürger und Arbeiter in Zusammenhang gebracht.
,,...Die Erziehung zur Demokratie kann nur durch Erziehung zum selbstständig denkenden und verantwortungsbewusst handelnden Menschen vermittelt werden" ( Die Demokratisierung 1946, S.10 )
3.1 Die Wissenschaftlichkeit der Bildung
Individuelle Unabhängigkeit und Demokratie waren zentrale Ideen der Curricula. Mit Blick auf den Nationalsozialismus wurde gefordert, dass Bildung nicht wieder den Fehler machen dürfe, sich als Pflege reiner Geisteskultur zu verstehen.
Denn dieser Fehler war der Grund gesellschaftlicher Ungleichheit und entspreche darin der Kultur des Kapitalismus. Im Bildungssystem der DDR ging man davon aus, dass das kapitalistische Bildungssystem die Menschen daran gehindert hatte, den ideologischen Schein der Gesellschaft zu durchdringen und das System der Herrschaftsverhältnisse zu erkennen. Die Wissenschaftlichkeit der Bildung sollte also der Aufklärung der Gesellschaft über die Lebensverhältnisse dienen und sie bei der Entwicklung eines demokratischen Verständnisses unterstützen.
Daran war auch die Forderung nach gleicher Bildung für alle verknüpft. Die Allgemeinbildung wurde zum Bestandteil des Curriculums. Wissenschaftliche Erkenntnisse über gesamtgesellschaftliche Entwicklungsgesetze sollten vermittelt werden und so eine Motivation für die soziale Integration geschaffen werden.
Ein neues Erziehungsprogramm 1949 wurde das Schulgesetz der DDR verabschiedet. In ihm war das neue Erziehungsprogramm enthalten. Hier wurde erstmals gefordert, dass Bildung sich an einer ,,objektiv" begründeten Weltanschauung orientieren müsse.
Die sozialistische Weltanschauung galt als objektiv und deshalb stand sie auch nicht im Wiederspruch zu dem Bemühen die Curricula wissenschaftlich stärker als bisher zu profilieren.
Der Glaube an die Objektivität der politischen Orientierung im Bildungssystem ist bis zur Wende nicht mehr aus den Curricula der DDR verschwunden.
Aufbau des Sozialismus im Bildungssystem Zum Parteitag 1952 proklamierte die SED zum ersten mal den planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Der wichtigste Anteil dieser Aufgabe sollte der Schulischen Bildung zufallen:
,,Die deutsche Demokratische Schule hat die Aufgabe, Patrioten zu erziehen die ihrer Heimat, ihrem Volk, der Arbeiterklasse und der Regierung treu ergeben sind" ( Beschluss des Parteitages 1952, S.2 )
Schüler sollten sich wissenschaftliche Grundlagen aneignen und diese mit sozialistischem Handeln verbinden.
Da Naturgesetze in der marxistischen Theorie einen wesentlichen Bestandteil hatten, sollten die Schüler erkennen, wie in der sozialistischen Gesellschaft die Naturgesetze zur Beherrschung der Natur und der Entwicklung der Produktion angewandt werden. Mit der Gründung der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule wurde 1959 die Einheit von Wissenschaftlicher Bildung und Arbeit bekräftigt.
3.2 Das Curriculum der DDR im Internationalen Vergleich
Bei der Festlegung von Allgemeinbildung war es für die DDR Pädagogen immer schwierig, angesichts des heutigen Tempos wissenschaftlicher Entwicklung die Inhalte der Curricula zu bestimmen.
Zumal es hier abstrakte vorgaben seitens der sozialistischen Regierung gab, die kaum umzusetzen waren. Ziele wie ,,allseitige harmonische Bildung der Persönlichkeit und der sozialistischen Tugenden", oder ,,sozialistische Schöpfungskraft" und ,,Wehrbereitschaft" vermitteln einen Eindruck von den erheblichen Schwierigkeiten beim Umsetzen solcher Ziele in die Curricula.
Tatsächlich orientierten sich die Curricula, trotz der sozialistischen Vorgaben, nur gering an jenen Bildungszielen. Sondern an internationalen Vorstellungen was als Bildung anzusehen ist.
Die Entscheidungen, die zur Konzeption der Curricula getroffen wurde ( Stundentafeln und Unterrichtsfächer ), waren sorgfältig durch internationale Vergleiche, hauptsächlich mit der BRD abgesichert. ( siehe Abb. 3 und 4 Unterrichtsstunden der Klassen 1 - 4 / 5 - 10 in der DDR und der BRD )
Dies führte dazu das die Anzahl der Stunden und die Art der Fächer, weitgehend jenen der BRD glich. Es ist demnach offensichtlich, dass sich hier systemübergreifend bestimmte
Entwicklungstendenzen durchsetzten. Dieser Sachverhalt war für den späteren Einigungsvertrag, der den Beitritt der neuen Bundesländer regelte von großer Wichtigkeit: Die Bildungsabschlüsse der DDR Bürger sollten danach auch unter neuen Verhältnissen anerkannt werden.
Abbildung 3, Unterrichtsstunden der Klassen 1 - 4 im Vergleich zur BRD
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4, Unterrichtsstunden der Klassen 5 - 10 im Vergleich zur BRD
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
( Quelle: Abb. 3 & 4, Arbeitsgruppe Bildungsbericht, 1994, S.268 )
3.3 Direkter Internationaler Vergleich
In einem 1992 durchgeführten Vergleich zwischen den Curricula der BRD, der DDR, der UDSSR, der CSSR Japan, Bulgarien, Polen und Ungarn, wurde festgestellt das sich Schulbildung unabhängig von nationalen Besonderheiten entwickelte. Die Curricula entsprachen dem, was international auch sonst in Schulen gelehrt wurde:
- Unterricht in einer oder mehreren Nationalsprachen gehörte in allen Ländern zum Curriculum. Die Unterrichtung von Lokalsprachen und Dialekten war eine Ausnahme.
- Unterrichtung von Sprachen mit religiösen Charakter oder Unterricht in alten klassischen Sprachen Europas hat zugunsten eines modernen Fremdsprachenunterrichts an Bedeutung verloren.
- Überall war auch der Mathematikunterricht verbreitet der als wichtiges Bildungselement in einer als wissenschaftlich verstandenen Welt gilt.
- In allen Ländern gab es auch Unterrichte in Naturwissenschaften, Fächer die die Soziale Welt betreffen ( Geschichte / Geographie / Sozialkunde) und ethische Fächer. Ethische Fächer wurden in Form von Religionsunterricht oder aber Staatsbürgerkunde unterrichtet.
( Curriculumvergleiche von Meyer / Kamens / Benavot 1992 )
Charakter der Lehrpläne
Die Vorgaben der Lehrpläne stellten die Pädagogen vor große Probleme.
Lehrpläne wurden von einer staatlichen Stelle herausgegeben und ließen dem Lehrer kaum Spielraum eine eigene Vorgehensweise zu entwickeln.
Die Lehrpläne enthielten detaillierte Stoffverteilungspläne, die jeweils Stoffeinheiten für mehrere Unterrichtsstunden vorgaben.
Sie wurden mit den zu verwendenden Unterrichtsmaterialien versehen und sollten der
Rationalisierung dienen. Unterrichtsmaterialien bestanden aus Tafelbildern, Filmen, Folien und entsprechenden Lehrbüchern.
Hinzu kamen sogenannte Unterrichtshilfen, die eine detaillierte Vorgabe für die Durchführung jeder einzelnen Unterrichtsstunde enthielten.
4.0 Die Rolle der Lehrer und Schüler in der DDR
Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern unterlag im wesentlichen weitgehend bürokratischen Reglements. Die Stellung der am ,,Schulleben" Beteiligten, war durch eine Schulordnung geregelt. Erlassen wurde diese durch den Ministerrat der DDR.
Der Name der Schulordnung macht deutlich welchem Denkansatz die Lehrer und Schüler folgen sollte: ,,Verordnung über die Sicherheit einer festen Ordnung an der allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule"
Sie war an die in Deutschland verbreiteten Wertorientierungen angeknüpft.
In ihr wurden unter anderem die durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichte nochmals minutiös reglementiert. Lehrer und Schüler wurden dazu aufgefordert sich das Staatliche Bildungsfernsehen anzusehen und die Rolle des Schulleiters wurde festgelegt: Dieser war auf die Politik der SED verpflichtet, er war monokratisch und stand allen Prüfungen vor.
4.1 Aufgaben von Lehrern
Ebenfalls durch die Schulordnung geregelt war, dass Lehrer Aufgaben wahrzunehmen hatten, die dem westdeutschen Bildungssystem teilweise fremd waren:
Die Aufgaben der Lehrer kann man in drei Aufgabengebiete teilen:
1) Der Lehrer als Fachlehrer: Verpflichtung zur Weiterbildung, fachliche Anleitung und Kontrolle. Teilnahme an zentralen Fachgruppensitzungen, Kontrolle durch die Direktoren der jeweiligen Schulen ( siehe Kapitel 4.0, ,,die Rolle der Lehrer und Schüler in der DDR ) sowie deren Stellvertreter und ggf. Mitarbeiter der Schulbehörde und Elternvertreter.
2) Lehrer als Repräsentanten der jeweiligen sozialistischen Ideen. Weiterbildung , politische Anleitung und Kontrolle der Schüler.
- alle Lehrer waren dazu verpflichtet an den monatlich stattfindenden Parteiversammlungen teilzunehmen.
- Lehrer mussten an den monatlich stattfindenden Sitzungen der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung teilnehmen.
- Dreimal im Jahr fand der Pädagogische Rat statt, dies war eine
Versammlung der Lehrer der jeweiligen Schule. Sie diente der
Meinungsbildung und der Entwicklung des einheitlichen Handelns und war über eine Verordnung, die der Schulordnung angegliedert war, geregelt ( Verordnung 1979, S. 118 ).
- Klassenlehrer hatten die FDJ Versammlungen zu organisieren und waren zur Teilnahme verpflichtet
- Lehrer einer 7. Klasse hatten die Fachtagung ,,Unter der blauen
Fahne" zur Vorbereitung des Eintritts in die FDJ zu organisieren.
- In den Klassen 9 und 10 musste der Lehrer neben den monatlichen
FDJ Versammlungen auch das FDJ Studienjahr organisieren. Hier befasste man sich mit verschiedenen kulturellen und politischen Themen.
3) Lehrer als vormilitärische Ausbilder
- Lehrer hatten Unterstufenschüler in das Manöver ,,Schneeflocke" zu führen und mit Geländespielen auf die vormilitärische Ausbildung der Oberstufe vorzubereiten.
- Lehrer organisierten einmal im Jahr die Woche der Wehrbereitschaft, Schüler sollten hier z.B. Atemschutzmasken anfertigen und wurden im verhalten bei ,,ABC" Kriegen geschult.
- In den Winterferien war für die Lehrerschaft die Teilnahme an den täglichen Weiterbildungsseminaren obligatorisch, hier wurde die politische Schulung vertieft.
Aus diesem Aufgabenkatalog des Lehrkörpers, geregelt in der Schulordnung, wurden die Aufgaben bereiche der Schüler abgeleitet, Raum für persönliche Selbstdarstellung war praktisch kaum gegeben.
Die Liste der Aktivitäten der Lehrer und damit auch der Schüler lässt erkennen, dass ihre Rollen, vereint durch Funktionen, verknüpft waren. So sollten Lehrer nicht als Vertreter einer professionellen Berufskultur ihren Schülern mit der Bereitstellung von Wissen zu Hilfe kommen, sondern sollten als Experten politisches Wissen und wissenschaftliches Fachwissen vertreten.
Sie sollten als Experten des politischen Wissens Offiziere rekrutieren und Manöver durchführen und damit den suggestiven Einfluss von Zeremonien nutzen.
4.1.1 Wehrerziehung im Schulischen Curriculum
Wehrunterricht galt in der DDR als weiterer Schritt hin zur Vervollkommnung der sozialistischen Erziehung. Wehrunterricht wurde als Pflichtfach bereits in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre in die Curricula aufgenommen.
Wehrerziehung wurde mit der allgemeinen Bildung verknüpft.
Als Leitgedanke galt in der DDR die Militärdoktrin von W.I. Lenin, wonach die imperialistische Aggressionsgefahr erst mit dem Ende der Übergangsepoche vom Kapitalismus zum Kommunismus beseitigt sei. Von dieser Doktrin frei war praktisch kein
Bildungsbereich. Das Ziel des staatsbürgerlichen Unterrichts, ,,Vaterlandsliebe und Hass gegen den imperialistischen und militärischen Vaterlandsfeind" herauszubilden, wurde seit 1957 von allen außenpolitischen Ereignissen nicht berührt. Vor der Einführung des Faches Staatsbürgerkunde war es bereits Aufgabe der Gegenwartskunde gewesen zur Bereitschaft für den Schutz und die Verteidigung der DDR zu erziehen. Wehrpolitischer Unterricht spielte immer früher eine Rolle im Unterricht: Waren noch nach dem Lehrplan für die Unterstufe in der Muttersprache von 1951 wehrpolitische Inhalte zuerst im 4. Schuljahr zu behandeln, und zwar ausschließlich in geschichtlichen Zusammenhängen ( Befreiung vom Nationalsozialismus; Rolle des Heeres als Machtinstrument des deutschen Staates ), so sollte das Thema ,,Kampf unserer Arbeiter und Bauern um den Frieden" nach dem Lehrplan von 1954 bereits im 3. Schuljahr in ca. vier Stunden behandelt werden.
Im 4. Schuljahr waren auf diesen Vorleistungen aufbauend, Beispiele für den Beitrag sowjetischer Pioniere ,, bei der Verteidigung ihres Vaterlandes" vorzustellen. In weiteren Unterrichten sollten das Freund - Feind Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten vertieft werden.
Im Lehrplan von 1956 wurde bereits im 1. Schuljahr das Thema ,,Wir lieben den Frieden und wollen ihn erhalten" vorgesehen. Auch in qualitativer Hinsicht wurde der Wehrunterricht im Gefolge der militärpolitischen Entwicklung der DDR bereits gegen Ende der fünfziger forciert. Die unterrichtliche Behandlung der Kampfgruppen und des Betriebsschutzes wurde erstmals im heimatkundlichen Deutschunterricht des 4. Schuljahres nach dem Lehrplan von 1959 verlangt.
Im Fach Zeichnen wurden Themen wie ,,Grenzpolizist mit Hund" und ,,Kampfgruppen marschieren" schon im 3. Schuljahr verbindlich.
Der im pädagogischen Selbstverständnis der DDR zentrale Terminus der allseitigen Erziehung drängte in der Folge zu einer neuen Dimension.
Nämlich der Begrifflichen Einheit von geistiger, weltanschaulich - moralischer, polytechnischer, ästhetischer und körperlicher Erziehung die Wehrerziehung hinzuzufügen. Diese pädagogisch integrierte neuerliche Komponente ,,sozialistischer Allseitigkeit" wurde allerdings in den erziehungswissenschaftlichen Publikationen von K. Marx nicht berücksichtigt.
4.2 Rolle der Schüler
Den strukturellen Bedingungen, denen der Lehrkörper unterlag, waren indirekt auch die Schüler unterworfen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten an den Schulen wurden jedoch auf die Mitgliedschaft in der FDJ beschränkt. Sie war als Gesinnungsvereinigung und als Organ der politischen Macht konzipiert.
Folgende Aufgaben waren durch die Schulordnung geregelt:
- Schüler sollten die Arbeitsatmosphäre im Kollektiv einsetzen, fleißig und gewissenhaft lernen.
- Schüler sollten an Unterrichten über Zivilverteidigung und Brandschutz teilnehmen.
- Die Schüler hatte gute Noten vorzuweisen, diese galten als Tugenden eines guten Sozialisten.
- Schulische Leistung wurde als Beitrag zur Stärkung des Sozialismus verstanden, hier galt die Losung: ,, Die Schulbank mein Kampfplatz für den Frieden"
- Schulleistungen mussten in der FDJ öffentlich thematisiert werden
- Öffentliche Kontrolle der Schulleistungen in der FDJ oder in einer Schulversammlung waren Pflicht.
- Lernpartnerschaften für schwächere Schüler wurden initiiert und nach einer gewissen Zeit wurde über diese öffentlich Rechenschaft abgegeben.
Diese Verpflichtungen sollten den Schülern die Bedeutung des Lernens für die sozialistische Gemeinschaft nahe bringen. Sie haben daher nicht nur kontrollierend gewirkt, sondern dem einzelnen auch Aufmerksamkeit und Anregung zuteil werden lassen.
4.2.1 Jugend und Staatssicherheit
Noch kurz vor der Wende, 1989, waren 6% der 173000 inoffiziellen Mitarbeiter ( IM )des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS ) unter 18 Jahre alt.
Diese Jugendlichen ( ca. 10.000 ) wurden zum überwachen ihres sozialen Umfeldes eingesetzt ( Lehrer / Mitschüler / Freunde / Eltern etc.). Jugendliche wurden seit Anfang der 70er Jahre verstärkt vom MfS überwacht .Denn hier war eine Generation herangewachsen, die in offener Distanz zur Regierung stand und sich der Kontrolle durch die Jugendorganisationen der SED entzog.
Zur Kontrolle dieser ,,Jugendszene" wurden schließlich Gleichaltrige eingesetzt, die entweder in der Gruppe integriert waren oder aber eingeschleust wurden.
Als schwierig erachteten Mitarbeiter des MfS die Rekrutierung von Jugendlichen. Die Motivierung Jugendlicher zur Kooperation und zur Verpflichtung als inoffizieller Mitarbeiter war deshalb ein eigenes Forschungsfeld der ,,Operativen Psychologie", die an der Stasi Hochschule Potsdam gelehrt wurde. Viele Dissertationen waren dem Problemkreis des Einsatzes Jugendlicher gegen jugendliche gewidmet.
Angeworben wurden die Jugendlichen entweder im Rahmen polizeilicher Maßnahmen oder ( in den meisten Fällen ) in den Schulen. Vorraussetzung hierfür war die regelmäßige Durchsicht und Überprüfung aller Schülerakten der siebten Klassen hinsichtlich ihrer ,,kadermäßigen Eignung". Ebenso Überprüft wurde die Haltung zur ,,Verteidigungsbereitschaft", das Einbringen in die Jugendorganisation der Partei und die politische Zuverlässigkeit der Eltern.
In erster Linie galten sogenannte ,,Westkontakte" und Bindungen an die Kirche als negative Merkmale. Die Ergebnisse der Überprüfungen unter den 13 bis 14 jährigen bildeten die Grundlage für die Rekrutierung des Offiziersnachwuchses der Nationalen Volksarmee und unter dem pseudonym ,,reguläre Militärlaufbahn", der zukünftigen hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS.
Auch die potentiellen inoffiziellen Mitarbeiter wurden hier ausgewählt: Wurden jugendliche Ims gebraucht, wurden sie auf der Grundlage der gesammelten Informationen bewertet und direkt in der Schule angesprochen. Jeder jugendliche IM erhielt einen Führungsoffizier zugeordnet, dem er regelmäßig Berichte abliefern musste. Die Verpflichtung zur Mitarbeit und zur strikten Wahrung der Konspiration erfolgte meist mündlich. Erst mit der Volljährigkeit wurde dann ein schriftlicher Verpflichtungsvertrag unterzeichnet.
5.0 Bildungschancen der sozialen Schichten
Kinder aus den unteren sozialen Schichen sollten in der schulischen Förderung der DDR besondere Aufmerksamkeit erhalten. Die Idee der Gleichheitsnorm sollte hier durchgesetzt werden. Damit verbunden, sollte die politische Macht in die Hände der Arbeiterschaft gelegt werden. Politische Gesinnung und Engagement wurden beim Übergang in die Abiturstufe zu einem wesentlichen Selektionskriterium. Abstammungsprestige wurde zu einer wichtigen Möglichkeit Bildungschancen wahr zu nehmen.
Die Selektion durch Abstammung wurde von den Schulen durchgeführt. Die Schulleiter schlugen Schüler zur Aufnahme in die Abiturstufen vor. An der Auswahl waren immer der Klassenleiter, die Fachlehrer, der Elternbeirat und die FDJ Leitung der Schule beteiligt. Als Richtlinie zur Zulassung galt ein Erlass aus dem Jahr 1949, hiernach sollten ,,politische
Aktivisten" bei der Aufnahme zur Oberstufe stets bevorzugt werden. (Richtlinie zur
Aufnahme an die Oberstufe und der Arbeiter und Bauern Fakultät, 1949 )
Mindestens 60% aller neuen Schüler in den Abitursstufen sollten Arbeiter und Bauerkinder sein. Ein weiteres Ziel dieser Selektion war die systematische Beseitigung der kapitalistischen Klasse in der DDR. Dies sollte durch die Enteignung von Besitz und die Privilegierung von Arbeitern und Bauern beziehungsweise deren Kindern geschehen.
Das Kriterium Arbeiterkind / Bauernkind verursachte in der Praxis große Probleme. Wie sollte dies definiert werden, eindeutige Definitionen fielen bereits der Sozialforschung in der DDR sehr schwer. So sah man sich schließlich zu einer gesetzlichen Klarstellung veranlasst, die an kapitalistische Adelskalender erinnerten. Als Kriterium wurde schließlich 1951 die 1942 ausgeübte Erwerbstätigkeit des Vaters festgelegt.
In Grenzfällen, in denen eine genaue Zuordnung der Beschäftigung des Vaters nicht möglich war, sollte seine ideologische Einstellung berücksichtigt werden.
Die politische Bedeutung der Arbeiter und Bauern wandelte sich 1955, die Arbeiter und Bauernklasse war nun nicht mehr der zentrale Punkt des Bildungssystems. Im Mittelpunkt standen nun Kinder von Eltern mit wichtigen Funktionen im Staat, die bei dem Aufbau der Republik eine Rolle gespielt hatten, dies wurde per Richtlinie in die Schulordnung integriert.
Fazit
Das Schulsystem der DDR sah im Marxismus mit seinen philosophischen, ökonomischen und politologischen Bestandteilen seine weltanschauliche, theoretische und methodische Grundlage. Ihr Traditionsverständnis umfasste die pädagogischen Bestrebungen der Arbeiterbewegung und die Sowjetpädagogik.
Die Reformpädagogik und die sogenannte spätbürgerliche Pädagogik blieben weitgehend ausgeschlossen. Der marxistische Grundkonsens war verschieden auslegbar und wurde unterschiedlich ausgelegt, wenn auch nicht die Vielfalt des westeuropäischen Marxismus im westlichen Sinne möglich war. Die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der DDR Pädagogik ist lange als ein Vorzug, bzw. als ein erstrebenswertes Ziel angesehen worden. Das Schulsystem hatte seine eigene Identität, da es sich mit der DDR - Gesellschaft verbunden wusste und an der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspraxis dieser Gesellschaft maßgeblich beteiligt war. Die Erziehungswissenschaft in der DDR war vor allem an der Entstehung der einheitlichen allgemeinbildenden zehnklassigen Schule für alle Kinder mit einem anspruchsvollen Unterricht, vor allem im mathematisch- naturwissenschaftlichen Bereich, und mit dem sie charakterisierenden polytechnischen Bildungsbereich als hauptsächlichen Leistung des Schulwesens in der deutschen Schulgeschichte entscheidend beteiligt. In der Bildungspolitik der DDR kam dem Motiv der Einheit von Bildung und Arbeit eine gewisse Bedeutung zu, seine Verwirklichung scheiterte jedoch an den Arbeitsverhältnissen. Der Staatssozialismus hatte an die überkommende Form der innerbetrieblichen Arbeitsteilung nur in Grenzen gerührt. Mit geringen Veränderungen war es bei der Enteignung der Arbeitenden von der Kontrolle über den Arbeitsprozess geblieben, so dass der Arbeitserfahrung ein Bildungswert kaum zukam. Da der Wiederspruch zwischen den geltenden Bildungsvorstellungen und der restriktiven Arbeitsorganisation nicht gelöst werden konnte, blieb das Programm einer Bildung durch Arbeit insgesamt eng begrenzt.
In Gesprächen mit ehemaligen DDR Bürgern deren Kinder heute im ,,westlichen" Schulsystem aufwachsen habe ich erstaunlicher weise feststellen können, dass in der Regel das einheitliche Bildungssystem der DDR favorisiert wird. Als negativ wurde meist nur der militärische Teil des Schulsystems empfunden. Staatliche einflussnahem, beispielsweise durch Zwang zum Beitritt in die FDJ, wurden kaum als negativ empfunden, sie galten vielmehr als Möglichkeit der ,,Sinnvollen" Freizeitgestaltung und der positiven Formung des Charakters. In der Regel wurde die Finanzielle Frage als vorrangig angesehen, hatte man für die schulische Ausbildung nur ein vergleichsweise geringen Teil an finanziellen Mitteln aufzubringen, so ist die Finanzielle Frage heute eine der Endscheidensten wenn es darum geht ob das Kind nun in ein Gymnasium geht oder aber ,,nur" die Hauptschule besucht und damit schneller an die Grenzen eigene Finanzielle Mittel stößt.
Meine Meinung:
Subjektiv favorisiere ich ebenfalls das Schulsystem der DDR. Die oben erwähne Finanzielle Frage ist für Eltern aus, unteren sozialen Schichten maßgeblich bei der Frage nach dem Schulabschluss ihres Kindes. Schon heute ist der Trend zum schnellen Schulabschluss bei den unteren Klassen deutlich zu erkennen, der Prozentsatz an Kindern der unteren Klasse im Bereich der Gymnasien ist stetig sinkend. Ein Trend den die DDR bereits zu Beginn ihres Bestehens als Grund für soziale Unruhen erkannte und bekämpfte. Eine einheitliche zehnklassige Schulausbildung wirkt wesentlich dem Auseinanderklaffen der sozialen ,,Schere" entgegen, dies allein könnte schon ein Aspekt sein, dass deutsche Schulsystem zu hinterfragen. Das von Politikern oft als negativ dargestellte Eingreifen des Staates in das Schulwesen der DDR, ist für mich nur zum Teil zu überdenken. Parteiliche
Jugendorganisationen die die soziale Kompetenzen bilden und unterstützen sind in Deutschland seit langem in das Erziehungswesen integriert. Man denke nur an die ,,Kirchlichmilitärisch- bürgerliche Ausbildung" der Pfadfinder, in der Kinder noch heute im christlich bürgerlichen Sinne beeinflusst werden. Die DDR ging hier einen Schritt weiter und integrierte Jugendarbeit in der Schule, sicherlich mit diversen negativen Folgen, jedoch ist dies im Grundsatz durchaus als nachvollziehbarer Schritt zu bewerten. Denkt man an den Religionsunterricht an deutschen Schulen, sind auch hier deutliche die Einflussnahmen von Organisationen zu erkennen und diese werden staatlich unterstützt.
Ich sehe im Mangel an Bildungsmöglichkeiten, den Grund für die deutliche Orientierung hin zu den radikalen Kräften in Deutschland, Armut und damit verbunden Mangel an Bildung, treibt die Menschen in die Arme jener Kräfte. Ein Vorgang der im vergangenem Jahrhundert zu zwei Weltkriegen und der Menschenverachtenden Politik der NSDAP führte, dies hatten die Erziehungswissenschaftler der DDR erkannt.
Literaturverzeichnis
- Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994
- Alt Robert ( 1946 ), Zur Gesellschaftlichen Begründung der neuen Schule
- Geißler, Robert ( 1991 ), Umbruch und Erstarrung in der Sozialstruktur der DDR
- Archiv der PDS, Berlin
- Anweisungen 1 - 100 des Staatssekretariats für Hochschulwesen der DDR
- Geißler, Robert ( 1991 ), Umbruch und Erstarrung in der Sozialstruktur der DDR
- Häder, Sonja, Bildungsgeschichte einer Diktatur
- Lenhardt, G. ( 1974 ), Schulentwicklung und Sozialstruktur in der BRD und der DDR
- Lötsch / Meier ( 1988 ), Das Verhältnis zwischen körperlicher und geistiger Arbeit
- Marx, Karl ( 1953 ) Das Kapital, Band 2, kommentierte Ausgabe
- Mietzner, Ulrike, Enteignung der Subjekte - Lehrer und Schule in der DDR
- Tenorth, Heinz - Elmar , Politisierung im Schulalltag der DDR
- Waterkamp, D. ( 1990 ), Schule in der DDR; 1990
- Zimmermann, H. ( 1994 ), Überlegungen zur Geschichte der Kader und der Kaderpolitik in der DDR
- Zimmermann, H. ( 1976 ), Politische Aspekte in der
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieses Dokuments über das Bildungssystem der DDR?
Dieses Dokument behandelt umfassend das Bildungssystem der DDR, beginnend mit den theoretischen und gesetzlichen Grundlagen, über die Entwicklung zur Polytechnischen Oberschule, die Curricula, die Rollen von Lehrern und Schülern bis hin zu den Bildungschancen der sozialen Schichten. Es analysiert die marxistischen Einflüsse, die gesellschaftliche Begründung der Schulreformen und die tatsächliche Umsetzung der Gleichheitsnorm in der Bildung.
Welche Reformen gab es zur Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems in der DDR?
Das Dokument beschreibt die wesentlichen Reformen, wie das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schulen (1946), die Entnazifizierung des Lehrkörpers (Befehl Nr. 40, 1946), die Einführung der Neulehrer (Befehl Nr. 162, 1946), das Gesetz zur sozialistischen Entwicklung des Schulwesens (1959), das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem (1965), die Auflösung der gymnasialen Oberstufe (1969) und die Erweiterung des Bildungsprogramms auf zehn Jahre (1983).
Wer waren die Neulehrer und welche Rolle spielten sie im Bildungssystem der DDR?
Die Neulehrer waren Lehrer, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen einer verkürzten Ausbildung eingesetzt wurden, um den Lehrermangel zu beheben und die Entnazifizierung des Lehrkörpers zu kompensieren. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Vermittlung sozialistischer Ideologie, waren jedoch oft unterqualifiziert und wurden somit zu einem Instrument der politischen Führung.
Was war die Polytechnische Oberschule (POS) und wie entwickelte sie sich?
Die Polytechnische Oberschule war die obligatorische allgemeinbildende Schule in der DDR. Ihre Entwicklung war ein Prozess, der von Reformen und Gesetzen geprägt war und 1983 mit der einheitlichen Bildung für alle Kinder über zehn Jahre gipfelte. Sie zielte darauf ab, wissenschaftliche Bildung mit praktischer Arbeit zu verbinden.
Inwiefern unterschieden sich die Curricula der DDR von denen anderer Länder?
Obwohl die Curricula der DDR von der sozialistischen Ideologie beeinflusst waren, orientierten sie sich in Bezug auf Fächer und Stundenanzahl stark an internationalen Standards, insbesondere an denen der BRD. Allerdings enthielten sie spezifische Elemente wie die Wehrerziehung und die ideologische Ausrichtung.
Welche Rolle spielten Lehrer und Schüler in der DDR Schule?
Die Rollen von Lehrern und Schülern waren durch bürokratische Reglements und die Schulordnung klar definiert. Lehrer waren nicht nur Fachlehrer, sondern auch Repräsentanten der sozialistischen Ideologie und in die vormilitärische Ausbildung eingebunden. Schüler hatten sich den kollektiven Zielen anzupassen und sich für den Sozialismus einzusetzen.
Wie wurde versucht, Bildungschancen für Kinder aus unteren sozialen Schichten zu verbessern?
Die DDR versuchte, durch die Schaffung der Einheitsschule und die Bevorzugung von Arbeiter- und Bauernkindern den Zugang zu höherer Bildung zu erleichtern. Es gab Arbeiter- und Bauernfakultäten (ABF), die speziell auf die Vorbereitung dieser Bevölkerungsgruppen auf ein Hochschulstudium ausgerichtet waren.
Wie war die Rolle der Wehrerziehung im Schulischen Curriculum?
Wehrerziehung galt als ein integraler Bestandteil der sozialistischen Erziehung und wurde bereits in den frühen 50er Jahren als Pflichtfach in das Curriculum aufgenommen. Sie war mit der allgemeinen Bildung verknüpft und sollte die Schüler auf die Verteidigung der DDR vorbereiten und Hass gegen den imperialistischen Feind schüren.
Gab es Überwachung durch die Staatssicherheit in den Schulen?
Ja, die Staatssicherheit (MfS) überwachte Schulen und Schüler, insbesondere ab den 1970er Jahren. Jugendliche wurden als inoffizielle Mitarbeiter (IM) rekrutiert, um Mitschüler, Lehrer und ihr soziales Umfeld auszuspionieren.
Was waren die wichtigsten Aspekte des "Fazit" des Dokuments?
Das "Fazit" fasst zusammen, dass das Schulsystem der DDR auf marxistischen Grundlagen basierte und die Einheit von Bildung und Arbeit anstrebte, wobei die praktische Umsetzung an den Arbeitsverhältnissen scheiterte. Es wird auch erwähnt, dass einige ehemalige DDR-Bürger das einheitliche Bildungssystem bevorzugen und staatliche Einflussnahme nicht unbedingt negativ empfanden, sondern eher als Möglichkeit der sinnvollen Freizeitgestaltung.
- Arbeit zitieren
- Carsten Heil (Autor:in), 2000, Einführung in das Einheitsschulsystem der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97531