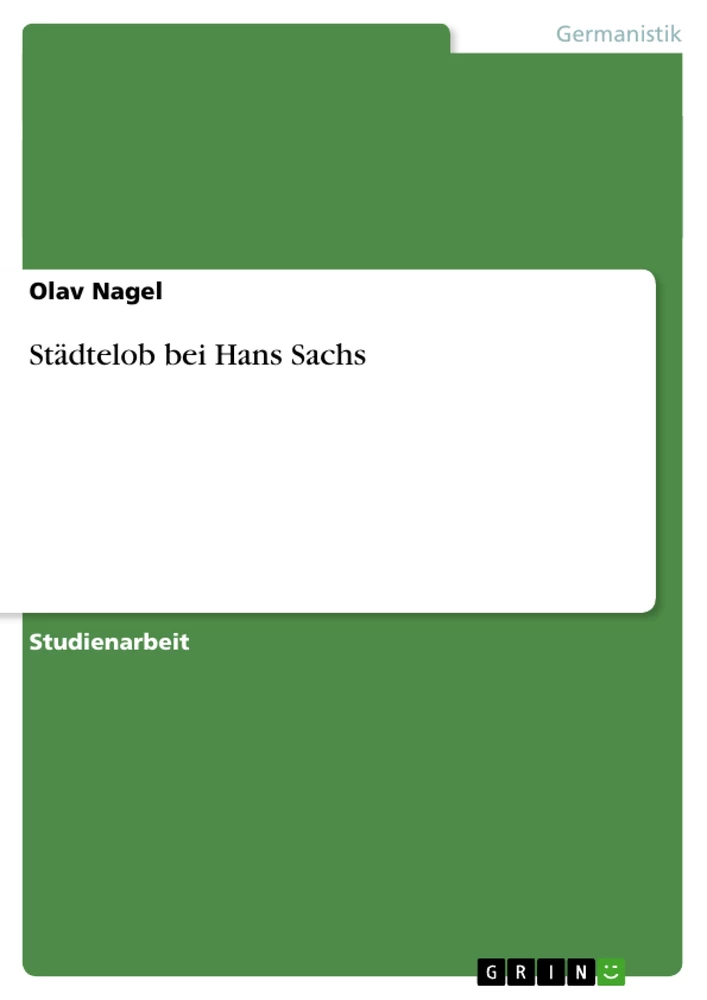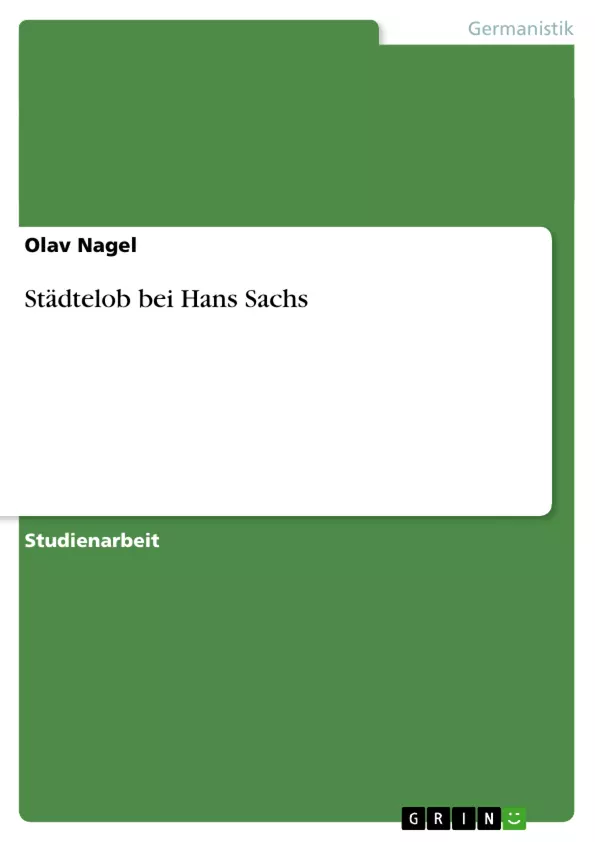Inhalt
1. Nürnberg
1.1. Handel
1.2. Handwerk
1.3. Städtische Identität
2. Das Meisterlied
2.1. Geschichte
2.2. Regeln
2.3. Singschulen
3. Städtelob
3.1. Geschichte
3.2. Bruni: Lob der Stadt Florenz
3.3. Hans Sachs: ,,der lieblich draum", ,,auffschlus des draums"
4. Literatur
1. Nürnberg
Das Nürnberg der frühen Neuzeit ist nicht nur als Lebens- und Wirkungsort Hans Sachs' interessant, sondern auch als Paradigma für die Entwicklung der Stadt dieser Zeit an sich. Nürnberg war auf einem wirtschaftlichen Höhepunkt, ein Zentrum des Buchhandels und der humanistischen Wissenschaften und führend in den politischen und religiösen Auseinandersetzungen der Reformationszeit. Es war zu Beginn des 16. Jahrhunderts 1200 Quadratkilometer groß, zum größten Stadtstaat des Reiches wurde es um die Mitte des Jahrhunderts mit 1521 Quadratkilometern - das war doppelt so groß wie das Bundesland Hamburg heute (Bernstein S.17). Bleibt zu fragen, ob es ein speziell städtisches Bewußtsein der Nürnberger bzw. der frühneuzeitlichen Stadtbürger generell gab.
1.1. Handel
Wesentlich abhängig war dieökonomische Blüte der seit 1313 freien Reichsstadt von Handel und Handwerk sowie deren strikter Reglementierung durch den Stadtrat. Nürnberg, dessen Umland aufgrund schlechter Lehm- und Sandböden keine reichen Ernten zu verzeichnen hat, liegt an zwölf großen Handelsstraßen und der Kreuzung der zwei wichtigsten, die die oberitalienischen Städte mit der Hanse verbanden (die älteste Straße führte über Würzburg nach Frankfurt, wobei als Handelsweg auch der Main eine wichtige Rolle spielte), sowie den Rhein mit der Donau. Kusch: ,,Die Verbindung dieser Wasserstraßen war von Karl dem Großen anüber König Ludwig I. bis in die Gegenwart betrieben worden und soll schon in wenigen Jahren den Anforderungen moderner Binnenschiffahrt gerecht werden." (S.155)
So reißt seit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Reichsstadt z.B. den Gewürzhandel an sich, der via Italien Gewürze aus der gesamten Welt und speziell aus dem Orient importierte.
Nürnberg wird schnell neben Augsburg zum größten Vermittler des deutschen Handelsverkehrs mit Italien und führt neben Gewürzen hauptsächlich Früchte, Öl, Weizen, Weihrauch und Leder von in Europa unbekannten Tieren ein. Venedig spielt eine zunehmend wichtigere Rolle: seit Beginn des 16. Jahrhunderts wird es Mode, daß die Söhne reicher Kaufmannsfamilien ein Jahr dort verbringen, um Italienisch zu lernen, kaufmännisches Rechnen und die italienische Buchhaltung.
Bei ihren kaufmännischen Aktivitäten bewiesen die Nürnberger einiges Durchsetzungsvermögen: nach einer ersten Beschwerde der Lübecker Krämer im Jahre 1405, die sich durch geschickte Nürnberger Kaufleute um ihren Profit gebracht sehen, nach mehreren Erhöhungen der Zölle für Transitgüter, ordnet der Lübecker Rat an, daß die Nürnberger in der Hansestadt nur noch in ihrer Heimat erzeugte Produkte verkaufen dürften. Die Nürnberger kontern, indem sie ihre Waren Lübecker Kaufleuten in Kommission geben oder Lübecker Bürger werden - ohne sich dabei Nürnberg zu entfremden (Kusch S.162f). Von einiger Risikobereitschaft zeugt auch die erste abendländische Handelsfahrt nach Ostindien 1505/06: neben Augsburger und Genueser Händlern brachen unter Portugiesischer Leitung auch Mitglieder der Nürnbger Familien Imhof und Hirschvogel in völlig unbekannte Gefilde auf, aus denen sie mit Pfeffer und anderen Gewürzen nach Hause kamen - und einer Gewinnspanne von etwa 175 % (Kusch S.168). Außerdem blüht der Handel mit Metallen, Waffen und anderen Erzeugnissen der Metallverarbeitung, derentwegen Nürnberg bald einen exzellenten Ruf hatte (wegen des starken Bedarfs an Metall waren an allen ertragreichen Bergwerken vom Norden bis hinein nach Ungarn, Böhmen und Tirol Nürnberger Großkaufleute beteiligt), mit Mineralien und Heilmitteln, italienischen und Schweizer Stoffen, Gold, Silber und Edelsteinen sowie Papier ,,in jenen feinen Sorten, die man in den Ostseegebieten nicht herzustellen verstand" (Kusch S. 163).
Importiert wurden Lebensmittel, Pelze und Hanf, ostpreußischer Bernstein und baltisches Wachs. Geldgeschäfte wickelten die Nürnberger im Vergleich zum Produktenhandel wenige ab, allerdings schlugen sie beispielsweise in Lübeck die Italiener in diesem Geschäft aus dem Feld.
Neben seinerökonomischen Seite hatte der Handel jedoch auch kulturelle Aspekte: neben Waren aller Art transportierten die Kaufleute selbstverständlich auch Forschung und Wissenschaft in alle Welt und aus aller Welt zusammen. So galt in der Prager Altstadt seit dem 14. Jahrhundert Nürnberger (Handels-)Recht, was sich auf die Geschäfte natürlich positiv auswirkte. Den
Kaufleuten folgten die Handwerker und Künstler, deren guter Ruf sich durch Nürnberger Produkte und deren Händler überall verbreitet hatte. Albrecht Dürer wird in Venedig mit Ruhm und Aufträgen überhäuft. In Italien sind deutsche Gastarbeiter so zahlreich vertreten, daß Papst Pius II. behauptet, zu seiner Zeit seien dort alle Gastwirte Deutsche gewesen (Kusch S. 172). In Prag ließen sich viele Bürger Nürnbergs nieder, viele Böhmen siedelten nach Nürnberg über, wodurch die Häufigkeit des Namens ,,Behaim" und ,,Böhm" erklärt wird. Die Kaufleute waren selbstverständlich auch Boten und Informationsträger: vor dem Aufkommen des Druckes und der Zeitungen berichteten sie mündlich z.B. Preisschwankungen, aber auch Meldungen für die Öffentlichkeit über Kriege, Unglücksfälle etc., später wirkte der Buchversand Anton Korbergers von Nürnberg aus auf den Humanismus im ganzen Reich ähnlich wie die Stiche und Radierungen Albrecht Dürers auf dem Sektor der bildenden Kunst: ,,In Mexiko finden wir einen Lazarus de Norimberga, Schwiegersohn von Jakob Cromberger, der als erster Buchdrucker Amerikas bekannt ist", vermeldet Kusch stolz (S.169), ,,einer der ersten Nürnberger, der sein halbes Leben in Amerika verbrachte, war Bartel Blümlein, der Mitbegründer von Santiago de Chile".
Durch den regen Handel wurde Nürnberg allerdings auch von seinen Beziehungen zum Umland abhängig und mußte dementsprechend außenpolitisch Vorsicht walten lassen. Etliche Ratsentscheidungen sind in Hinblick auf mögliche diplomatische Verwicklungen besser zu verstehen; unter anderem, warum eine penible Zensur notwendig erschien, wie sie auch Hans Sachs betraf.
1.2. Handwerk
Für den Export seiner Handwerksprodukte war Nürnberg schon im Mittelalter berühmt geworden. Weltruf genoß die Stadt für die o.g. Metallprodukte ebenso wie für nautische und astronomische Instrumente (etwa die berühmte Taschenuhr von Peter Henlein und den ersten Globus von Martin Behaim). Die hohe Qualität der Nürnberger Waren läßt sich zurückführen auf die detaillierten Regelungen des Stadtrates, deren genaue Einhaltung streng kontrolliert wurde. Wurden beispielsweise verwässerter Wein oder gestrecktes Bier festgestellt, so wurden die betreffenden Behältnisse unter Trommelschlag des Büttels auf Wagen geladen und zur Pegnitz gefahren, wo sie in den Fluß geleert wurden. Gewürzfälscher hatten mit härtesten Strafen zu rechnen: Mitte des 15. Jahrhunderts wurden drei Männer, die Safran mit wertlosen Zutaten gestreckt hatten, verbrannt und eine Mithelferin lebendig begraben (Kusch S.171). Veit Stoß, schon zu seiner Zeit ein bekannter Künstler, wurde auf beiden Wangen gebrandmarkt, weil er einen Schuldschein gefälscht hatte. Gleichermaßen wurden Handwerkserzeugnisse exakt kontrolliert und bei Beanstandungen ersatzlos zerstört.
Diese rigide Vorgehensweise sollte gewährleisten, daß die Nürnberger Waren konkurrenzfähig blieben und der Export, Nürnbergs wichtigste Einkunftsquelle, weiterhin florierte. Doch die große Anzahl von Vorschriften, die sich nicht nur auf die frühkapitalistische Warenproduktion bezog, sondern für annähernd jede Lebenssituation eine gesetzliche Regelung vorsah, muß noch weiter hinterfragt werden.
Handwerker stellten etwa 50% der Einwohner Nürnbergs, dennoch waren sie praktisch ohne politischen Einfluß. Seit dem großen Handwerkeraufstand 1348 waren Zünfte verboten, Vereinigungen wurden von oben mißtrauisch beobachtet. Um sich dennoch organisieren zu können, trafen sich die Handwerker unter dem Schutz der Kirche: sie gründeten sogenannte Bruderschaften. Deren Zielsetzungen waren zunächst im weitesten Sinne religiös, wurde aber seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend weltlicher (es sei kurz darauf verwiesen, daß auch die Meistersingerschulen eine sehr ähnliche Tendenz aufwiesen, die sich an den Veränderungen der Meisterliederthematiken ablesen läßt). Auch diese erregten beim Stadtrat Mißfallen: nachdem der Rat 1507 den Zirkelschmieden einen Berufszusammenschluß nach ihren Wünschen verweigert hatte und diese insgeheim eine (wie Kusch spekuliert) möglicherweise als kirchliche Bruderschaft getarnte Zunft aufbauten, entdeckte der Rat diesen Vorgang und bestrafte die Urheber mit Gefängnis (Kusch S.175). 1524 verließein Teil der Kandelgießer die Stadt, als ihnen eine Mehrung ihrer Rechte versagt wurde. So lag die Gerichtsbarkeit aller Handwerksgruppen beispielsweise beim Stadtrat. Auch diese Furcht vor Vereinigungen einzelner gesellschaftlicher Gruppen soll geklärt werden.
Schließlich läßt sich gerade für die Zeit wirtschaftlicher Hochkonjunktur in Nürnberg feststellen, daß der Rat in seinen Entscheidungen höchst konservativ war. Jeglicher Fortschritt, so scheint es, wurde abgelehnt, ja geradezu unterdrückt. So wurde 1403 einem Drahtzieher untersagt, weiterhin eine Maschine einzusetzen, die seine Nadelproduktion verdoppelt hätte - er mußte das Gerät zerstören und alle Meister dieser Kunst mußten schwören, derartige Vorrichtungen nie wieder zu gebrauchen. Ähnliche Vorfälle lassen sich viele finden (Kusch S.177f). Eine Anzahl von Handwerkszweigen durfte nicht wandern, sie waren ,,gesperrt". Diese Verordnung sollte ein Bekanntwerden von Berufsgeheimnissen verhindern - z.B. die der Fingerhuter, Drahtzieher und Heftlesmacher (welche Schnallen und Schließvorrichtungen für Gewänder herstellten). Es liegt nahe, daß diese Vorgehensweise vorübergehend Vorteile brachte, langfristig aber nachteilig wirkte, weil so keine Neuerungen bekannt wurden, die außerhalb Nürnbergs für Fortschritt sorgten. Auch diese Haltung des Rates bedarf einer Klärung.
Die zahlreichen Vorschriften und die konservative Haltung der Stadtväter führte jedenfalls kaum zu Widerstand in der Bevölkerung, das Verbot von Vereinigungen schon eher. Der Rat galt als hart, aber gerecht. Tatsächlich existierten karitative Einrichtungen, die schon beinahe als soziales Netz bezeichnet werden können. So war es den Kaufleuten verboten, Waren zu horten, um sie in Notzeiten überteuert verkaufen zu können. Im Gegenteil kaufte der Rat selbst in guten Zeiten Lebensmittel auf, um sie zu Zeiten von Teuerungen billig an Bedürftige abgeben zu können. Selbst in individuellen Notlagen griff der Rat ausgleichend ein: Seufert berichtet (im Nachwort zur ,,Wittenbergisch Nachtigall", Stuttgart 1974), dem ohne eigenes Verschulden verarmten Goldschmied Nikolaus Seiler habe der Rat ,,eine wöchentliche Unterstützung durch einen Drittenüberreichen (lassen), derüber die Herkunft des Geldes zu schweigen hatte" (S.163).
1.3. Städtische Identität
Die Stadt taucht in der Literatur der frühen Neuzeit häufig als Einheitswesen auf. Kleinschmidt führt an, daß Städte in den Flugschriften und Zeitungen pauschale Adressaten werden, daß das Kirchenlied für die Stadt eine ,,ideelle Identität" voraussetzt (was weniger das zeitgenössische Erscheinungsbild betrifft als das ideale Konstrukt meist biblischer Städte wie etwa Jerusalem, siehe unten), und daß Städte oft als Damen personalisiert wurden (S.62f).
Doch faktisch war die nach außen erscheinende soziale Geschlossenheit der Stadt keineswegs gegeben. Schließlich war die Stadt abhängig sowohl von der Landwirtschaft außerhalb der Stadt als auch vom Reich und von der Kirche. Nur vor dem Hintergrund des Bewußtseins dieser ständigen Gefahr läßt sich das kaufmännische Streben nach einer administrativen Lösung solcher Probleme verstehen. So wird auch klar, warum der Stadtrat Nürnbergs Interesse an einer größtmöglichen Integration aller Stadtbürger hatte: erst eine Verschmelzung von privatem undöffentlichen Leben, ein überpersönliches Rollenverständnis zog gemeinschaftliches Handeln und staatsgesellschaftliches Bewußtsein für die Stadt als geistigen Bezugsort nach sich.
Die Vereinigungen, wie sie von den Handwerkern angestrebt wurden, liefen diesem Interesse nach Ansicht der Stadtoberhäupter entgegen und wurden deshalb unterdrückt. Zwangsläufig ging mit den Organisationen etwa von Singschulen eine Politisierung dieses eigentlich privaten Lebensmomentes einher: das machte den Schutz durch die Vorgabe religiöser Intention erforderlich und die statutenmäßige Ordnung der Vereine, wie ich sie im Kapitel 2.2. wiedergeben werde. Die exakten Vorschriften über den Meistergesang sind gewissermaßen als Spiegel der stadtgesellschaftlichen Vorschriften interpretierbar. Habermas bemerkt zurecht, daß historisch das Vereinswesen mehr in Hinblick auf seine Organisationsform als durch seine manifesten Funktionen zukunftsweisend war: ,,in diesen ... Sozietäten konnten die politischen Gleichheitsnormen einer zukünftigen Gesellschaft eingeübt werden." (S.14)
2. Das Meisterlied
2.1. Geschichte
Die Meistersinger selbst sahen sich in der Tradition der Minnesänger. Der Ursprung des Meistergesangs geht der Sage nach auf einen Vorfall im Jahre 962 zurück. Demnach wurden die Zwölf Alten Meister (unter ihnen Walther von der Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen, Klingsor und Konrad von Würzburg) der Ketzerei angeklagt und mußten in Gegenwart des Kaisers und der päpstlichen Legaten Leos VIII. Proben ihrer Kunst ablegen. Dazu wurden ihnen religiöse Themen vorgegeben, die sie jeder für sich bearbeiten mußten. Die Resultate dieser Aufgabe waren die ersten Meisterlieder. Auf ihren Vortrag hin wurde die Anklage fallengelassen und die Kunst der Meister ,,für eine löbliche und gottdienliche" (Mey S.5) erklärt.
Einige dieser Zwölf Alten Meister tauchen in einer weiteren Sage (???) auf, die als eine Wurzel des Meistergesangs zu betrachten ist: dem Sängerkrieg auf der Wartburg (Stoff des Wagnerschen ,,Tannhäuser").
Dieser Wettbewerb der Sänger im 13. Jahrhundert kann durchaus als erste Singschule betrachtet werden. Nach dem Untergang der Hohenstaufen-Dynastie und dem Großen Interregnum in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verfiel mit dem Rittertum die ritterliche Poesie. Der Meistergesang wurde am Ende eines langen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Strukturwandels schließlich zu einer Nebenbeschäftigung der städtischen Handwerker, die vom 14. Jahrhundert an als Meistergesang in unserem Sinne bezeichnet werden kann. ,,Meister" war der Titel ausübender und gleichzeitig schaffender Dichter (im Gegensatz zu nur ausübenden Spielleuten), später wurde der Titel mehr zur Unterscheidung zwischen dem adligen ,,Herrn" und dem bürgerlichen Dichter.
Die große Zeit des Meistergesangs war die Mitte des 15.
Jahrhunderts. Die erste feste bürgerliche Singschule wird 1450 zu Augsburg erwähnt, 1492 führen die Straßburger feste Statuten ein, womit der Aufschwung des Meistergesangs beginnt. 1513 wurde eine Schule zu Freiburg im Breisgau gegründet, besonderes Ansehen erlangten weiterhin die Singschulen zu Ulm und Memmingen. Die erste Tabulatur, die uns überliefert ist, wurde in Nürnberg 1540 aufgezeichnet. Es läßt sich feststellen, daß der Meistergesang in seinen Anfängen ein speziell süddeutsches Phänomen war, das erst später nach Norden vordrang.
Die Bezeichnung ,,Schule" ist allerdings irreführend, denn sie bezeichnet zwar durchaus auch vorhandene institutionalisierte Ausbildungsstätten des Sängernachwuchses, häufiger allerdings (gerade im Zusammenhang mit dem Meistergesang) interne und offizielle Singwettkämpfe. Die Vereinigung der Meistersänger wird gewöhnlich Gesellschaft oder Bruderschaft genannt.
2.2. Regeln
Die Regeln des Meistergesangs waren festgelegt in Tabulaturen sowie in Schulregeln. Festgehalten wurden sie in einer großen Zahl von Handschriften, die neben den teilweise merkwürdig anmutenden Regeln auch eine große Anzahl Meisterlieder und deren Töne inklusive Noten enthielten. Der Ausdruck ,,Tabulatur" bezieht sich dabei Mey zufolge nur auf die eigentlichen Kunstregeln, ,,das Wort selbst stammt aus der Musik, wo man chiffrierte Notenschrift darunter verstand" (S.36).
,,Eines jeden Meistergesanges Bar hat ein ordentlich Gem äß in Reimen und Silben, durch des Meisters Mund ordiniert und bewährt; dies sollen alle Singer, Dichter und Merker auf den Fingern auszumessen und zu zählen wissen. Ein Bar hat mehrenteils unterschiedliche Gesätz oder Stück, als vielen deren der Dichter mag. Ein Gesätz besteht meistenteils aus zwei Stollen, die gleiche Melodei haben. Ein Stoll besteht aus etlichen Versen und pflegt dessen Ende, wann ein Meisterlied geschrieben wird, mit einem Kreuzlein bemerkt zu werden. Darauf folgt das Abgesang, so auch etliche Verse begreift, welches aber eine besondere und andere Melodei hat als die Stollen. Zuletzt kommt wieder ein Stoll oder Teil eines Gesätzes, so der vorliegende Stollen Melodie hat." (Wagenseil: ,,De civitate Noribergensi", 1697, zit. nach Mey, S.37) Ein Gedicht, auch ,,Bar" genannt, setzte sich also zusammen aus einer ungeraden Anzahl von Strophen (,,Gesätzen"), die wiederum in je drei Teile zerfielen: zwei Stollen, die zusammen den Aufgesang bildeten, und den Abgesang. Von entscheidender Bedeutung war dabei der Ton (Melodie und Metrik), der das Reim- und Versschema bestimmte. Dieser wichtigsten folgte eine große Zahl weiterer, sehr ausführlicher und heute teilweise merkwürdig anmutende Regeln, die den Meistergesang vorstellen weniger als eine poetische Kunstform (unserem modernen Verständnis nach) als ein Handwerk: es ,,ist zu merken, daß alle stumpfen Reime an Zahl der Silben müssen gerade sein, als nämlich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jedoch so findet man wenige Töne, die vierzehn Silben in einem Reim bringen, als des Ehrenbotten Fürstenton: der bringet in Reimen vierzehn Silben, sonst ist die meiste Länge zu gemeinen Stumpfreimen zwölf Silben. Stumpfe Reime aber werden mit einer Silbe am Ausgang des Reimes beschrieben."
(Meistergesangbuch von Benedict von Watt und Hans Winter aus dem 17. Jahrhundert, zit. nach Mey, S. 40) Bernstein zitiert in diesem Zusammenhang Jacob Grimm, der den Meistergesang seiner akribischen Regeln wegen ,,einen der trockensten und verwickeltsten Gegenstände der altdeutschen Poesie" nannte (Bernstein S.86)
Dementsprechend wundert es nicht, daßes bei jedem Wettsingen sogenannte Merker gab, deren Aufgabe darin bestand, die vortragenden Meistersänger auf ihre exakte Arbeit hin zu bewerten. Auch Hans Sachs übte das Amt des Merkers aus.
Ein Fehler, den ein Merker notieren mußte, war es unter anderem, wenn
- ,,nicht nach der hochdeutschen Sprache gedichtet"
(Wagenseil) wurde, speziell auch, wenn dialektale mit
hochdeutschen Endungen gereimt wurden (,,ein frommer mon" und ,,ging davon" bzw. korrekt: ,,auf rechter bon")
- ,,falsche Meinungen" vorgetragen wurden, also etwa unchristliche oder unzüchtige Texte
- falsches Latein zum Vortrag kam
- halbe oder ,,blinde" (falsche und unverständliche Worte wie etwa ,,sig" statt ,,sich") Worte aus Reimzwang gebraucht wurden.
Mey führt explizit 34 solcher Fehler auf, es dürfte jedoch noch weit mehr Vorschriften gegeben haben.
Die Themen der Meisterlieder waren bis zur Reformation fast ausschließlich religiös und theologisch, in der Regel bestanden sie aus Nachdichtungen einzelner Bibelstellen und deren Exegese. Ein beliebtes Motiv, das auf den Minnesang zurückzuführen sein dürfte, war das Marienlob; bei Hans Sachs beschäftigen sich dreizehn von fünfzig Meisterlieder vor 1520 mit der Mutter Gottes.
Der etwas größere Teil der Hans Sachs'schen Meisterlieder (2300 gegenüber 2000) hat allerdings weltlichen Charakter. Diese Öffnung der Kunstform brachte sie auf einen neuen Höhepunkt - die Anzahl der Themen für Meisterlieder war plötzlich unendlich groß, auch wenn sie nach wie vor didaktischen Charakter behielten.
2.3. Singschulen
Die Singschulen hatten, nachdem der Meistergesang zu einer Domäne der Handwerker geworden war, eine zunftmäßige Ordnung angenommen. Sie waren aus freien Vereinigungen zu ,,festgeschlossene(n), statutenm äß ig betriebene(n) und behördlich anerkannte(n) Verein(en)" (Mey S. 81) geworden. Ihnen anzugehören, hieß nicht nur, sich Bildung aneignen zu können, sondern auch, soziales Prestige zu gewinnen. Abgehalten wurden Singschulenöffentlich und in der Regel in säkularisierten Kirchen (in Nürnberg in der Marthakirche) an Sonn- und Feiertagen. Eine andere, weltlich geprägte Form der Zusammenkunft war die sogenannte ,,Zeche", die meistens in Wirtshäusern abgehalten wurde.
Der gewählte Vorstand der Meistersinger waren die oben bereits erwähnten Merker, deren es in Nürnberg vier gab. Sie urteilten in einer ,,das Gemerk" genannten Sitzung (später nannte sich der Ort so, wo diese Richter, mit einem Vorhang von Bühne und Publikum getrennt, saßen) über den Vortragenden. Dabei waren die Aufgaben geteilt: ein Merker überwachte anhand einer (Luther-) Bibel die Bibeltreue des Meisterliedes (jeder Vortragende mußte genaue Kapitel und Versangaben zu seinem Lied angeben) , ein zweiter verglich das Werk mit der Tabulatur und merkte mit Kreide die Fehler auf einer Tafel an (weshalb die Sänger zu moderater Sangesgeschwindigkeit angehalten waren), der dritte kontrollierte die Sauberkeit der Reime und der letzte achtete auf die genaue Einhaltung des vorgegebenen Tones.
Die Schöpfung eines Tones war dabei die Bedingung, den Titel des Meisters zu erlangen. Um die eigene Kreation unverwechselbar zu machen, gaben die Meister ihren Tönen dabei teilweise höchst skurrile Namen. Mey verzeichnet unter anderem die ,,Kurze Blühweise", die ,,Geborgte Freudweise", die ,,Fluchtweise", die ,,Donnerweise", die ,,Überlange Adlerweise", die ,,Lange Kranichweise", die ,,Papageiweise", die ,,Wachtelweise" und die ,,Kurze Affenweise" (S. 176ff).
Der Verlauf einer Singschule war folgender: nach der Entrichtung (freiwilliger Beiträge) des Publikums begann das ,,Freisingen", an dem jedermann teilnehmen durfte, bei dem nicht ,,gemerkt" wurde und es dementsprechend auch nichts zu gewinnen gab. Nach einem gemeinsam gesungenen Lied (wie beinahe alle Meistergesänge einstimmig) begann das Hauptsingen, in dem ausschließlich biblische Stoffe erlaubt waren (der Vortragende mußte dabei Buch und Kapitel für die Merker angeben). Der beste Sänger des Tages, der ,,Übersinger", erhielt dafür den ,,Davidsgewinner", in Nürnberg war das eine ,,lange, silberne Kette von großen und breiten Gliedern, auf denen die Namen der Stifter gravier waren" (Mey S. 89f). Konnten die Merker sich nicht zwischen zwei gleichermaßen guten Sängern entscheiden, fand das ,,Gleichen" statt, bei dem genauestens ,,gemerkt" wurde und die Tabulaturparagraphen ,,in Schärfe" zur Anwendung kamen. Zu penibles Merken allerdings war wiederum verpönt und wurde ,,Grübeln" genannt. Der Zweitplazierte bekam eine Kette aus seidenen Blumen und durfte bei der nächsten Singschule an der Türe das Geld einsammeln.
Hans Sachs selbst ist überliefert als Erfinder dreizehn neuer
Töne sowie als nachsichtiger Merker, der weit entfernt war von Rigidität: sein Vorschlag war es, zumindest einmal im Jahr das Publikum selbst als Merker zuzulassen.
3. Das Städtelob
3.1. Geschichte
Vorformen des Städtelobes finden sich bereits in der griechischen Literatur. Noch ist das Lob der Stadt keine eigenständige literarische Gattung, sondern wird eingebunden in das Lob eines Mannes, in dem auf dessen Familie, Herkunft und damit Heimat (-stadt) reflektiert wird. Weiterhin werden Städte beschrieben im Zuge von Küstenbeschreibungen, die ,,in sehr frühe Zeit zurückgehen und weder vom Epos noch von der frühen philosophischen Spekulation oder von den Anfängen der griechischen Histographie getrennt werden können" (C.J. Classen, S.4), und auch in griechischen Lokalchroniken lassen sich solche Darstellungen finden; im Laufe der literarischen Entwicklung schließlich in allen Gattungen: in der Epik wie in tragischen Dichtungen, politischen Reden, Gerichtsreden, in Sachliteratur etc. Ähnliches gilt für die lateinische Literatur. Herausstechendes Merkmal allen Städtelobes und aller Stadtbeschreibungen ist, daß in den geschilderten Städten kein Leben zu sein scheint. Städte tauchen auf als Staat (polis) und somit als Träger bestimmter geistig-moralischer Grundlagen, als politischer Mittelpunkt eines Imperiums (speziell Rom), damit einhergehend wird zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung nicht unterschieden, oder als Ansammlung von Bauwerken - nie sind sie Schauplatz von Bürgeraktivitäten; Handel, Handwerk, Märkte, Sport, Bildung, Gasthäuser kommen nicht vor.
In der Spätzeit der Antike scheint dieses literarische Muster durchbrochen zu werden: im Städtelob tauchen zunehmend wissenschaftliche Disziplinen, handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten auf, die von den Bewohnern der jeweiligen Städte mit Stolz betont werden. Es sind jedoch stets nur einzelne Charakteristika (die Alexandriner sind stolz auf ihre Grammatik, die Athener auf ihre Kunstfertigkeit), und selbst diese lassen sich teilweise auf die Leistungen einzelner zurückführen, so daß abermals nicht die Bürgerschaft in ihrer Vielheit im Mittelpunkt steht. Tut sie es doch, wie bei Dion Crysostomos, dann nur im Zusammenhang mit Kritik an ihr, manchmal in ironischem Zusammenhang, oder als (bereits zu Zeiten der Niederschrift des Städtelobes) historische Handlungsträger.
Die Hagiographien des Spätmittelalters preisen die Heimat- und Wirkungsstätten der Heiligen, besonders Jerusalem als Zentrum der religiösen Welt, doch auch hier liegt das Interesse nicht auf der Stadt als solcher, sondern auf der heiligen Stätte, auf dem Symbolismus (Jerusalem als Mittelpunkt der Welt, zu dem es stets bergauf geht, konsequenterweise führen alle Wege aus Jerusalem dann bergab).
Während des gesamten Mittelalters machen sich im Städtelob keine wesentlichen Veränderungen bemerkbar. Bis Ende des 13. Jahrhunderts sind die Topoi des Städtelobes auf einen auffällig begrenzten Kanon festgelegt (der Abweichungen besonders interessant erscheinen läßt). Rhetorische Traditionen haben eine starke Wirkung auf die trotz großer soziologischer Umbrüche unveränderten Darstellungen der Städte. Das Städtelob ist nicht an der Wirklichkeit orientiert.
3.2. Leonardo Bruni Aretino: ,,Lob der Stadt Florenz"
Bruni gestaltet sein (um 1403 entstandenes) Lob der Stadt Florenz als topographische Annäherung an seinen Gegenstand. Nach einer Vorrede, in der er sich darstellt als unfähig, die Größe der Stadt in Worte zu fassen, lobt er die geographische Lage der Stadt, anschließend den Stadtbau, um schließlich auf den Herrschaftssitz zu sprechen zu kommen. Zwar lobt er Wehrhaftigkeit, politische Klugheit und finanzielle Kraft Florenz', die Bewohner der Stadt selbst tauchen aber nur am Rand auf. Vielmehr wird die Stadt personifiziert, er vergleicht die (Vorstellung von der) Stadt mit (der von) einem starken Helden und preist ,,ihre Taten" (nämlich die der Stadt) (Mout, S.51). Anschließend ist eine (topographische) Rückwärtsbewegung festzustellen: die Stadtöffnet sich konzentrisch nach außen, wobei ihre Einwohner zwar eine Rolle spielen, aber eine sehr untergeordnete: ,,Die Bevölkerung ist so zahlreich, daß sie mühelos ausreicht, die Hügel alle zu besiedeln" (Mout, S.52). In einem Resümee schließlich wiederholt sich die Struktur des Textes: das Stadtpanorama wird gewissermaßen ,,herangezoomt", von der Makro- zur Mikroansicht herangeholt. In den letzten Zeilen findet sich eine beinahe ironische Wendung: der Autor gesteht, hingerissen von der Schönheit der Stadt habe er ,,ganz versäumt, von ihren vielen Söhnen zu reden": ,,So wollen wir also das versehentlich Versäumte nun rasch noch in unsere Lobrede aufnehmen" (Mout, S.55) - ein Versprechen, das allerdings nicht eingelöst wird.
Es zeigt sich, daß Brunis Text damit völlig in der Tradition des antiken (und mittelalterlichen) Städtelobes bleibt, stark von rhetorischen Strukturen und literarischen Formen beherrscht. Eine Veränderung des Bewußtseins für die Stadt und das Stadtbürgertum läßt sich nicht feststellen.
3.3. Hans Sachs: ,,der lieblich draum", ,,auffschlus des draums"
In dem bis hierhin skizzierten Kontext wird in bezug auf das Städtelob bei Hans Sachs die Fragestellung interessant, die auch Kugler für seinen Aufsatz als Ansatz wählt: ,,wichtig ist es, die Texte daraufhin zu befragen, wie die Stadt in den Köpfen der Stadtbewohner sich darstellt." (Kugler S. 84)
Sachs wählt eine Darstellungsform, die auf den ersten Blick allegorisch wirkt: die Stadt, zu der der Träumer in seinem Traum gelangt, wird beschrieben als runder Berg auf einer Ebene, umgeben von einem Rosengarten, in dem ein schwarzer Adler ein Nest gebaut hat. Darin behütet er seine Jungen und wehrt sich seiner Feinde, dargestellt als Falken, Geier, Fledermäuse, Raben etc. Um den Vogel finden sich vier Fräulein in Gewändern von unterschiedlicher Farbe, die dem Adler je auf ihre Weise zur Seite stehen.
Diese Allegorien löst Hans Sachs selbst in dem ,,auffschlus des draums" auf: der Vogel steht für die Stadt Nürnberg (deren Wappen einen Adler trägt), der Berg steht für die Burg, der Rosengarten für ,,die ganze Schar", hingegen die Vogeljungen für die Stadtbürger. Die Feinde der Stadt werden benannt als ,,ettlich geistlich weltlich fürsten vnd adel" (Vers 30), die vier Fräulein stehen für Weisheit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Stärke der Stadt.
Bei genauer Betrachtung der literarischen Technik, die Sachs einsetzt, kann man jedoch nicht mehr von einer Allegorese sprechen. Denn zu Beginn des ,,lieblich draums" passiert ,,eine schlichte Gleichsetzung von Bestandteilen der Traumszenerie mit solchen einer real vorfindlichen Landschaft" (Kugler S.90). Die Ebene ist tatsächlich eine Ebene, der Bach ein Bach usw.: ,,der Bereich des Nicht-Begrifflichen, des bildhaft Anschaulichen wird nicht verlassen" (S.91). Die Topographie des Traumes steht in ihrer Konkretheit damit in Gegensatz zu dem Rest des Liedes, in dem die vier Fräulein als tatsächliche Allegorie gebraucht werden. ,,Nürnberg", schließt Kugler, ,,ist zwar in der Topographie lokalisierbar, aber dann doch mehr als ideelle denn als räumliche Größe behandelt" (S.92).
Bemerkenswert ist auch die Gartenallegorie im ,,lobspruch der statt Nürnberg", der in unserem Zusammenhang möglicherweise wichtiger ist als ,,der lieblich draum": die im Garten vorkommenden Gewächse stehen nämlich wider Erwarten nicht für die einzelnen Gebäude der Stadt (als welche der Garten sich dechiffrieren läßt) - sondern für Handel und Handwerk! Damit verläßt Sachs die Tradition, in der Bruni noch steht: bei ihm spielt das soziale Leben der Stadt eine entschiedene Rolle, oder, wie Kugler in marxscher Diktion resümiert: ,,Die Stadt, in ihrer ganzen baulichen Ausprägung ein Arbeitsprodukt, tritt ihren Produzenten, ihren Bewohnern nicht als verselbständigte Größe gegenüber." (S.98)
Literatur
Hans Sachs: ,,Die Wittenbergisch Nachtigall". Reclam, Stuttgart 1974
ders.: ,,Meistergesänge Fastnachtspiele Schwänke". Reclam, Stuttgart 1951
Leonardo Bruni Aretino: ,,Lob der Stadt Florenz". In: Nicolette Mout (Hg.): ,,Die Kultur des
Humanismus". C.H.Beck, München 1998
ders.: ,,Humanistisch-philosophische Schriften", Hg. Hans Baron. Dr. Martin Sändig oHG, Wiesbaden 1969
Eckhard Bernstein: ,,Hans Sachs". Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1993
Barbara Könneker: ,,Hans Sachs". J.B.Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1971 Th. Cramer, G. Kaiser, H. Wenzel (Hg.): ,,Hans Sachs - Studien zur frühbürgerlichen Literatur im 16. Jahrhundert". Verlag Peter Lang, Bern 1978
Harmut Kugler: ,,Die Stadt im Wald. Zur Stadtbeschreibung bei Hans Sachs". In: J. Bumke, Erich Kleinschmidt: ,,Stadt und Literatur in der frühen Neuzeit". Böhlau, Köln 1982 Jürgen Habermas: ,,Strukturwandel der Öffentlichkeit". Suhrkamp, Frankfurt 1990
C. Joachim Classen: ,,Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes Urbium". Olms, Hildesheim 1986
Eugen Kusch: ,,Nürnberg. Lebensbild einer Stadt". Nürnberger Presse, Nürnberg 1989
Curt Mey: ,,Der Meistergesang in Geschichte und Kunst". Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig 1901
Gero von Wilpert: ,,Sachwörterbuch der Literatur". Kröner, Stuttgart 1989
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf einen Text, der sich mit Nürnberg, dem Meisterlied und dem Städtelob beschäftigt. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was behandelt Kapitel 1 über Nürnberg?
Kapitel 1 untersucht Nürnberg in der frühen Neuzeit, insbesondere den Handel, das Handwerk und die städtische Identität. Es beleuchtet Nürnbergs wirtschaftliche Blüte, seine Rolle als Handelszentrum und seine Bedeutung in den politischen und religiösen Auseinandersetzungen der Reformationszeit. Es wird auch die Frage untersucht, ob es ein spezifisch städtisches Bewusstsein der Nürnberger bzw. der frühneuzeitlichen Stadtbürger gab.
Welche Aspekte des Handels in Nürnberg werden in Abschnitt 1.1 behandelt?
Abschnitt 1.1 konzentriert sich auf den Handel in Nürnberg, seine Abhängigkeit von Handelsstraßen und die Reglementierung durch den Stadtrat. Er geht auf den Gewürzhandel, die Rolle Venedigs und die kaufmännischen Aktivitäten der Nürnberger ein. Auch kulturelle Aspekte des Handels, wie der Transport von Forschung und Wissenschaft, werden angesprochen.
Was wird im Abschnitt 1.2 über das Handwerk in Nürnberg beschrieben?
Abschnitt 1.2 widmet sich dem Handwerk in Nürnberg, seiner hohen Qualität und den strengen Regelungen des Stadtrates. Es werden Strafen bei Verstößen gegen diese Regelungen, die geringe politische Einflussnahme der Handwerker trotz ihrer Anzahl sowie die konservative Haltung des Rates gegenüber Fortschritten thematisiert. Auch die karitativen Einrichtungen in Nürnberg werden erwähnt.
Was wird unter dem Begriff "Städtische Identität" in Bezug auf Nürnberg verstanden?
Abschnitt 1.3. beschäftigt sich mit dem Konzept der städtischen Identität in Nürnberg, der Abhängigkeit der Stadt vom Umland, dem Reich und der Kirche. Er untersucht das Streben nach Integration aller Stadtbürger und die Unterdrückung von Vereinigungen durch den Stadtrat. Abschliessend wir auf die Rolle von Singschulen im Stadtleben Bezug genommen.
Was ist das Meisterlied (Kapitel 2)?
Kapitel 2 behandelt das Meisterlied, seine Geschichte, Regeln und Singschulen. Es geht auf den Ursprung des Meistergesangs, den Sängerkrieg auf der Wartburg und die Entwicklung des Meistergesangs als Nebenbeschäftigung der städtischen Handwerker ein.
Welche Regeln galten für das Meisterlied (Abschnitt 2.2)?
Abschnitt 2.2 beschreibt die Regeln des Meistergesangs, wie sie in Tabulaturen und Schulregeln festgelegt waren. Es geht auf die Struktur eines Meistergesangs, die Bedeutung des Tons, die Rolle der Merker und die Themen der Meisterlieder ein. Abschliessend wird auch die Öffnung der Kunstform durch Hans Sachs thematisiert.
Was waren Singschulen (Abschnitt 2.3)?
Abschnitt 2.3 erklärt die Organisation und den Ablauf von Singschulen, die sich zunftmäßig organisiert hatten. Es werden die Aufgaben der Merker, die Kriterien für die Bewertung der Sänger und der Ablauf einer Singschule (Freisingen, Hauptsingen, Gleichen) beschrieben. Es gibt auch Informationen über Hans Sachs' Rolle als Erfinder neuer Töne und nachsichtiger Merker.
Was ist das Städtelob (Kapitel 3)?
Kapitel 3 befasst sich mit dem Städtelob, seinen Vorformen in der griechischen und lateinischen Literatur und seiner Entwicklung im Mittelalter. Es wird auf die Topoi des Städtelobes und die rhetorischen Traditionen eingegangen.
Wie wird das Städtelob in "Lob der Stadt Florenz" von Leonardo Bruni Aretino dargestellt (Abschnitt 3.2)?
Abschnitt 3.2 analysiert Bruni Aretinos "Lob der Stadt Florenz" als topographische Annäherung an die Stadt. Es werden die geographische Lage, der Stadtbau und der Herrschaftssitz gelobt, während die Bewohner der Stadt nur am Rand erwähnt werden. Es wird festgestellt, dass Brunis Text in der Tradition des antiken Städtelobes steht.
Wie stellt Hans Sachs das Städtelob in "der lieblich draum" und "auffschlus des draums" dar (Abschnitt 3.3)?
Abschnitt 3.3 untersucht Hans Sachs' Darstellungen des Städtelobes in "der lieblich draum" und "auffschlus des draums". Es wird die allegorische Darstellungsform analysiert, in der die Stadt als runder Berg, die Burg als Adler und die Stadtbürger als Vogeljungen dargestellt werden. Sachs verlässt die Tradition und lässt das soziale Leben der Stadt eine entscheidene Rolle spielen.
Welche Literatur wird im Dokument zitiert?
Im Dokument wird folgende Literatur zitiert: Hans Sachs, Leonardo Bruni Aretino, Eckhard Bernstein, Barbara Könneker, Th. Cramer, G. Kaiser, H. Wenzel, Harmut Kugler, Jürgen Habermas, C. Joachim Classen, Eugen Kusch, Curt Mey, Gero von Wilpert, Peter Dinzelbacher.
- Quote paper
- Olav Nagel (Author), 2000, Städtelob bei Hans Sachs, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97421