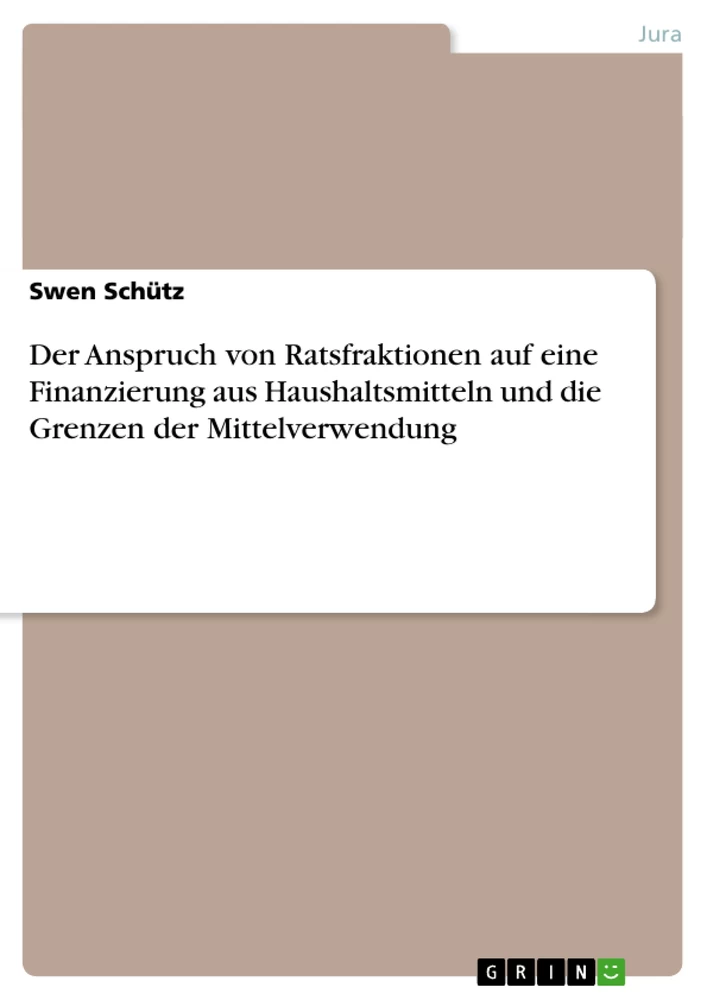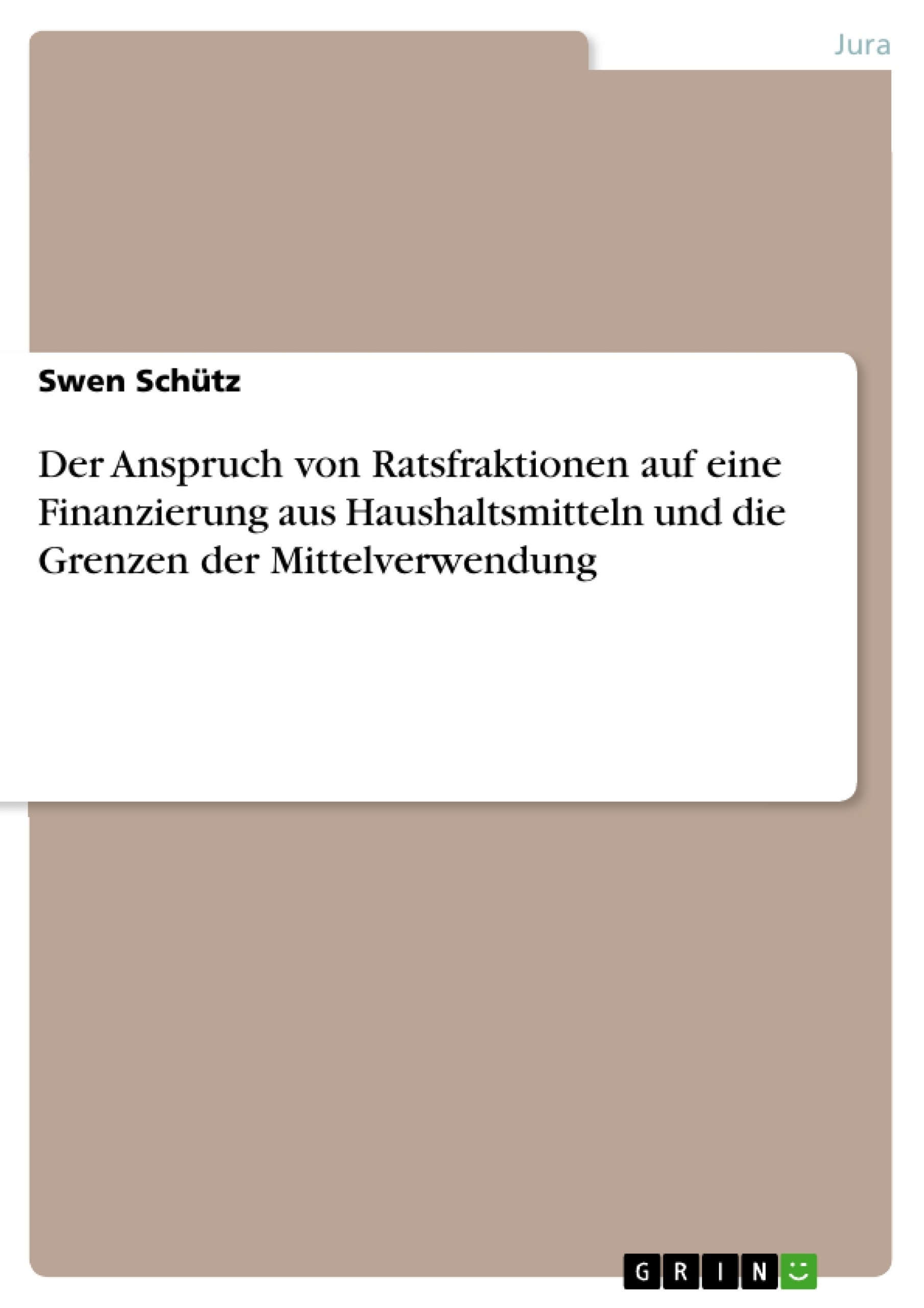Wie gestalten sich die Machtverhältnisse wirklich hinter den Kulissen der Kommunalpolitik? Dieses Buch wirft einen erschreckend ehrlichen Blick auf die Finanzierung kommunaler Ratsfraktionen in Nordrhein-Westfalen und deckt dabei ein komplexes Geflecht aus rechtlichen Grundlagen, politischen Interessen und finanziellen Spielräumen auf. Es analysiert die Entwicklung des Fraktionsbegriffs im Kommunalrecht, beleuchtet die Aufgaben und Funktionen von Fraktionen und untersucht detailliert den Anspruch auf Mittelzuwendung durch die Kommunen. Dabei werden nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die tatsächliche Praxis der Mittelverwendung kritisch hinterfragt. Welche Ausgaben sind zulässig, welche sind unzulässig und wie wird die Verwendung der Gelder kontrolliert? Das Buch geht diesen Fragen auf den Grund und zeigt die Probleme und Perspektiven der kommunalen Fraktionen auf. Es werden die Grenzen der Mittelverwendung aufgezeigt, sowie die maßstäbe für die Höhe der Zuwendung. Auch werden die Zulässigen und unzulässigen Verwendungen erläutert, wie zum Beispiel die Finanzierung von Kraftfahrzeugen oder die Durchführung von Bildungsreisen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kontrolle der Mittelverwendung und der Frage, wie eine transparente und nachvollziehbare Finanzierung der Fraktionen gewährleistet werden kann. Abschließend werden die Probleme und Perspektiven der kommunalen Fraktionen diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Professionalisierung der Kommunalpolitik und die Notwendigkeit einer klaren Aufgabenbeschreibung für die Fraktionen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Kommunalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter und alle Bürger, die sich für die Funktionsweise der Kommunalpolitik interessieren und einen Beitrag zu mehr Transparenz und Verantwortlichkeit leisten wollen. Es bietet wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Macht und zeigt Wege auf, wie die kommunale Selbstverwaltung gestärkt und die Bürgerbeteiligung gefördert werden kann. Tauchen Sie ein in die Tiefen der kommunalen Finanzpolitik und entdecken Sie, wie Entscheidungen getroffen werden, die Ihr Leben direkt beeinflussen. Dieses Buch ist ein Augenöffner und ein Weckruf für mehr Engagement in der Kommunalpolitik.
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Gliederung
Literaturverzeichnis
Banken, Ludger,
Die Ratsfraktion und die Finanzierung ihrer Arbeit, Städte - und Gemeinderat 10/1994 ( S. 317 ff. )
Bick, Ulrike,
Die Ratsfraktion , Berlin 1989
Gabler, Manfred/ Höhlein, Burkhard/ Klöckner, Werner/ Lukas, Helmut/ Oster, Rudolf/
Schaaf, Edmund/ Steenbock, Reimer/ Stubenrauch, Hubert/ Tutschapsky, Uwe/ Rumetsch, Rudolf,
Kommunalverfassungsrecht Rheinland - Pfalz, Wiesbaden 1994, (zit.: KvRP)
Heugel, Klaus
Zuschüsse der Stadt für Ratsfraktionen
Demokratische Gemeinde 1978, S. 394 ff.
Hölzl, Josef/ Hien, Eckart,
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, München 1998
Kleerbaum, Klaus - Viktor,
Die Fraktion und ihre Mitglieder, Bonn 1998
Meyer, Hubert,
Kommunales Parteien - und Fraktionsrecht, Baden - Baden 1990
Oebbecke, Janbernd,
Die neue Kommunalverfassung in Nordrhein - Westfalen, DÖV 1995 ( S. 701 ff. )
Stober, Rolf,
Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland,
3. Aufl., Stuttgart 1996
A. Grundlage der Mittelzuwendung an kommunale Fraktionen in NRW
Im Zuge der Kommunalreform für das Land Nordrhein - Westfalen im Jahr 1994, ist in § 56 Abs. 3 S. 1 GO NW ein Anspruch der Ratsfraktionen auf Mittelzuwendung durch die Kommunen verankert worden. Dadurch ist in der Gemeindeordnung erstmalig ein gesetzlicher Anspruch auf eine, bisher nur aufgrund einer Ermessensentscheidung der Verwaltung1 gewährte, Mittelzuwendung niedergelegt worden. Dadurch ist ein wenig mehr Rechtssicherheit in einem ansonsten nur durch Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften geordneten Problem geschaffen worden. Dass diese gesetzliche Normierung die Kernprobleme der Mittelzuwendung an die Ratsfraktionen nicht lösen konnte wird deutlich, wenn man sich die Entstehung des Fraktionsbegriffs im Kommunalrecht vor Augen führt und die Situation in Nordrhein - Westfalen mit der in anderen Bundesländern vergleicht.
B. Der Begriff der Fraktion im Kommunalrecht
1. Materielle Grundlagen im Kommunalverfassungsrecht
Der Begriff der Fraktion ist in den meisten Kommunalverfassungen entweder nicht oder erst in jüngster Zeit eingeführt worden. Insbesondere in den neuen Ländern ist mit den notwendigen Reformen der Kommunalverfassungen nahezu flächendeckend das Recht auf Bildung von Fraktionen im kommunalen Raum verankert worden. Regelungen über die Bildung von Fraktionen enthalten die Gemeindeordnungen/ Kommunalverfassungen von Berlin2, Brandenburg3, Hessen4, Mecklenburg - Vorpommern5, Niedersachsen6, Rheinland - Pfalz7, Saarland8, Sachsen - Anhalt9, Schleswig - Holstein10 und Thüringen11 . In Nordrhein - Westfalen wurde der Begriff der Fraktion mit der Neufassung der Gemeindeordnung vom 29. 10. 1974 im § 30 Gemeindeordnung eingeführt. Keine Regelungen die einen kommunalen Fraktionsbegriff zum Gegenstand haben enthalten die Kommunalverfassungen von Baden - Württemberg, Bayern und Sachsen. Bis auf diese Länder sind auch in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen keine Regelungen zu finden. Was aber darauf zurückzuführen ist, dass diese Länder keine Kommunalverfassung haben.
In den übrigen alten Bundesländern ist der Begriff der Fraktion im Kommunalrecht im Zuge von Reformen nachträglich eingeführt worden, was anhand der Nummerierung der Vorschriften mittels Buchstaben zu erkennen ist12.
Eine interessante Ausnahme bildet das Bundesland Bayern, das als eines der ersten Länder den Begriff der Fraktion in seine Kommunalverfassung aufgenommen hatte. Allerdings ist dieser im Rahmen einer Angleichung der Gemeinde - an die Landkreisordnung durch die Bezeichnung Partei ersetzt worden. Dies wird jedoch eher als gesetzgeberische Panne zu beurteilen sein, weniger als gezielte Abschaffung des Rechtes, Fraktionen zu bilden13.
2. Aufgabe und Funktion einer Fraktion
Bei der Beantwortung der Frage, was eine Fraktion ist, können die Regelungen der Geschäftsordnung des Bundestages und die damit zusammenhängende Rechtsprechung herangezogen werden. Das Recht der Abgeordneten, eine Fraktion zu bilden ist in § 45 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes niedergelegt.
Es ist ebenfalls festgelegt, dass es sich bei den Mitgliedern der Fraktionen des Bundestages um Abgeordnete derselben Partei handeln soll14 . Dies erscheint auch sinnvoll, wenn man sich den Zweck der Fraktionen von Augen führt.
Die Hauptaufgabe von Fraktionen ist es, die Meinungsbildung in einem Parlament oder einer Vertretung zu erleichtern. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass bereits innerhalb der Fraktionen ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Ansichten der Abgeordneten oder Vertreter gesucht wird. Aussicht auf Erfolg kann dies jedoch nur haben, wenn die Mitglieder einer Fraktion auf einer gleichen, zumindest aber auf einer ähnlichen politischen und weltanschaulichen Grundlage stehen. Daher ist es zweckmäßig, bei der Bildung von Fraktionen auf die Parteizugehörigkeit der Mitglieder zu achten. In der Praxis bestehen die Fraktionen aus Vertretern der gleichen politischen Partei.
Daraus ergibt sich eine weitere Aufgabe der Fraktionen: sie sollen die Vorstellungen der Parteien in die Arbeit der Vertretung einbringen. Somit soll gewährleistet werden, dass ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Interessen in den Parlamenten und Vertretungen berücksichtigt wird.
Da auch in den Kommunen von den Parteien eine große Rolle eingenommen wird, und die Auseinandersetzungen in der Praxis zwischen den politischen Überzeugungen ausgetragen werden, erscheint es zweckmäßig, die Bildung von Fraktionen zuzulassen. ,,Da Fraktionen in der Kommunalpolitik eine Schlüsselrolle spielen und zu den Strukturelementen der Gemeindeverfassung gehören, ist ihre Bildung seit jeher gewohnheitsrechtlich anerkannt15 . In einer Zeit, in der die Zusammenhänge politischer Entscheidungen mehr und mehr an Komplexität gewinnen, wächst den Fraktionen eine weitere Aufgabe zu. Nämlich die Entlastung des einzelnen Abgeordneten durch Aufteilung der Zuständigkeiten und einer damit verbundenen Spezialisierung des Abgeordneten. Damit ist nicht die Abgabe von Kompetenzen oder Verantwortlichkeit des Abgeordneten gemeint, sondern eine Konzentration auf bestimmte Themen - und Aufgabenschwerpunkte in der täglichen Arbeit des Parlamentes oder der Vertretung. Dadurch muss sich der einzelne Abgeordnete nicht in jeden Themenbereich einarbeiten, sondern er kann auf bereits aufbereitete Informationen zurückgreifen16 .
Ein weiterer Aspekt des kommunalen Fraktionsrechtes der dem Bundesrecht angelehnt ist, ist die Festlegung einer Mindestgröße der Fraktionen. Die Mindeststärke der Bundestagsfraktionen liegt bei fünf von Hundert der Mitglieder des Bundestages17 . Ziel einer solchen Regelung ist es, den Organisationsaufwand des Parlamentes so gering wie möglich zu halten und den Ablauf der Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten. Dies wäre aufgrund der umfangreichen Rechte18 , die den Fraktionen zustehen kaum möglich, wenn die Zahl der Fraktionen sehr groß wäre. Da beispielsweise die Verfahren zur Bildung von Ausschüssen in den Räten der Kommunen denen im Bundestag ähnlich sind, ist ein unverhältnismäßiger Aufwand auch hier zu befürchten. Diesem Aspekt ist in den meisten Bundesländern durch die Festlegung einer Mindestzahl von Fraktionsmitgliedern Rechnung getragen worden19 . Die Kontrollfunktion, die der Rat gegenüber der Verwaltung hat, unterliegt sogar einer noch größeren Beschränkung, als die Bildung der Fraktionen. So ist für die Durchführung einer Akteneinsicht ein Antrag von mindestens einen Fünftel der Ratsmitglieder notwendig20 .
Auch ist zu befürchten, dass eine große Anzahl sogenannter Kleinstfraktionen durch die Einbringung aussichtsloser Anträge die Arbeit der Verwaltungen erheblich beeinträchtigen würde. Denn diese sind verpflichtet, die Anträge der Fraktionen zu bearbeiten und zu ihnen Stellung zu nehmen. Dadurch würde die Bündelungswirkung der Fraktionen, die ja gerade ihre Aufgabe ist, komplett ad absurdum geführt.
Ein wesentlicher nachteiliger Effekt, den die Zulassung von Ein - Mann - Fraktionen hätte, ist der gesteigerte Mittelbedarf für die Grundausstattung der Fraktionen. Dies wird im folgenden deutlich.
C. Der Anspruch von kommunalen Fraktionen auf Mittelzuwendung
Die Praxis der Zuwendung von Finanzmitteln an Fraktion im kommunalen Bereich fußt auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1966, in dem es heißt, dass die Fraktionen als ständige Gliederungen des Bundestages in die organisierte Staatlichkeit eingefügt seien. Deshalb könne ihnen ein Zuschuss gewährt werden21 . Dabei ist die als Maßstab für die Höhe der Zuschüsse die Funktion der Fraktionen herangezogen worden. Es ist Aufgabe einer Fraktion, Meinungen zu bündeln und somit eine Mehrheitsbildung zu erreichen. Ziel der Fraktionsbildung soll es sein, die Arbeit des Organs, dem die Fraktion zugeordnet ist zu erleichtern. Alles, was diesem Ziel dient, kann daher grundsätzlich förderungswürdig sein. Als grobe Grenze sieht das Bundesverfassungsgericht das Verbot einer indirekten Parteienfinanzierung. Wo hier im Detail die Grenzen zu ziehen sind will ich zunächst nicht weiter ausführen.
Die Zuwendung von Mitteln an die kommunalen Fraktionen ist auch ohne gesetzliche Grundlage üblich gewesen. Eine Umfrage des Nordrhein - Westfälischen Innenministers aus dem Jahr 1977 ergab, dass bereits zu diesem Zeitpunkt in allen kreisfreien Städten in NRW eine Zuwendung üblich war22 . Die Zuwendung von Haushaltsmitteln der Kommunen an die Fraktionen wird auch von der Rechtsprechung des Landes Nordrhein - Westfalen als rechtmäßig anerkannt23 . Das Gericht verwies dabei insbesondere auf die Parallelität zwischen den Fraktionen im Bundestag und denen in den Kommunen.
Ohne gesetzliche Regelung wurde in den einzelnen Städten allerdings eine sehr unterschiedliche Handhabe an den Tag gelegt. Dies wird anhand eines Vergleiches einiger Städte deutlich: die Zuwendung an alle im Rat vertretenen Fraktionen betrug in Münster: 70.000 DM; Gelsenkirchen: 230.000 DM; Essen: 820.000 DM; Köln: 1.900.000 DM24 .
Aufgrund dieser teilweise krassen Unterschiede in der Zuwendungspraxis wurde schnell der Ruf nach einer gesetzlichen Regelung laut. Erschwerend kommt hinzu, dass die Städte und Gemeinden, die die Zuwendungen gewähren "können", an die Beschlüsse der Vertretung gebunden sind. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Fraktionen selber entscheiden, ob und in welcher Höhe sie Haushaltsmittel erhalten. Wenn man nun die beträchtliche Höhe der Zuwendungen und die mangelnde Transparenz zusammen nimmt, erkennt man schnell, das hier der Nährboden für Unmut der Bürger bereitet wird. Es ist daher notwendig, einen Maßstab für die Mittelzuwendung zu finden.
Auch in dieser Frage ist die Suche nach Regelungen durch den Gesetzgeber nicht erfolgreich. Es hat sich aber durchgesetzt, dass als Grundlage bei der Bemessung der Mittelzuwendung die Größe der Fraktion in Kombination mit einem Grundbedarf für die Geschäftsführung verwendet wird. Daraus ergibt sich ein Verteilungsschlüssel, der einen Sockelbetrag pro Fraktion und einen Zuschuss pro Kopf vorsieht. Dieser Auffassung folgt auch die Rechtsprechung. In einem Urteil des VG Gelsenkirchen heißt es: ,,... dass insoweit zur Beachtung des Grundsatzes der Chancengleichheit ein Sockelbetrag für jede Fraktion, verbunden mit einer auf die Stärke abgestellten Aufstockung angemessen sein dürfte, weil sowohl zur Unterhaltung der Geschäftsstellen wie auch für Büromaterial und Literaturbeschaffung ein gewisser Grundbedarf für alle Fraktionen gleichermaßen anzuerkennen sein und weil das Ansteigen der Mitgliederzahl keineswegs eine lineare, sondern eine degressive Steigerung der Kosten bewirken dürfte."25 .
Die GO NW sah bereits in ihrer alten Fassung vor, dass die Kommunen Zuwendungen aus Haushaltsmitteln an die Fraktionen gewähren können26 . Dabei hat NRW eine Vorreiterrolle eingenommen, die dazu geführt hat, dass auch in einigen anderen Bundesländern mittlerweile die Möglichkeit einer Finanzierung der Ratsfraktionen durch die Kommunen eingeräumt wird27 .
Dabei ist zu beachten, dass eine solche Formulierung keinen grundsätzlichen Anspruch der Fraktionen auf eine Finanzierung ihrer Arbeit begründet. Deutlich wird dies in einem Urteil des VGH Kassel28 , in dem das Ermessen hinsichtlich des "ob" einer Zuwendung deutlich hervorgehoben wird. Allerdings haben die Fraktionen aufgrund des Gleichheitssatzes einen Anspruch auf die angemessene Beteiligung an der Finanzierung, wenn diese bereits gewährt wird. Dieser Grundsatz gilt nicht nur in den Ländern, die - so wie Hessen - eine entsprechende Vorschrift in ihrer Kommunalverfassung haben, sondern wohl auch dort, wo den Fraktionen aus Gewohnheit eine Zuwendung erfahren.
Anders hingegen ist die Situation in NRW nach der Einführung der neuen Gemeindeordnung 1994 zu betrachten. Der Wortlaut des §56 Abs. 3 S.1 GO NW ist so zu verstehen, dass die Gemeinden verpflichtet sind, den Fraktionen Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu gewähren29 . Dies bedeutet, die Fraktionen haben einen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung.
Abschließend kann festgestellt werden, dass nach der Neufassung der GO die Frage, ob die Fraktionen Haushaltsmittel erhalten dürfen, mit einem klaren ,,Ja" beantwortet werden muss. Dies ist aber letztlich nicht bestritten worden, lediglich der Anspruch der Fraktionen auf diese Zuwendungen ist neu. Da aber in NRW bereits Mitte der siebziger Jahre eine flächendeckende Mittelgewährung üblich war, ist es auch nicht zu einer Klage einzelner Fraktionen gegen eine Kommune gekommen.
Im Grunde dreht sich der Kernstreit nicht um die Frage des ,,Ob" der Mittelzuwendung, sondern um das ,,Wie". Und hierbei im besonderen um die Grenzen der Verwendung dieser öffentlichen Gelder. Und hierbei ist es in der Tat auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen in NRW gekommen.
D. Die Grenzen der Mittelverwendung
Wie schon in den bisherigen Ausführungen deutlich geworden ist, ergeben sich die meisten Regelungen des kommunalen Fraktionsrechtes aus den Gewohnheiten der Verwaltungspraxis. So wie auch die Entscheidung über die Mittelzuwendung im Ermessen der Verwaltung lag, besteht ein enormer Spielraum bei der Bemessung der Höhe und der Art der gewährten Zuwendungen. Daraus ergibt sich, dass die Mittel für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden können. Es ist aber fraglich, welche dieser Zwecke auch im Sinne der Kommunalordnung sind.
Aufgeworfen wurde diese Fragestellung insbesondere durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 13. 2. 198730 .
Zunächst macht das Gericht einige Ausführungen über das Verfahren der Ermittlung des Geschäftsführungsbedarfes. ,,Die Fraktionen legen dar, welche Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung entstanden sind, strittige Aufwendungen werden gegebenenfalls vom Rat als ,, für die Geschäftsführung" entstanden oder als nicht darunter fallend bewertet." Dann wird von dieser Grundlage ausgehend die Ermessensentscheidung getroffen, ob und in welchem Umfang die bereits entstandenen Kosten der Fraktionen durch Zuwendungen gedeckt werden sollen. Aus Gründen der besseren Handhabe lässt es das Gericht zu, dass den Fraktionen ein Pauschalbetrag im Voraus gewährt wird. Dies ist jedoch nur mit einer anschließenden Überprüfung der Verwendung der Mittel zu gestatten.
Fraglich ist, welche Ausgaben der Fraktionen ,,für die Geschäftsführung" erforderlich sind. Das Gericht lässt hierfür nur solche Verwendungen gelten, die ,,für die Erfüllung der durch die Gemeindeordnung zugewiesenen organschaftlichen Aufgaben anfallen". Da die Ausführungen des VG Gelsenkirchen zu dieser Frage wohl als zu eng angesehen werden können31 , hat das Innenministerium per Erlass vom 2. Januar 198932 einen Katalog von zulässigen und unzulässigen Verwendungen der Haushaltsmittel zusammengestellt. Ich werde mich im folgenden am Erlass des Innenministeriums orientieren und versuchen, die einzelnen kritischen bzw. zustimmenden Anmerkungen aus der Literatur einzuarbeiten. Der Innenminister unterscheidet zwischen zulässigen und unzulässigen Verwendungen:
1. Zulässige Verwendungen
Das Anmieten von Räumen für die Einrichtung einer Fraktionsgeschäftsstelle, sowie für das Abhalten von Fraktionssitzungen kann mit Mitteln des kommunalen Haushaltes finanziert werden. Es sei denn, die Verwaltung stellt den Fraktionen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung33 , hierbei kann es sich auch um Räume in Schulgebäuden handeln. Aufgabe der Fraktionen ist die Zusammenführung von mehrheitlich für richtig gehaltenen Standpunkten der Fraktionsmitglieder. Hierfür ist es notwendig, dass die Fraktion sich regelmäßig trifft und die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse vorbereitet. Dazu ist es notwendig, das die Fraktion Räume anmietet, in denen sie tagen kann. Da sich nur einzelne Mitglieder jeweils mit einem Themenbereich befassen, ist ein hoher Bedarf an Organisation und Koordination der Fraktionsarbeit gegeben. Hierfür ist bei einer entsprechenden Größe der Gemeinde eine Geschäftsstelle der Fraktionen zweckmäßig, die sachlich und personell ausgestattet werden muss.
Zu den sogenannten laufenden Geschäften der Fraktionsarbeit gehören die Wartung von Büromaschinen, Porto, Telefon, Papier, sonstiges Büromaterial. Auch die Grundausstattung der Geschäftsstellen mit Büromöbeln und Büromaschinen ist zu finanzieren. Hierbei ist aber die Einmaligkeit einer Erstausstattung bei der Einrichtung der Geschäftsstelle zu berücksichtigen, insbesondere bei Fraktionen, die erstmalig im Rat vertreten sind. In der Literatur nicht thematisiert wird die Frage der Rückgabe von Büromöbeln und - material von Fraktionen, die aus der Vertretung ausgeschieden sind. Hier wird wohl ein Rückforderungsrecht der Kommune bestehen.
Der Nordrhein - westfälische Innenminister sieht in seinem Erlass vor, dass zumindest in größeren Städten und großflächigen Gemeinden auch die Finanzierung von Kraftfahrzeugen zulässig ist. Dies wird in der Literatur als verfehlt angesehen34 . Es ist den Fraktionsmitgliedern möglich, auf den städtischen Fuhrpark oder Fahrdienst zurückzugreifen. Zusätzlich hat das einzelne Fraktionsmitglied Anspruch auf Erstattung seiner Kosten, wenn es sich um eine Dienst - oder Informationsreise handelt. Verwendungen die darüber und über die allgemeine Aufwandsentschädigung der Vertreter hinausgehen sind ohnehin in einem rechtlichen Grenzbereich anzusiedeln, der zu einer verdeckten Parteienfinanzierung führt35 . Insbesondere das im Erlass genannte Beispiel des Transportes von Materialien legt laut Meyer den Verdacht nahe, dass es sich hierbei um einen Zweck handelt, der mehr dem Interesse der Parteien als der Gemeinde dient. Eine Unterhaltung von Fahrzeugen durch die Fraktionen und deren Bezuschussung durch die Kommune ist daher abzulehnen.
Bei der Beschaffung von Literatur und Zeitschriften durch die Fraktionen soll es sich um eine Grundausstattung handeln. Wobei das Argument, mit dem der Innenminister von NRW dies zulässt, nicht sehr stichhaltig ist. Dem Problem, dass sich die Fraktionsarbeit außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung abspielt, kann auf pragmatische weise begegnet werden, indem die Fraktionen mittels Zweitschlüssel Zugang erhalten36 . Daher ist zunächst, wenn möglich, von den Fraktionen zu erwarten, dass sie die Verwaltungsbibliothek oder öffentliche Büchereien aufsuchen, bevor sie eine eigene parallel aufbauen. Dennoch ist davon auszugehen, dass auch Verwaltungen nicht über jedes Buch verfügen und jede Zeitschrift abonniert haben. Den Fraktionen muss daher zugebilligt werden, dass sie sich einen eigen Handbibliothek aufbauen, dabei kann auch der politischen Richtung der jeweiligen Fraktion Rechnung getragen werden.37
Zur Durchführung der Fraktionsarbeit bedarf es einer gewissen Anzahl an Personal. Zunächst einmal ist die Bestellung eines Geschäftsführers der Fraktion sinnvoll, damit eine Person die Koordination der laufenden Geschäfte übernimmt und dafür verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus ist für den Betrieb einer Fraktionsgeschäftsstelle notwendig, dass es eine angemessene Zahl von Schreib - und Bürokräften gibt. In der Regel sind diese Aufgaben in Form einer Nebentätigkeit zu erledigen. Lediglich bei Fraktionen größere Städte kann die Einstellung einer oder mehrerer Hauptamtlicher sein.
Problematisch ist hingegen die Beschäftigung von Fraktionsassistenten für einzelne Sachbereiche, wie sie der Innenminister in seinem Erlass vorsieht. Das VG Gelsenkirchen hat in seinem Urteil dargelegt, dass es nicht zu den Aufgaben einer Fraktion gehört, eine Gegenverwaltung aufzubauen. Die Finanzierung von Personal, dass die Fraktionen als Gutachter berät, oder eigene Gegenvorschläge zu den durch die Verwaltung erarbeiteten Vorlagen unterbreitet. Dies würde auch dem Charakter der Fraktion als Teil der Vertretung widersprechen. Denn die Verwaltung ist verpflichtet, die Fraktionen objektiv zu informieren und ihre Anregungen und Vorschläge aufzunehmen.
Doch schon in seinem Urteil stellt das Gericht Überlegungen an, die gegen ein solches Verfahren sprechen könnten. Denn es ist in der Praxis festzustellen, dass sich in der Vertretung sehr oft eine von der Mehrheitsfraktion getragene Ansicht als ,,Verwaltungsmeinung" herausbildet. Für die Minderheit in der Vertretung ist es dann sehr schwierig, ohne eigenen Sachverstand gegen diese zu argumentieren und eigene Vorstellungen in den Vertretungen einzubringen. Wie diesem Zwiespalt begegnet werden kann ist nicht erkennbar, der vom Gericht angesprochene Klageweg ist nicht nur sehr aufwendig, sondern er ist nur gangbar, wenn die Verwaltung gegen Rechte der Minderheit verstößt. Dies ist aber bei einer Ablehnung von Anträgen in der Vertretung nicht der Fall. In der Literatur wird dieses Dilemma ebenfalls gesehen. Eine Übersicht bietet Meyer, der im Ergebnis zwar ablehnend gegenüber den Fraktionsassistenten steht, jedoch den Kern des Zwiespaltes deutlich macht: eigentlich ist es die Aufgabe der Fraktionen, ungeachtet der Mehrheitsverhältnisse mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Da dies jedoch nicht gewährleistet ist, wäre es eigentlich notwendig, dass die Fraktionen sich durch Sachkundige Mitarbeiter verstärken. Doch dabei besteht die Gefahr, dass die Ehrenamtlichkeit der Kommunalvertretung verloren geht. Es handelt sich hierbei wohl weniger um ein rein rechtliches Problem, sondern um eine kommunalverfassungspolitische Fragestellung. Durch die faktische Unmöglichkeit der Vertreter, die Kontrolle der Verwaltung zu gewährleisten und diese zu führen, haben sich viele Ratsmitglieder darauf zurückgezogen, Kleinigkeiten zu bearbeiten, die eine sichtbare und nachvollziehbare Wirkung für die Wähler erzielen. Die Vertreter sind nicht bereit, langfristige politische Leitentscheidungen vorzubereiten oder auszuarbeiten. Wenn man nun in noch größerem Umfang die Beschäftigung von professionellen Beratern und Mitarbeitern der Fraktionen zuließe, würde dieser Prozess weiter verstärkt. Fraglich ist auch, ob es zulässig ist, die Vertreter wie Parlamentarier auf höheren Ebenen zu behandeln und zu Berufspolitikern zu machen. Nur wenn die Vertretungen in den Kommunen wie ein Parlament zu sehen wären, stünde ihnen auch ein solches Recht zu. Es handelt sich in der Kommune aber eben nicht um verschiedene Ebenen, der Begriff der Gewaltenteilung ist nicht anwendbar. Das ergibt sich auch aus Artikel 28 Abs. 2 GG, der die Tätigkeit der Vertretung vor Ort auf die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben beschränkt38 . Vielmehr ist die Vertretung Teil der Verwaltung, gerade das Zusammenspiel von Laien und hauptamtlicher Verwaltung das Merkmal der kommunalen Entscheidungsfindung.
Es ist daher nicht zulässig, dass die Zuwendungen der Kommune für Mitarbeiter der Fraktionen verwendet werden, die dauerhaft mit der Erarbeitung von Anträgen und der inhaltlichen Aufarbeitung von Verwaltungsvorlage beschäftigt sind. Vielmehr muss es darum gehen, die Mitglieder der Vertretung an sich fortzubilden und in Einzelfällen von externen Sachverständigen beraten zu lassen.
Die Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen der Parteien sind zuwendungsfähig, da diese eine Beratung der Fraktionen durchführen. Der Beitrag muss dabei aber im Verhältnis zu der erbrachten Leistung stehen39 . Eine kritische Meinung vertritt hingegen Meyer40 , der die Tätigkeit der kommunalpolitischen Vereinigungen im Bereich der Parteiarbeit ansiedelt eine verdeckte Parteienfinanzierung aber nicht als gegeben sieht. Außerdem macht er darauf aufmerksam, dass die Fraktionen von freien Wählergruppen und kleineren Parteien benachteiligt werden, wenn sie nicht oder nicht im gleichen Umfang wie die großen Parteien CDU/CSU und SPD auf eine solche Vereinigung zurückgreifen können.
Ein weiterer Aspekt der Bezuschussung ist die Durchführung von Fraktionssitzungen. Hierbei ist zum einen die Bewirtung von Gästen gemeint, aber auch die Aufwendung für die Hinzuziehung von externen Sachverständigen und Referenten. Wie bereits oben ausgeführt, sind die Fraktionen bei der Vorbereitung der Sitzungen und der Erarbeitung eigener Vorschläge auf Beratung von Experten angewiesen. Dabei kann es vorkommen, dass es nicht möglich oder zweckmäßig ist, auf die Verwaltung zurückzugreifen. So beispielsweise bei der Untersuchung von Missständen in der Verwaltung, bei der Beratung besonders spezieller Probleme oder eben bei der Entwicklung von Alternativen zur herrschenden Verwaltungsmeinung41 . Diesen Aspekten trägt Meyer in seiner ablehnenden Äußerung nicht Rechnung42 .
Zulässig ist auch die Finanzierung von Reisen von Fraktionsmitgliedern, wenn diese der Vorbereitung von Initiativen in der Vertretung dienen. Auch das Tagen an anderen Orten als dem der Vertretung ist hiervon abgedeckt, wenn ein besonderer Anlass gegeben ist, wie Haushaltsberatungen43 oder Klausurtagungen zu Vorbereitung grundlegender Planungen der Körperschaft. Auch Besichtigungsfahrten sind zulässig44 . Gerechtfertigt wird dies durch die Möglichkeit, auf diesem Wege konzentrierter arbeiten zu können45 , die darauf zurückzuführenden Vorteile rechtfertigen die höheren Kosten, da sie der Gemeinde insgesamt dienen.
Die Fortbildung der Fraktionsmitglieder ist grundsätzlich zulässig. Auch wenn das VG Gelsenkirchen die Aufgabe der Fortbildung bei der Vertretung insgesamt ansiedelt und den Fraktionen damit einen Anspruch auf Zuwendung verweigert, dient die Fortbildung von einzelnen Vertretern der Arbeit der Vertretung. Der Innenminister führt in seinem Erlass aus, dass es ja gerade die Funktion der Fraktionen ist, dem Rat die Arbeit zu erleichtern. Die selbständige Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für die Fraktionsmitglieder bewegt sich daher im Rahmen der den Fraktionen übertragenen Aufgaben und ist zuwendungsfähig. Fortbildung kann erfolgen durch die Veranstaltung eigener Tagungen und Vortragsveranstaltungen der Fraktion oder durch die Teilnahme an Kongressen, Vorträgen und Seminaren, die einen fachlichen Bezug zur Arbeit der Fraktion im Rahmen ihrer Aufgaben hat.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen wird im Grundsatz anerkannt und gefördert. Dies ist auch deutlich in der GO NW verankert worden: § 56 Abs. 2 S. 1 stellt klar, dass die Fraktionen ihre Auffassungen öffentlich darstellen können. Dies kann geschehen durch Presseerklärungen zu bestimmten Tagesordnungspunkten der Vertretung, durch Pressekonferenzen ( bei denen auch die Bewirtung anerkannt wird ) und durch die Herausgabe von eigenen Publikationen der Fraktion. Strittig ist nur die Grenze der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Neuregelung. Es ist wohl davon auszugehen, dass hier die Grenze wiederum in der verdeckten Finanzierung von Parteien zu sehen ist. Dafür spricht die Formulierung von Oebbecke, der den Fraktionen Öffentlichkeitsarbeit ,,nicht zu den Zwecken parteipolitischer Werbung"46 zubilligt. Dadurch haben die Fraktionen die Möglichkeit, ihre Meinung zu den Belangen der kommunalen Vertretung vorzubringen, insbesondere dann, wenn sie bei einer Abstimmung unterlegen sind, oder neue Aspekte in die Arbeit einbringen wollen.
Die von Teilen der Literatur und in der Rechtsprechung47 vertretene Auffassung, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen nicht zu den Aufgaben im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Vertretung gehört, weil sie der Gemeinde nicht dient, kommt in NRW so nicht mehr zum tragen.
2. Unzulässige Verwendungen
Der Ersatz von Aufwendungen für Fraktionssitzungen am Ort der Vertretung ist kein
zulässiger Zweck für Zahlungen aus dem Gemeindehaushalt. Die Fraktionsmitglieder erhalten für diese Aufwendungen bereits mit der Zahlung einer Aufwandsentschädigung und der Gewährung von Fahrtkostenerstattungen einen angemessenen Ausgleich.
Für Verfügungsmittel des Fraktionsvorsitzenden besteht kein Anspruch auf die Finanzierung aus den Mitteln der Fraktion, da der Fraktionsvorsitzende bereits einen erhöhten Aufwandsersatz erhält48 .
Zusätzliche Zuwendungen an stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen sind nicht zulässig49 .
Auch die Kosten von Arbeitsessen der Fraktionsvorsitzenden sind bereits mit der erhöhten Aufwandsentschädigung abgegolten.
Bei den Fahrtkosten, die durch die Rückkehr von Kuren oder aus dem Urlaub zu einer
Fraktionssitzung entstehen kann kein Zuschuss aus der Fraktionskasse gewährt werden. Denn es handelt sich um eine Dienstreise, bei der die Kosten, wenn eine Genehmigung des Rates vorliegt, direkt mit der Gemeinde abgerechnet werden.
Aufgrund der engen Bindung an eine politische Partei ist die Teilnahme an Parteitagen und - kongressen nicht zuwendungsfähig. Bei der Teilnahme an Veranstaltung wie Vorträgen, Seminaren oder Kongressen, von Parteigliederungen die nicht regelmäßig Fortbildung betreiben ist dies ähnlich zu bewerten. Als nicht unter diese Formulierung fallend sind Parteistiftungen oder kommunalpolitische Vereinigungen zu sehen, deren Aufgabe ja schwerpunktmäßig im Bereich der Fort - und Weiterbildung liegt.
Bei der Durchführung von Bildungsreisen durch die Fraktionen fehlt es an einem konkreten Bezug zu den Fraktionsaufgaben, eine Mittelzuwendung ist für diesen Zweck nicht zulässig.
Auch bei der Vergabe von Spenden an Vereine oder Institutionen vor Ort handelt es sich nicht um eine Aufgabe, die von den Fraktionen wahrgenommen werden darf. Hierbei ist vielmehr das Interesse der hinter den Fraktionen stehenden politischen Parteien gegeben, die in der Öffentlichkeit auf diese Weise für sich werben wollen. Die Grenze zur Parteitätigkeit würde dadurch überschritten50 .
3. Maßstäbe für die Höhe der Zuwendung
Die Fraktionen sind Teil der Gemeindevertretung. Daher unterliegen sie auch den
Grundsätzen des öffentlichen Haushaltsrechtes, wirtschaftlich und sparsam zu handeln51 .
Daraus ergibt sich, dass der von den Fraktionen betriebene Aufwand in vertretbarer Relation zum Arbeitsumfang in der Gemeindevertretung stehen52 . Dabei kann die Größe der Gemeinde als Maßstab herangezogen werden.
Dem Gebot der Sparsamkeit folgend, sollen die Fraktionen versuchen, die in der Gemeinde und der Verwaltung vorhandenen Einrichtungen und Sachmittel zu nutzen. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei der Zuwendung an die Fraktionen um einen nachträglichen Zuschuss aus den Haushaltsmitteln der Gemeinde handelt. Es ist daher zwingend geboten, dass die Verwaltung den Bedarf der Fraktionen ermittelt. Die Aufwendungen zur Geschäftsführung müssen daher ihrer Art nach festgelegt werden, hierbei ist darauf zu achten, dass nur die zulässigen Aufwendungen herangezogen werden. Es ist dabei zulässig, sogar unverzichtbar, dass die Hauptverwaltungsbeamten bei Prüfung einen Vergleich mit den bereits in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen anstellen. Wenn der Umfang der Zuwendungen ermittelt worden ist, entscheidet die Verwaltung, in welcher Form diese bezuschusst werden sollen. Dies kann in Form von Sachleistungen, des zur Verfügungstellens von Personal oder durch Geldzahlungen erfolgen. Wie eine solche Verteilung in der Praxis aussieht ist einem Handbuch der KPV der CDU zu entnehmen, in der das Beispiel der Stadt Köln erläutert wird53 . Die Fraktionen erhalten finanzielle Zuwendungen in Höhe von 1.459.000 DM ( SPD ), 1.148.000 DM ( CDU ) und 555.000 DM ( Grüne ). Zusätzlich werden den Fraktionen Räume für die Geschäftsstelle zu Verfügung gestellt, sie erhalten Personal als Fahrer von Dienstwagen, die ebenfalls bereitgestellt werden. Auch Fraktionsassistenten werden von der Verwaltung gestellt. Büromöbel und - maschinen werden den Fraktionen überlassen, die laufenden Kosten der Geschäftsstellen wie Heizung, Reinigung und Beleuchtung werden übernommen. Auch die Kosten für Telefon und Porto trägt die Kommune.
4. Verteilung auf die Fraktionen
Für die Zuwendungen an die Fraktionen hat der Rat der Stadt Köln einen Schlüssel verabschiedet, der jeder Fraktion im Monat eine Pro - Kopf - Zuweisung von 2820 DM gewährt. Auch für die Geldwerten Leistungen der Verwaltung wird auf einen an der Größe der Fraktionen orientierter Schlüssel herangezogen. Bei der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist der Grundsatz der Gleichbehandlung zu befolgen. Der Schlüssel zu Verteilung muss berücksichtigen, dass der Grundbedarf kleinerer Fraktionen nicht proportional zur Zahl ihrer Mitglieder ist. Daher ist eine Kombination aus Grundzuschuss und Pro - Kopf - Zuschuss zweckmäßig. Diese Vorabgewährung von Zuwendungen ist für die Planungssicherheit der Fraktionen und aus Gründen der Praktikabilität zu wählen. Ein solches Verfahren ist grundsätzlich zulässig, macht es aber nicht überflüssig, dass eine Nachprüfung der tatsächlichen Kosten der Fraktionen stattfindet54 .
Dies geschieht auf der Grundlage des Verwendungsnachweises55 , den die Vorsitzenden der Fraktionen dem Hauptverwaltungsbeamten gegenüber abgeben müssen. Dieser erfolgt schriftlich und soll die Ausgaben und Einnahmen der Fraktion summarisch darstellen56 .
5. Kontrolle der Mittelverwendung
Der Umfang des Verwendungsnachweises spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Mittelzuwendung. Die Notwendigkeit einer lückenlosen und strengen Kontrolle der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus der Überlegung, dass die Fraktionen in eigener Sache entscheiden, wenn sie die Mittelzuwendungen der Kommune beschließen. Wird die Verwendung der Haushaltsmittel der Kommunen, die teilweise eine beträchtliche Höhe erreicht haben wie das Beispiel Köln zeigt, nicht öffentlich erklärt, entsteht schnell der Eindruck der Selbstbedienung der Fraktionen und der hinter ihnen stehenden Parteien57 . Darauf hat der Gesetzgeber in NRW reagiert und in der GO festgelegt, dass die Zuwendungen an die Fraktionen im Haushaltsplan als gesonderte Anlage nachzuweisen sind58 . Eine öffentliche Kontrolle durch Ausweisung im Haushaltsplan ist somit gegeben59 . Da aber eine solche Darstellung nur kursorisch sein kann, oder ansonsten für den Bürger nicht mehr überschaubar ist, muss eine übergeordnete Kontrolle der Verwendungen gewährleistet sein. Laut Gesetz ist die Kontrollinstanz die Überprüfung der Mittelverwendung der Hauptverwaltungsbeamte60 . Es wird in der Literatur auch eine mögliche Zuständigkeit der Rechnungsprüfungsämter der Gebietskörperschaften gesehen. Dies ist bei den Schwierigkeiten der Kontrolle durch den Hauptverwaltungsbeamten, insbesondere wenn dieser als hauptamtlicher Bürgermeister fungiert, durchaus eine überlegenswerte Sache. Denn nach der neuen GO NW wird der Bürgermeister direkt vom Gemeindevolk gewählt und ist zugleich Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Rates. Er ist somit voll dem Spannungsfeld zwischen der politischen Parteienlandschaft und der unparteiischen Ausübung des ihm übertragenen Amtes. Wenn er die Kontrollen zu lax handhabt, wird er von der Bevölkerung dafür kritisiert und riskiert, dass er die erneute Wahl zum Bürgermeister verliert.
Zieht er aber die Zügel zu straff an, wird ihm von Seiten der Fraktionen und der Parteien vorgeworfen, er versuche ein Exempel zu statuieren und sich auf Kosten der sachlichen Arbeit der Vertretung zu profilieren. Also wird er im Normalfall die Verwendungsnachweise entgegennehmen und zu den Akten legen. Widerstand bei der Fraktionen wird er dabei kaum finden, da diese die von ihnen festgelegten Vorabzahlungen wahrscheinlich einhalten. Eine Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsamtes ist zwar zu bejahen, aber da es dem Rat unterstellt ist, und eigentlich die verwaltungsinterne Prüfung durchführen soll, ist ein solches Verfahren nicht erfolgversprechend61 .
Daher stellt sich die Frage einer überörtlichen Kontrollmöglichkeit. Diese erfolgt durch die Gemeindeprüfungsämter der Regierungspräsidenten und der Landkreise. Da es sich dabei aber um eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle handelt, kann ein Eingriff in den Ermessensbereich der Kommunen nicht erfolgen. Da sich die Entscheidung über den Umfang und die Art der gewährten Zuwendungen im Ermessen der Gemeinde bewegen ist eine unmittelbare Überprüfung nicht möglich62 . Es ist lediglich zu erwarten, dass sich die Prüfungsämter die Rechnungen und Belege der Jahresabrechnung der Fraktionen ansehen und prüfen ob diese ordnungsgemäß sind.
Es bleibt also festzuhalten, dass die gängige Praxis der Kontrolle der Mittelverwendung nicht zum Ziel einer nachvollziehbaren Finanzierung der Fraktionen beiträgt.
E. Probleme und Perspektiven der kommunalen Fraktionen
Ein Kernproblem der Fraktionen im kommunalen Bereich ist der Umgang mit den zunehmend komplexer werdenden Zusammenhängen in der Arbeit vor Ort. Das Stichwort lautet hier Professionalisierung Kontra Ehrenamt. Es ist erkennbar, das die Möglichkeiten ehrenamtlich tätiger Ratsmitglieder, Einfluss auf die grundlegenden Entscheidungen der Gemeindeverwaltung zu nehmen mehr und mehr beschränkt sind. Teilweise ist dies zurückzuführen auf die Zuständigkeiten der Gemeindevertretungen, die immer weiter ausgedehnt wurden. Da dies in der Regel unter Mithilfe und auf ausdrücklichen Wunsch der Vertreter geschehen ist, haben sie es in der Hand, dies wieder zurückzunehmen. Darüber hinaus ist aber eine verstärkte Professionalität von den Vertretern zu erwarten. Dies stellt die Fraktionen vor die Aufgabe, ihre Mitglieder entsprechend zu schulen und schon vor der Aufstellung zu den Wahlen des Gemeinderates auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Hierfür benötigen sie die entsprechenden Mittel, und die notwendige Rechtssicherheit, dass sie diese auch erhalten. Es ist daher unumgänglich, dass der Gesetzgeber die Streitigkeiten über den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben der Fraktionen regelt, indem er einen festumrissenen Aufgabenkatalog für die Fraktionen festlegt.
Damit in unmittelbarem Zusammenhang steht die Frage der Kontrolle der Zuwendungen an die Fraktionen. Es ist im Interesse der Öffentlichkeit und auch im öffentlichen Interesse, wenn die Bürger auf die rechtmäßige und sparsame Verwendung ihrer Steuergelder vertrauen können. Daher ist es sinnvoll, eine Kontrollbefugnis für eine übergeordnete Instanz zu schaffen, wie dies in Schleswig - Holstein und Rheinland - Pfalz der Fall ist.
Swen Schütz
[...]
1 § 30 Abs. 7 S. 6 und 7 GO NW a. F.
2 § 5 Abs. 3 BezVG.
3 Artikel I § 40 KV Bbg.
4 § 36 a Abs.4 GO Hessen.
5 § 23 Abs. 5 KV MV.
6 § 39 b GO Nds.
7 § 30 a GO RP.
8 § 30 Abs. 5 KSVG Sa.
9 § 43 GO Sanh.
10 § 32 a GO SH.
11 § 25 KO Thür.
12 z.B. § 30a GO RP; § 39b GO Nds.
13 Holzl/Hien, Anm. zu Art. 33 Abs.1 GO Bay.
14 §10 Abs. 1 S. 1. GOBT
15 Stober, §15 VII 1. S. 212.
16 Banken, S. 318.
17 §10 Abs.1 GOBT
18 z. B. §46 Abs. 2 AbgG (Klagerecht); §12 GOBT (Anteilige Berücksichtigung der Fraktionen).
19 Art. 1 §40 Abs. 1 S. 2 KV Bbg.; §23 Abs. 5 S. 2 KV MV;§39b Abs. 1 S. 1 GO Nds.; §56 Abs. 1 S. 1 GO NW; §30a Abs. 1 S. 2 GO RP; §30 Abs. 5 s. 2 KSVG Sa.; §43 S. 3 GO Sanh.; §32a V S. 1 GO SH.
20 §55 Abs. 4 S. 1 GO NW.
21 BVerfGE 20, 55, 104.
22 Meyer, S. 396.
23 OVG Münster, Mitteilungen NWStGB 1975 S. 192.
24 Heugel, S. 396.
25 VG Gelsenkirchen, NWVBL 1987, S. 53 ff. (58).
26 §30 Abs. 7 S. 6 GO NW a.F..
27 §36a Abs. 4 GO He..,§23 Abs.5 S. 5 KV MV, §39b Abs. 3 GO Nds..
28 VGH Kassel, NVwZ - RR 1996, S. 105 (106).
29 Oebbecke, S. 707.
30 VG Gelsenkirchen, NWVBL 1987, S. 53 ff..
31 VG Gelsenkirchen, Anmerkungen von Bick, NWVBL 1987, S. 58 f.
32 EildienstStNW 1989, S.36 ff..
33 Meyer, S. 402.
34 Meyer, S. 404, Banken, S. 320, KvRP, Anm. zu §30a Nr. 6.6.3.3..
35 Meyer, S. 404.
36 Meyer, S. 404.
37 Banken, S. 320.
38 Meyer, S. 399.
39 Banken, S. 320.
40 Meyer, S. 405.
41 Banken, S. 320 f..
42 Meyer, S. 407 ff..
43 Erlaß Innenministerium, Nr. 4.172, a.a.O..
44 Meyer, S. 406.
45 Banken, S. 320.
46 Oebbecke, S. 707.
47 OVG NW, DVBl. 1993, S212 (213).
48 §3 Abs. 1 c, d EntschVO.
49 §3 Abs. 1 e EntschVO.
50 Meyer, S. 413.
51 §75 Abs. 2 GO NW.
52 Meyer, S. 400.
53 Kleerbaum, S. 112 ff..
54 VG Gelsenkirchen, a.a.O. S. 55.
55 §56 Abs. 3 S. 3 GO NW.
56 Bick, S. 124.
57 Banken. S. 323.
58 §56 Abs. 3 S. 2 GO NW.
59 Oebbecke, S. 707.
60 §56 Abs. 3 S. 3 GO NW
61 Bick, S. 127.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Abhandlung über kommunale Fraktionen in NRW?
Diese Abhandlung untersucht die rechtlichen Grundlagen, Aufgaben und Funktionen kommunaler Fraktionen in Nordrhein-Westfalen (NRW), insbesondere im Hinblick auf die Mittelzuwendung und deren Verwendung. Sie analysiert die entsprechenden Gesetze, Gerichtsurteile und Verwaltungserlasse, um Probleme und Perspektiven aufzuzeigen.
Welche gesetzliche Grundlage gibt es für die Mittelzuwendung an Fraktionen in NRW?
§ 56 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung (GO) NRW verankert einen Anspruch der Ratsfraktionen auf Mittelzuwendung durch die Kommunen. Diese Regelung wurde im Zuge der Kommunalreform 1994 eingeführt.
Welche Aufgabe haben Fraktionen im Kommunalrecht?
Die Hauptaufgabe von Fraktionen ist es, die Meinungsbildung im Rat zu erleichtern, die Vorstellungen der Parteien einzubringen und die Mitglieder des Rates zu entlasten.
Welche Rolle spielt die Mindestgröße von Fraktionen?
Die Festlegung einer Mindestgröße der Fraktionen soll den Organisationsaufwand des Rates gering halten und den Ablauf der Verfahren vereinfachen. Dies wird durch die Bezugnahme auf die Regelungen im Bundestag erläutert. Eine zu große Anzahl von Kleinstfraktionen würde die Arbeit der Verwaltung durch aussichtslose Anträge beeinträchtigen und den Mittelbedarf für die Grundausstattung der Fraktionen erhöhen.
Wie werden die Mittel an die kommunalen Fraktionen verteilt?
Grundlage ist in der Regel ein Verteilungsschlüssel, der einen Sockelbetrag pro Fraktion und einen Zuschuss pro Kopf vorsieht. Dabei wird auch ein Grundbedarf für die Geschäftsführung berücksichtigt.
Welche Verwendungen der Mittel sind zulässig?
Zulässige Verwendungen sind beispielsweise das Anmieten von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle, die Wartung von Büromaschinen, die Beschaffung von Büromaterial, die Grundausstattung der Geschäftsstelle, die Finanzierung von Personal (Geschäftsführer, Schreibkräfte) und die Beschaffung von Literatur und Zeitschriften. Auch Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen der Parteien, die Durchführung von Fraktionssitzungen und die Fortbildung der Fraktionsmitglieder sind grundsätzlich zulässig.
Welche Verwendungen der Mittel sind unzulässig?
Unzulässige Verwendungen sind beispielsweise der Ersatz von Aufwendungen für Fraktionssitzungen am Ort der Vertretung, Verfügungsmittel des Fraktionsvorsitzenden, zusätzliche Zuwendungen an stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Kosten von Arbeitsessen der Fraktionsvorsitzenden, Fahrtkosten für die Rückkehr von Kuren oder aus dem Urlaub, die Teilnahme an Parteitagen, Bildungsreisen und Spenden an Vereine oder Institutionen vor Ort.
Wie wird die Mittelverwendung kontrolliert?
Die Mittelverwendung wird durch den Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) kontrolliert. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind im Haushaltsplan als gesonderte Anlage nachzuweisen. Die Fraktionen müssen einen Verwendungsnachweis abgeben.
Welche Probleme gibt es bei der Kontrolle der Mittelverwendung?
Die gängige Praxis der Kontrolle der Mittelverwendung trägt nicht zum Ziel einer nachvollziehbaren Finanzierung der Fraktionen bei. Es wird eine überörtliche Kontrollmöglichkeit durch eine übergeordnete Instanz gefordert.
Was ist ein Kernproblem der Fraktionen im kommunalen Bereich?
Ein Kernproblem ist der Umgang mit den zunehmend komplexer werdenden Zusammenhängen in der Arbeit vor Ort, das Stichwort lautet Professionalisierung Kontra Ehrenamt. Es wird eine verstärkte Professionalität der Vertreter erwartet, was die Fraktionen vor die Aufgabe stellt, ihre Mitglieder entsprechend zu schulen und schon vor der Aufstellung zu den Wahlen des Gemeinderates auf ihre Aufgaben vorzubereiten.
Was sind die Perspektiven der kommunalen Fraktionen?
Es wird gefordert, dass der Gesetzgeber die Streitigkeiten über den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben der Fraktionen regelt, indem er einen festumrissenen Aufgabenkatalog für die Fraktionen festlegt. Außerdem wird eine Kontrollbefugnis für eine übergeordnete Instanz gefordert, wie dies in Schleswig - Holstein und Rheinland - Pfalz der Fall ist.
- Quote paper
- Swen Schütz (Author), 1999, Der Anspruch von Ratsfraktionen auf eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln und die Grenzen der Mittelverwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97409