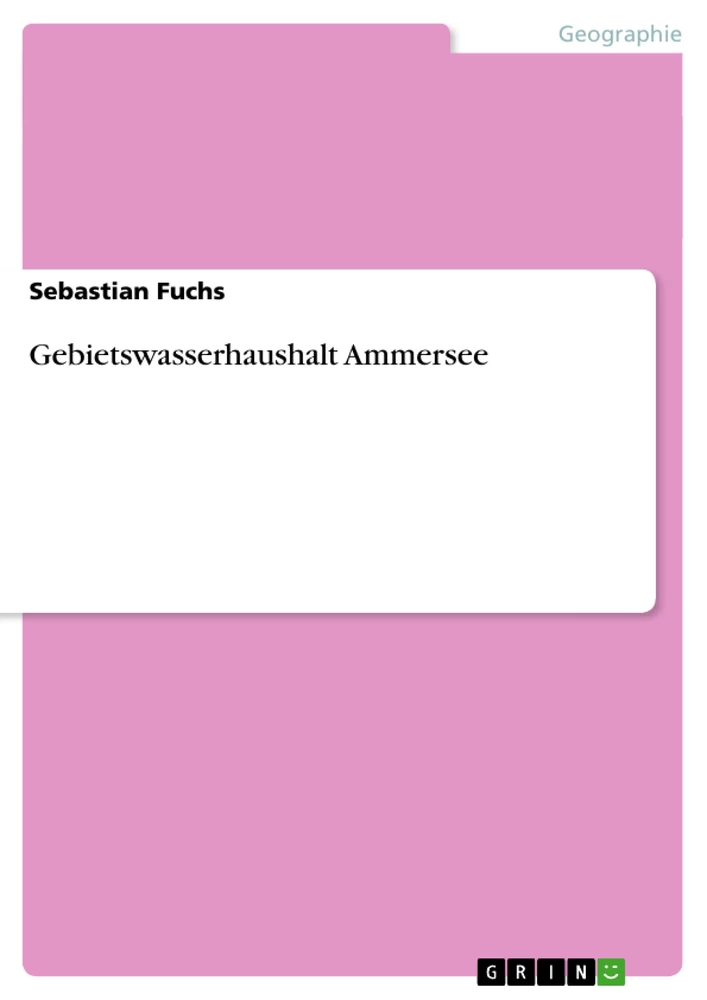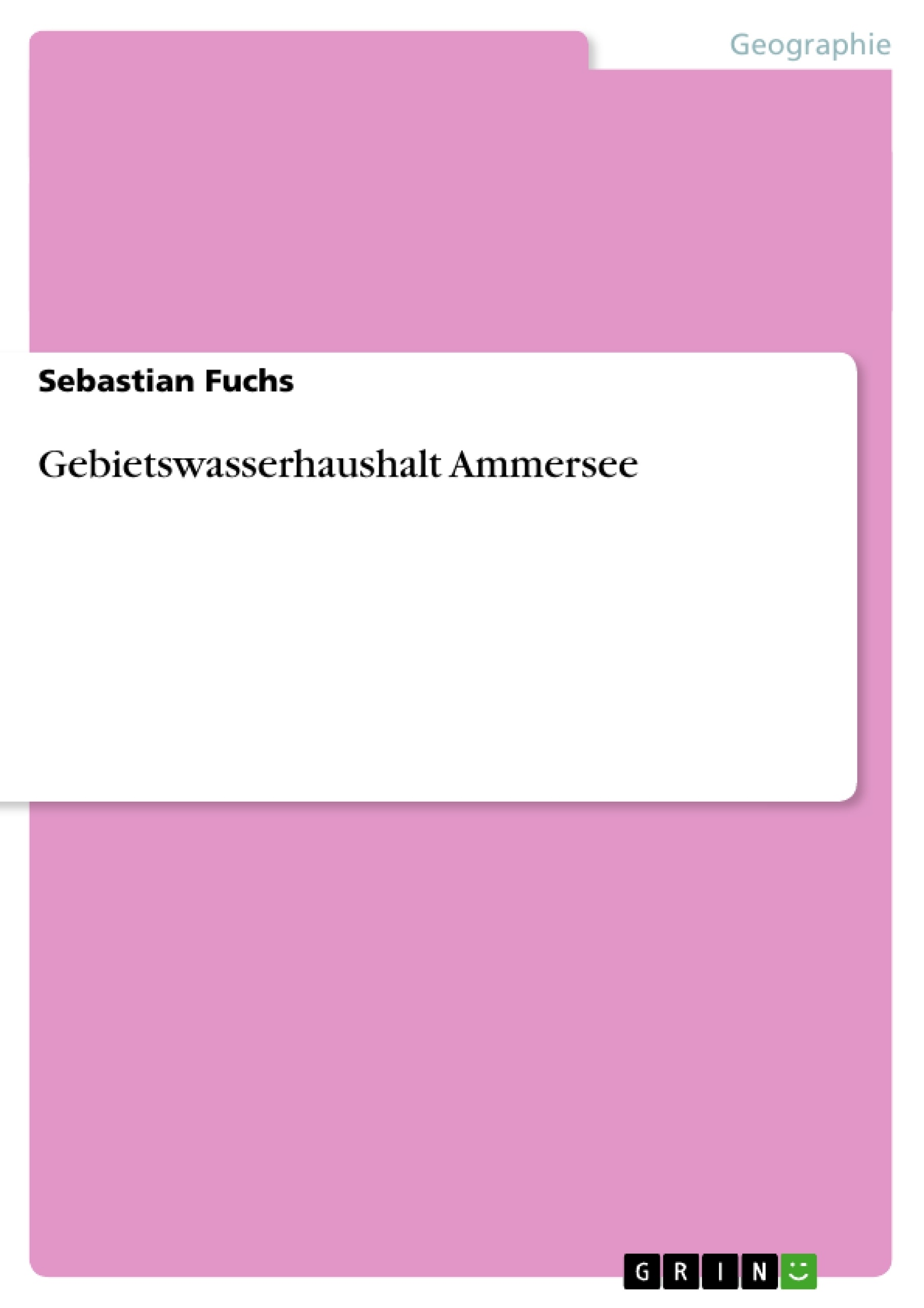Gliederung:
1. Genese
2. Allgemeine Kenndaten und großräumliche, administrative Einordnung
3. Einflußfaktoren auf den Gebietswasserhaushalt des Ammersees
a) Geologische und geographische Verhältnisse im Einzugsgebiet
b) Hydrologische Verhältnisse
c) Wärme - Stoff - Haushalt des Ammersees
c) Chemisch - physikalische Verhältnisse
a) Biologische Verhältnisse
d) Anthropogene Einflußfaktoren und wasserwirtschaftliche Nutzung
4. Bewertung und Auswirkung der Einflußfaktoren
1. Genese:
Das Seebecken des Ammersees wurde als typischer Zungenbeckensee in der Würmeiszeit, (139000v.H. bis 15000v.H.) vom Ammersee - Teilgletscher des Isar - Loisach - Gletschers geformt. Die riesige Exarationskraft der mächtigen Gletscherzunge ließ nach dem Rückzug und Abtauen der Gletscher ein Zungenbecken zurück, welches eine Länge von ca. 37 km (von Grafrath im Norden bis südlich von Weilheim) hatte. Das Zweigbecken des Pilsensees war noch ein Teil des Sees, schätzungsweise lag der Wasserspiegel damals mindestens 25 Meter über dem heutigen Niveau. Die Ablagerungen der Zuflüsse, vor allem der Amper im Süden, sowie der Windach im Norden und der Endmoränendurchbruch der Amper bei Grafrath ließen ihn auf das heutige Niveau absinken. Die Verlandung dauert an, die erwartete ,,Lebensdauer" wird mit rund 20000 Jahren beziffert.
2. Allgemeine Kenndaten und größräumliche, administrative Einordnung:
Der Ammersee ist heute Bayerns drittgrößter See, der am weitesten nach Norden reichende Alpenvorlandsee. Administrativ läßt er sich dem Regierungsbezirk Oberbayern zuordnen. Das Westufer ist Teil des Landkreises Landsberg am Lech, das Ostufer ist dem Landkreis Starnberg zuzuordnen. Die Ammer im Süden bzw. die Amper im Norden bilden die Grenze.
Abb. 1: Allgemeine Kenndaten des Ammersees:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Einflußfaktoren auf den Gebietswasserhaushalt:
a) Geologische und geographische Verhältnisse im Einzugsgebiet:
Die im Untergrund anstehenden Flinzschichten bzw. tonigen Moränen bilden den Grundwasserstauer für das in den Boden einsickerde Niederschlagswasser. Als Grundwasserleiter dienen die sandig, kiesigen Schichten, in diesen fließt das Grundwasser, dem Relief folgend in Richtung des Sees ab. Das Einzugsgebiet mit einer Größe von annähernd 1000 km^2 weist ein äußerst ausgeprägtes Relief auf. Die Quelle der Ammer entspringt in den nördlichen Kalkalpen (Ammergebirge) auf knapp 2000 m ü. NN. Über Oberammergau kommend durchfließt sie nach Peißenberg den ehemaligen Seegrund, bei Fischen fließt sie bei 533 m ü. NN in den Ammersee. Das Seebecken erstreckt sich, umgrenzt von den Jungmoranenwällen des Wessobrunner Höhenrückens im Westen bzw. des Andechser Höhenrückens im Osten in Nord - Süd - Richtung im Ammertal nördlich von Weilheim. Die Nord- und Südufer gehen über in zahlreiche Verlandungsmoore, geschaffen durch die Ablagerungen der Ammer im Süden, sowie der Windach im Norden. Die großklimatischen Bedingungen entsprechen im großen und ganzen denen der bayerisch - schwäbischen Hochebene, die innerhalb Deutschlands zu den meeresfernsten Regionen zählt. Daraus resultiert ein durch kontinentale Einflüsse leicht abgewandeltes Klima der mittleren Breiten. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei ca. 8° C, mit zunehmender Höhe in den Alpen sinken die Temperaturen. Starken Einfluß vor allem auf die Bewölkung und den Niederschlag haben die Alpen. Die Staufunktion der Alpen hat zur Folge, daß die mittleren Niederschlagssummen mit der geringer werdenden Distanz zu den Alpen zunehmen. Am Ammersee selbst erreichen die mittleren Niederschlagssummen 800 mm, im oberen Einzugsgebiet, bei Oberammergau sind aber bis zu 1500 mm mittlere Niedersschlagssummen anzutreffen. Eine Sonderstellung nimmt der Föhn ein, am häufigsten tritt er zwischen Oktober und Februar auf. Der Gebirgsföhn kommt als Fallwind von den Alpen und bringt trockene und relativ warme Luft aus dem Mittelmeerraum heran. Tagestemperaturen im Januar von bis zu +20 °C sind keine Seltenheit.
Große Teile des Einzugsgebietes lassen sich als naturnahe Bereiche erkennen. Der gesamte Uferbereich des Sees ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Des weiteren sind eine Vielzahl von Naturschutzgebieten, am Oberlauf der Ammer, sowie in einigen Uferregionen des Ammersees anzutreffen. Als bedeutendstes kann dabei das südliche Verlandungsmoor herausgestellt werden. 1979 wurde dieser Bereich als Vogelfreistätte unter Naturschutz gestellt, um neben der Bewahrung der Flora und Fauna in diesem Gebiet auch den Zugvögeln im bedeutenden Rastgebiet des Ammersees einen ungestörten Lebensraum zu erhalten. In den Siedlungsbereichen sind jedoch diese Natur- und Landschaftsschutzbereiche durch Uferverbauungen und zahlreiche Bootsanlegestellen stark gestört und nicht mehr als naturnah zu erkennen. Außerdem trifft man im gesamten Einzugsgebiet auf mehr oder weniger intensive landwirtschaftliche Nutzung, und den damit verbundenen gesteigerten Eintrag von Phosphat und Stickstoff ins Gewässersystem. Am Oberlauf der Ammer sind vereinzelt Industriebetriebe anzutreffen, zum Beispiel Metall- und Milchverarbeitung in Weilheim, oder ein Optikunternehmen in Peißenberg, denen aber keine herausragende, überegionale Bedeutung zukommt.
b) Hydrologische Verhältnisse:
Die Ammer als wichtigster Zufluß entwässert ungefähr ¾ des Einzugsgebietes. Die mittlere Abflußspende beträgt 16,6 m^3/s (Pegel Fischen Jahresreihe 1941/1989). Bei Extremereignissen, wenn beispielsweise die Schneeschmelze von starkem Dauerregen begleitet wird, kann die Abflußspende bis zu 600 m^3/s erreichen. Bei länger anhaltender Trockenheit können dagegen nur weniger als 3 m^3/s Wasserspende den See erreichen. Der Seeausfluß, die Amper hat einen MQ von 21,1 m^3/s, bei einem mittleren Wasserstand des Sees von 140 cm (Pegel Stegen Jahresreihe 1975/1994). Die starke Speicher- und Rückhaltefunktion (Retentionswirkung) des Ammersees unterstreichen die schwach ausgeprägten Niedrigwasserstände (historisches NW: 119cm am 14.08.1994). Der mittlere Hochwasserstand von 195 cm (Pegel Stegen Jahresreihe 1975/1994) kann jedoch bei Extremereignissen weit überschritten (historisches HW: 337cm am 27.5.1999) werden. Dabei verwandeln sich die im Norden und Süden angrenzenden Verlandungszonen in eine weiträumige Überflutungsfläche und stellen so einen äußerst effektiven Hochwasserschutz dar. Vor allem die an der Amper gelegenen Städte profitieren von dieser Retentionsfunktion, da die enormen Hochwasserspitzen der Ammer durch den See stark abgeschwächt werden, und den Ammersee verzögert verlassen.
Abflüsse der Ammer, Wasserstände des Ammersees im langjährigen Beobachtungszeitraum und beim Hochwasser 1999:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c) Wärme - Stoff - Haushalt des Ammersees:
Die sonnen- und windexponierte Lage sowie das ausgeprägte Jahreszeitenklima mit drei Frostmonaten bewirken ein dimiktisches Mischungsverhalten des Ammersees. Typisch hierfür ist die zweimal jährlich wiederkehrende stabile Schichtung im Sommer und im Winter, die mit Phasen der Vollzirkulation des gesamten Wasserkörpers im Frühjahr und im Herbst wechselt.
Jahreszeitlicher Ablauf des dimiktischen Mischungsverhaltens des Ammersees:
Sommer: Es werden regelmäßig Oberflächenwassertemperaturen von über 20° C gemessen. Diese sommerliche, oberflächennahe Erwärmungsschicht des Wassers, das Epilimnion reicht bis ca. 10 m Tiefe. Die Sprungschicht, das Metalimnion ist von einem raschen Temperaturabfall in einem geringmächtigen Bereich gekennzeichnet. Dieser trennt das Epilimnion vom Hypolimnion, dem Bereich des kalten Tiefenwassers. Es beginnt im Ammersee je nach Mächtigkeit des Epilimnions bei ungefähr 15 - 20 m Tiefe. Die Wassertemperatur nimmt hier mit der Tiefe kontinuierlich bis 4° C ab. Dieser Zustand des Wasserkörpers wird als sehr stabile Schichtung, mit einer auf die Sprungschicht konzentrierten Temperaturabnahme bezeichnet.
Herbst: Durch die fallenden Lufttemperaturen und die geringere Sonnenscheindauer kühlt sich das Wasser ab. Wenn nun im gesamten See einheitliche Temperaturwerte von 4°C erreicht werden, ist vor allem bei starkem Wind eine Vollzirkulation, das heißt eine tiefgreifende Umschichtung und Durchmischung des gesamten Wasserkörpers anzutreffen.
Winter: Bei weiterem Abkühlen des Wassers entsteht eine stabile inverse Schichtung, die Temperaturen in der Tiefe sind höher als an der Oberfläche, da das oberflächennah stark abgekühlte Wasser aufgrund seiner geringeren Dichte nicht absinken kann. Frühjahr: Durch die steigenden Temperaturen wird im See wieder eine einheitliche Temperatur von 4°C erreicht, wie im Herbst kommt es zur Vollzirkulation.
d) Chemisch - physikalische Verhältnisse (vgl. auch Abb. 3):
Der Sauerstoffgehalt des Ammersees zeigt den typischen Jahresgang eines mesotrophen Sees. Dieser ist gekennzeichnet durch eine gute Sauerstoffversorgung in der gesamten Wassersäule zu Zeiten der Volldurchmischung, also im Frühjahr und im Herbst. Während den Sommermonaten tritt regelmäßig ein Sauerstoffdefizit im Metalimnion auf, welches jährlich in seiner Ausprägung variiert, sich in den letzten Jahren jedoch deutlich verringert hat. Im Hypolimnion erreicht die Sauerstoffkonzentration den Sättigungswert, dicht über dem Grund fallen die Werte auf 30% Sättigung ab (vgl. Abb. 2).
Die durchschnittliche Phosphorkonzentration lag zwischen 10,1 µg/l (1993) und 50,6 µg/l (1980). Der in Abb. 3 dargestellte Untersuchungzeitraum ist von einem deutlichen, kontinuierlichen Rückgang der Phosphorkonzentration gekennzeichnet. Hieran läßt sich sehr gut die Effizienz der im Einzugsgebiet durchgeführten abwassertechnischen Sanierungsmaßnahmen erkennen. Die somit erreichten Werte lassen ebenfalls eine langfristige Stabilisierung des Sees im mesotrophen Bereich vermuten.
Die Nitratkonzentration war im Beobachtungszeitraum mit Werten zwischen 1 mg/l und 1,2 mg/l etwa doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Seen, beispielsweise dem Starnberger See. Somit muß die Nitratkonzentration als relativ hoch angesehen werden. Als sehr niedrig kann hingegen die Ammoniumkonzentration bewertet werden. Sie erreichte im Jahr 1991 mit einer maximalen Mittelkonzentration von 0,027 mg/l ihren Höchstwert während des Untersuchungszeitraumes.
Zwischen den Jahren 1985 und 1989 lagen die durchschnittlichen Chlorophyllkonzentrationen bei Werten um die 8 µg/l. Der außerordentlich hohe Wert im Jahre 1990 von ca. 13 µg/l ist auf einen sehr warmen Sommer zurückzuführen. Danach sanken die Werte kontinuierlich bis auf ein Niveau um 4 µg/l ab, was als eine deutliche trophische Reaktion auf die Phosphorminimierung gedeutet werden kann.
In engem Zusammenhang mit der Chlorophyllkonzentration steht die Sichttiefe. Die hier ermittelten Werte korrespondieren äußerst gut mit denen der Chlorophyllkonzentration. So lag die mittlere Sichttiefe bis 1990 bei ungefähr 4 Metern, mit den sinkenden Chlorophyllkonzentrationen konnten regelmäßig höhere Werte bis 5, 6 Meter Sichttiefe registriert werden.
e) Biologische Verhältnisse: Makrophytenbestand:
Bei einer Makrophytenkartierung wurden 1986 24 Röhrichtarten, 2 Schwimmblattarten, ein Wasserschweber und 36 untergetaucht lebende Arten nachgewiesen. Vor allem außerhalb der Siedlungsbereiche sind noch ausgedehnte Röhrichtbestände vorhanden, in den Siedlungsbereichen sind diese allerdings stark beeinträchtigt, wenn nicht schon ganz verschwunden. Aber auch außerhalb der Ortschaften stellt der immer höher werdende Freizeitnutzungsdruck eine zunehmende Gefährdung für das Ammerseeröhricht dar. Mit Hilfe des Makrophytenindexes, der sich aus dem Vorkommen indikativer Arten ableitet, lassen sich Aussagen über die Nährstoffbelastung in den Uferbereichen machen (vgl. Abb. 4). Ganz deutlich sind die stärksten Belastungen im Bereich der Zuflüsse, vor allem der Ammer zu erkennen. Erheblich bis stark belastet zeigen sich weite Teile des Ostufers, besonders in der Herrschinger Bucht, sowie einzelne Abschnitte des Westufers. Diese ist überwiegend mäßig bis erheblich belastet, im nördlichen Seeteil sind die geringsten Nährstoffbelastungen anzutreffen. Durch die seit Mitte der Achziger Jahre stark rückläufigen Nährstoffkonzentration ist mittlerweile eine Veränderung in der Verteilung der Makrophyten zu erwarten, es liegen jedoch noch keine aktuelleren Untersuchungen vor, die dies bestätigen könnten.
Über das Phytoplankton liegen jedoch detaillierte Untersuchungen, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung vorgenommen wurden, vor. Aus diesen geht hervor, daß die Phytoplanktonsukzession die durch Gewässerschutzmaßnahmen hervorgerufenen Oligotrophierungsprozesse wiederspiegelt. Die normalerweise jährlich wiederkehrenden Planktonentwicklungen sind durch die Dynamik dieses Prozesses stark beeinflußt. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Zusammensetzung der trophieindikativen Arten des Planktons inzwischen vermehrt diejenigen Arten auftreten, welche nährstoffärmere Bedingungen bevorzugen.
f) Anthropogene Einflußfaktoren und wasserwirtschaftliche Nutzung:
Während weite Teile des Ammerseeufers eine naturnahe Ausprägung mit üppiger Vegetation aufweisen, ist es in den Bereichen der Seeufergemeinden durch die zahlreichen Nutzungen stark beeinträchtigt und verändert.
Vor allem im Sommer wird der Ammersee durch den massiven Fremdenverkehr beeinflußt. Dabei spielen die Kurzurlauber aus München und Augsburg eine entscheidende Rolle. Durch die unmittelbare Nähe zu diesen beiden Ballungszentren, ungefähr 50 km, kommt es an schönen Wochenenden zu einem regelrechten Massenauflauf in den Strandbäder, Biergärten oder auf den Rad- und Wanderwegen rund um den See. Da diese zumeist mit PKW`s oder Motorrädern anreisen ergeben sich für die Anliegergemeinden unlösbar scheinende Verkehrsund Parkplatzprobleme. Als alternatives Verkehrsmittel dient die Bahn, entweder am Ostufer die Münchener S - Bahn Endhaltestelle Herrsching, oder die am gesamten Westufer verlaufende Ammerseebahn, die aus Augsburg kommt.
Die günstigen Windverhältnisse sorgen im Sommer für starken Segel- und Surfbetrieb, außerdem verkehrt die staatliche Schiffahrt mit vier Motorschiffen. Private Motorbootnutzung ist glücklicherweise strengen Reglementierungen unterworfen und deshalb so gut wie nicht anzutreffen, die Ausnahmen stellen die Wasserwacht, die Wasserschutzpolizei, sowie die Fischer und die Bootsverleihe dar. Die intensive fischereiliche Nutzung des Ammersees ist hauptsächlich auf die Renke, einer wohlschmeckenden nur in den Voralpenseen anzutreffende Felchenart zurückzuführen.
4. Bewertung und Auswirkungen der Einflußfaktoren
Sowohl die intensive anthropogene Nutzung, obwohl des Ammersees als Freizeit- und Erholungszentrum, als auch die Flächennutzung im Einzugsgebiet üben einen starken Einfluß auf den Gewässerhaushalt aus. Durch den Bau des Ringkanals in den 70er Jahren, einschließlich Kläranlage, sowie abwassertechnische Verbesserungen im Bereich des Einzugsgebietes wurde aber eine positive Entwicklung der Gewässergüte erreicht. Der Ringkanal wurde zum Entgegenwirken der immer stärker werdenden Eutrophierungsprozesse aufgrund ungeklärt in den Ammersee gelangender Abwässer errichtet. Über den rund 16 km langen Ufersammler mit Stauraumkanälen zur Abspeicherung der Regenwässer und 4 Hebeanlagen werden die Abwässer der am Westufer gelegenen Gemeinden (Dießen, Utting, Schondorf, Windach, Greifenberg und Eching) vom Ammersee ferngehalten und zur Kläranlage Eching mit dem Vorfluter Amper weitergeleitet. Als weitere Maßnahme zur abwassertechnischen Sanierung des Einzugsgebietes wurde in vielen Gemeinden die geschlossene Kanalisation, mit Einleitung der geklärten Abwässer in geeignete Vorfluter eingeführt. Außerdem schlossen sich mehrere Gemeinden zu Abwasserzweckverbänden zusammen, um eine kostengünstigere Beseitigung der Abwässer zu erlangen. All diese Maßnahmen ließen die immer stärker werdenden Eutrophierungsprozesse allmählich abklingen, ein schrittweises Vorrücken in den vorwiegend mesotrophen Bereich konnte erreicht werden.
1992 weist die Gewässergütekarte Bayerns den Ammersee als mesotroph aus. Die Auswertung der chemisch - physikalischen sowie der biologischen Daten bestätigen diese Annahme. Eine genauere Betrachtung des Phytoplanktons verdeutlicht jedoch, daß aber immer noch eine Umschichtung in der Artenzusammensetzung stattfindet, offensichtlich hat sich noch kein stabiles biologisches Gleichgewicht eingestellt, wie etwa beim Starnberger See. Aufgrund der drastischen Reduzierung der Phosphorkonzentrationen, und der damit verbundenen Senkung der Chlorophyllkonzentration ist auch ein Rückgang in der Primärproduktion von Biomasse zu verzeichnen, was auf das Wachstum der für die Fischerei bedeutsamen Renken eine hemmende Wirkung hat. Anhand der Jahresmittelwerte des Phosphorgehaltes kann überwiegend oligotropher Charakter festgestellt werden (vgl. Abb. 5). Die statistische Wahrscheinlichkeit aufgrund der Phosphorkonzentration weist den See sogar zu 65% als oligotroph aus, während mesotrophe Verhältnisse noch zu ca. 30% und eutrophe zu ca. 5% wahrscheinlich sind. 1980 war der See noch zu 50% eutroph bzw. mesotroph. Aufgrund der intensiven anthropogenen Beeinflussung und Nutzung des gesamten Einzugsgebietes ist wahrscheinlich dieser aufgrund der Phosphorkonzentration vermutete oligotrophe Status nicht mehr erreichbar.
Literatur:
- Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft: Seen in Bayern; Limnologische Entwicklung von 1980 bis 1994, München 1996
- Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft: Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch/Donaugebiet 1994
- Hendl M. u. H. Liedke(Hrsg.): Lehrbuch der allgemeinen physischen Geographie, Gotha 1997
- Lkr. Landsberg a. Lech (Hrsg.): Landsberger Kreisheimatbuch, Landsberg 1982
Häufig gestellte Fragen zum Ammersee
Was ist die Genese des Ammersees?
Der Ammersee entstand als typischer Zungenbeckensee während der Würmeiszeit (139.000 v.H. bis 15.000 v.H.) durch den Ammersee-Teilgletscher des Isar-Loisach-Gletschers. Nach dem Rückzug des Gletschers bildete sich ein Zungenbecken, das sich durch Ablagerungen der Zuflüsse und den Endmoränendurchbruch der Amper verkleinerte. Die Verlandung dauert an.
Wo liegt der Ammersee und welche administrativen Zuordnungen hat er?
Der Ammersee liegt in Bayern und ist der drittgrößte See Bayerns. Er gehört zum Regierungsbezirk Oberbayern. Das Westufer gehört zum Landkreis Landsberg am Lech, das Ostufer zum Landkreis Starnberg. Die Ammer im Süden und die Amper im Norden bilden die Grenzen.
Welche geologischen und geographischen Verhältnisse prägen das Einzugsgebiet des Ammersees?
Das Einzugsgebiet des Ammersees (ca. 1000 km²) weist ein ausgeprägtes Relief auf. Flinzschichten und tonige Moränen bilden den Grundwasserstauer. Sandig-kiesige Schichten dienen als Grundwasserleiter. Die Ammer entspringt in den nördlichen Kalkalpen auf knapp 2000 m ü. NN und mündet bei 533 m ü. NN in den Ammersee. Das Klima entspricht dem der bayerisch-schwäbischen Hochebene, beeinflusst von kontinentalen Einflüssen. Die mittleren Niederschlagssummen betragen am Ammersee ca. 800 mm, im oberen Einzugsgebiet bis zu 1500 mm.
Wie sehen die hydrologischen Verhältnisse des Ammersees aus?
Die Ammer ist der wichtigste Zufluss mit einer mittleren Abflussspende von 16,6 m³/s. Bei Extremereignissen kann die Abflussspende bis zu 600 m³/s erreichen. Der Seeausfluss, die Amper, hat einen MQ von 21,1 m³/s. Der Ammersee hat eine starke Speicher- und Rückhaltefunktion.
Wie ist der Wärme- und Stoffhaushalt des Ammersees charakterisiert?
Der Ammersee zeigt ein dimiktisches Mischungsverhalten, d.h. zweimal jährlich eine stabile Schichtung im Sommer und Winter, mit Phasen der Vollzirkulation im Frühjahr und Herbst. Im Sommer bildet sich eine warme Oberflächenschicht (Epilimnion), eine Sprungschicht (Metalimnion) und ein kaltes Tiefenwasser (Hypolimnion).
Welche chemisch-physikalischen Verhältnisse herrschen im Ammersee?
Der Sauerstoffgehalt zeigt den typischen Jahresgang eines mesotrophen Sees mit guter Sauerstoffversorgung zu Zeiten der Volldurchmischung. Während der Sommermonate kann ein Sauerstoffdefizit im Metalimnion auftreten. Die Phosphorkonzentration ist durch Sanierungsmaßnahmen im Einzugsgebiet deutlich gesunken. Die Nitratkonzentration ist relativ hoch, die Ammoniumkonzentration sehr niedrig. Die Chlorophyllkonzentration und Sichttiefe korrelieren gut miteinander.
Wie ist der Makrophytenbestand und das Phytoplankton im Ammersee beschaffen?
Es wurden 24 Röhrichtarten, 2 Schwimmblattarten, ein Wasserschweber und 36 untergetaucht lebende Arten nachgewiesen. Vor allem außerhalb der Siedlungsbereiche sind noch ausgedehnte Röhrichtbestände vorhanden. Die Phytoplanktonsukzession spiegelt die Oligotrophierungsprozesse wider, wobei vermehrt Arten auftreten, die nährstoffärmere Bedingungen bevorzugen.
Welche anthropogenen Einflüsse und wasserwirtschaftlichen Nutzungen prägen den Ammersee?
Der Ammersee wird stark durch Fremdenverkehr, Segel- und Surfbetrieb sowie die staatliche Schiffahrt beeinflusst. Private Motorbootnutzung ist streng reglementiert. Die Fischerei konzentriert sich hauptsächlich auf die Renke. Die Uferbereiche in den Seeufergemeinden sind durch die Nutzungen stark beeinträchtigt.
Wie werden die Einflußfaktoren bewertet und welche Auswirkungen haben sie?
Die anthropogene Nutzung und die Flächennutzung im Einzugsgebiet üben einen starken Einfluss auf den Gewässerhaushalt aus. Durch den Bau des Ringkanals und abwassertechnische Verbesserungen wurde eine positive Entwicklung der Gewässergüte erreicht. Der Ammersee wird als mesotroph ausgewiesen, wobei eine Umschichtung in der Artenzusammensetzung des Phytoplanktons stattfindet. Die drastische Reduzierung der Phosphorkonzentrationen und die damit verbundene Senkung der Chlorophyllkonzentration führt zu einem Rückgang der Primärproduktion von Biomasse.
- Quote paper
- Sebastian Fuchs (Author), 1999, Gebietswasserhaushalt Ammersee, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97341