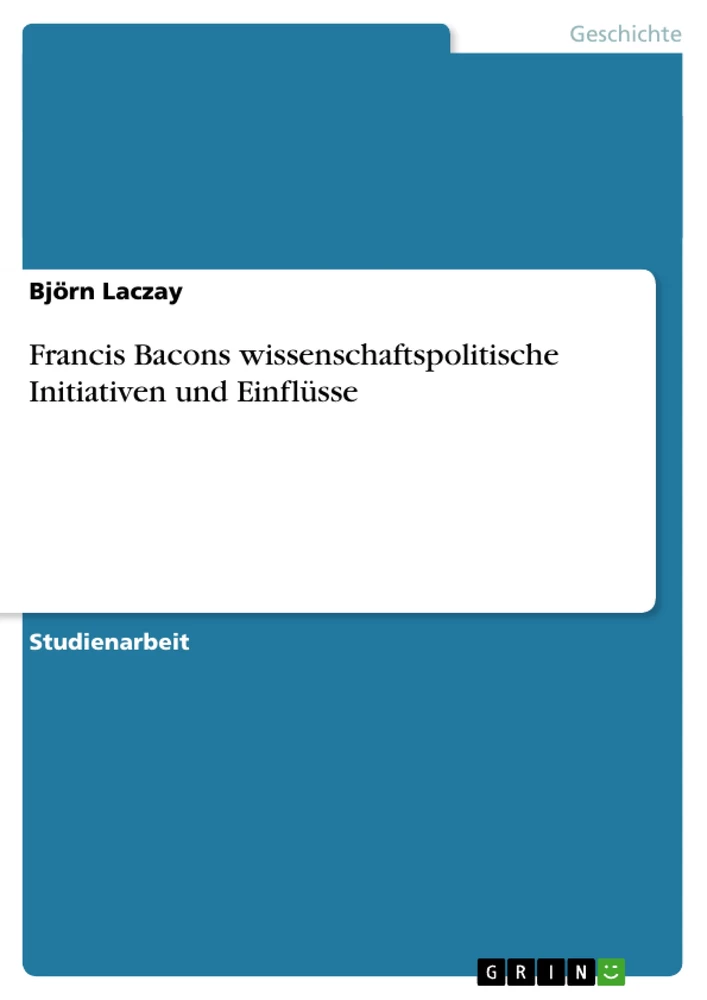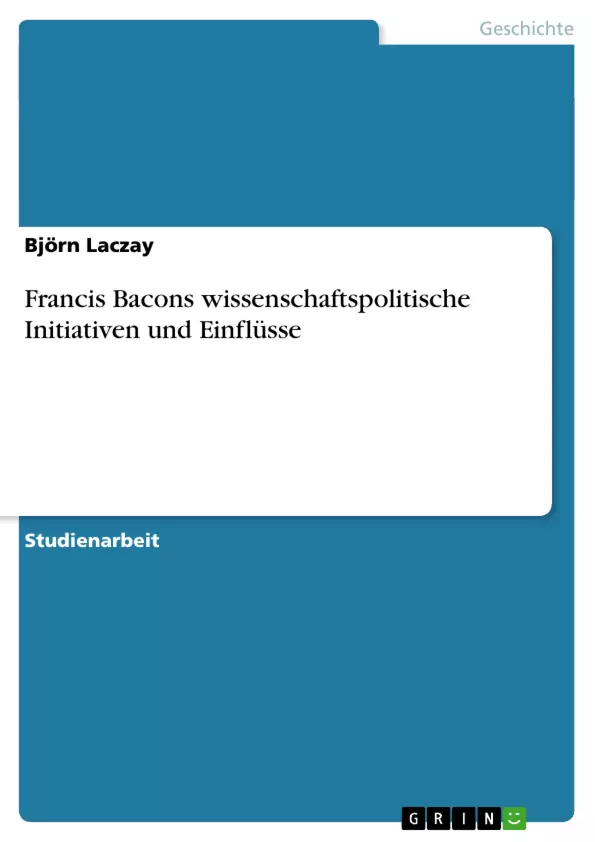Einleitung
Francis Bacons Leben und Werk kann von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet werden. Sieht man ihn in erster Linie als Wissenschaftler und versucht ihn als solchen zu beurteilen, so schneidet er nicht gerade gut ab. Seine Leistungen auf diesem Gebiet beschränken sich auf einige amateurhafte Spätwerke, die seine Reputation als Begründer der experimentellen Wissenschaften durchaus nicht bestätigen mögen. Sucht man in ihm dann wenigstens den Begründer einer bestimmten Methode, so wird man ebenfalls enttäuscht, denn jene Methode der “wahren Induktion”, die er im zweiten Teil seines Neuen Organon in aller Ausführlichkeit darlegt, wurde so gut wie nie konsequent angewandt und muß dem heutigen Leser überhaupt als unpraktikabel erscheinen.
Zwei andere Perspektiven dagegen lassen ihn in einem helleren Licht erscheinen; als Philosoph stilistisch mehr der Renaissance als der Neuzeit verhaftet, besteht seine Leistung darin, die Autorität der alten Griechen über Bord zu werfen, ohne, wie viele derer, die ihm darin vorangingen, auf einen platten Experimentalismus zu setzen. Die Aufforderung, den menschlichen Geist dazu verwenden, “den von der Naturlehre und den ... Experimenten dargebotenen Stoff” zu verarbeiten, statt ihn “unverändert in das Gedächtnis” aufzunehmen, wird von der modernen Wissenschaft ganz sicher unbedingt befolgt. Bacons Leistung bestand quasi darin, die reine Vernunft und und die rein praktische Naturbeobachtung und -benutzung in einem eindringlichen Werk wieder zusammenzuführen.
Als Politiker war er darüberhinaus sehr daran interessiert, diese neue Art der Wissenschaft zu institutionalisieren, sie, staatlich gefördert, in großem Maße voranzubringen. Bereits zu Lebzeiten versuchte er immer wieder, seinen mehr oder weniger großen Einfluß zu diesem Zwecke zu nutzen.
Diese Arbeit gibt einen Überblick vor allem über dieses eigene politische Wirken Bacons, das nicht von Erfolg gekrönt war, und über seinen Einfluß im England der Zeit von seinem Tod bis zur Gründung einer erfolgreichen wissenschaftlichen Institution, von der man wohl getrost sagen kann, daß ihre Entstehung hauptsächlich auf diesen Enfluß zurückgeht - der Royal Society - und beleuchtet kurz die Umstände, die seinen Ideen diesen Auftrieb verschaffen konnten.
1. Bacons Leben: Der einsame Erneuerer
Francis Bacon, der im Januar 1561 zur Welt kam, war sein Leben lang in allererster Linie Jurist und Politiker. Sein Vater, der englische Großsiegelbewahrer Sir Nicholas Bacon, war von Anfang an daran interessiert, einen solchen aus seinem letzten Sohn zu machen. So wurde Bacon bereits 1576, im Alter von 15 Jahren, nach einer humanistischen Ausbildung am Trinity College in Cambridge zusammen mit dem neuen englischen Abgesandten Sir Amyas Paulet zum Studium der Staatskunst nach Frankreich geschickt. Bedingt durch Sir Nicholas’ Tod im Jahre 1579 und der damit verbundenen Notwendigkeit, sich eine eigene Existenzgrundlage zu schaffen, kehrte er nach England zurück, wo er umgehend ein Rechtsstudium am Gray’s Inn in London begann. Ab 1584 hatte er einen Parlamentssitz inne, zu dem ihm der Schatzkanzler, sein Onkel Lord Burghley verholfen hatte. Seine juristische Karriere schritt zunächst bemerkenswert schnell voran; als er sich jedoch 1593 im Streit um die Erhebung von “Subsidien” zur militärischen Aufrüstung gegen Spanien im Parlament zum Fürsprecher derjenigen machte, die den Belastungszeitraum für zu kurz hielten (und sich somit gegen die Königin stellte), fiel er bei Elizabeth in Ungnade. Eine Beförderung in ein hohes Justizamt, auf die er davor durchaus hatte hoffen können, rückte in weite Ferne. Noch schlimmer kam es im Jahre 1601, als der Earl of Essex, ein früherer Günstling der Königin dessen Berater Bacon war, eine Rebellion anzettelte, die jedoch schnell niedergeschlagen wurde. So konnte der weitere Aufstieg Bacons erst nach dem Ende der Tudor-Herrschaft mit dem Tod Elizabeths im Jahre 1603 beginnen. Der Stuart James I. schlug, quasi als Einstandsgeschenk, dreihundert Auserwählte, darunter auch Bacon, zum Ritter. Der Geehrte konnte diesem Titel zwar nicht viel abgewinnen, doch sein Werdegang entwickelte nun endlich eine gewisse Dynamik: 1604 wurde er Kronanwalt, 1607 zweiter Kronanwalt (“Solicitor-General”), 1613 erster Kronanwalt (“Attorney- General”), 1616 Geheimer Staatsrat (“Privy Counsellor”), 1617 Großsiegelbewahrer; 1618 schließlich übernahm er als Lordkanzler das höchste Staatsamt und wurde als Baron Verulam ins Oberhaus aufgenommen. 1621 folgte die Ernennung zum Viscount St. Albans. Während dieser Zeit versuchte er beständig, zwischen dem König und dem Parlament, dessen Mitglied er blieb, zu vermitteln; diese Politik scheiterte jedoch. Im andauernden Streit um die Finanzierung des königlichen Haushalts stand Bacon - von Amts wegen wie auch aus innerer Überzeugung, jedoch relativ erfolglos - auf der Seite des Königs. 1621 wurde er so zur Zielscheibe der Parlamentarier. In einer Petitionsstunde des Parlaments tauchten zwei Männer auf, deren Fälle er als Richter verhandelt hatte, und behaupteten, er habe Geldgeschenke von ihnen angenommen. Obwohl dies damals durchaus übliche Praxis war und Bacons Urteile nachweislich nicht dadurch beeinflußt worden waren (beide hatten ihr Verfahren verloren), wurde er der Korruption angeklagt und schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, eine Zeitlang im Tower festgesetzt und für unfähig erklärt, ein Staatsamt zu bekleiden oder einen Parlamentssitz einzunehmen. Damit war seine politische Karriere naturgemäß beendet. Bacon starb 5 Jahre später am 9. April 1626.
Neben diesem abwechslungs- und auch erfolgreichen Leben als Staatsmann und Jurist war der vielseitig interessierte Bacon in seiner Freizeit der philosophische Schriftsteller, als der er der Nachwelt in erster Linie bekannt ist. Wie ein roter Faden zieht sich ein Projekt durch einen Großteil seiner Werke: Die Erneuerung der Wissenschaften. Bacon, der, wie aus einer Bemerkung gegenüber seinem Kaplan und frühestem Biographen William Rawley und wohl auch aus einem Aphorismus seines Novum Organon hervorgeht, schon während seiner Jugendzeit am Trinity College eine Abneigung gegen die alte (vor allem die aristotelische) Philosophie entwickelte, sah diese Erneuerung dabei durchaus nicht nur als eine bloße literarische Anleitung für die Nachwelt an; schon relativ früh suchte er seinen Einfluß regelmäßig zu nutzen, um die Idee seiner “Instauratio” Wirklichkeit werden zu lassen. Nachdem er wohl etwa zwischen 1579 und 1589 eine erste, nicht erhaltene Schrift zu diesem Thema verfaßt hatte (“Temporis partus maximus”, “Die größte Geburt der Zeit”), wandte er sich im Jahre 1592 mit der Bitte um Unterstützung seines Vorhabens in einem Brief an seinen einflußreichen Onkel Lord Burghley. Hier beschreibt er nicht nur erstmals seine Ziele (nämlich die Wissenschaft sowohl von den etablierten Lehren der alten Philosophen als auch von den Empirikern zu befreien), sondern zeigt auch deutlich, wie ernst es ihm mit ihnen ist (“... es ist so in meinem Geist verfestigt, daß es nicht entfernt werden kann.”, “Und wenn seine Lordschaft mich nicht unterstützen will, dann werde ich ... meine Erbschaft verkaufen ... und ein armer Buchschreiber werden oder ein wahrer Pionier in der Mine der Wahrheit ...”). Zwar machte er diese Ankündigungen nicht wahr, sondern setzte seine politische Karriere fort; doch schon kurz danach diente ihm seine Bekanntschaft mit dem zu dieser Zeit am Hof noch relativ mächtigen Earl of Essex dazu, seine Ideen dort zu propagieren. Noch 1592 verfaßte er, anläßlich einer Krönungsfeier der Königin, zwei Reden, von denen die eine (“zum Ruhme der Erkenntnis”) nichts anderes war als eine öffentliche Darstellung seiner “neuen” Philosophie im Gegensatz zur herkömmlichen. Zwei Jahre später läßt Bacon, in einem Maskenspiel anläßlich einer Weihnachtsfeier im Gray’s Inn, sechs königliche Berater auftreten, die nacheinander verschiedene Standpunkte vertreten. Die Ansprache des Fürsprechers der Philosphie nimmt bereits einige der wichtigsten Teile des “House of Salomon” im berühmten Fragment “New Atlantis” vorweg, indem sie einen Garten empfiehlt, der sämtliche Tiere und Pflanzen beherbergen soll, eine umfassende Bibliothek und eine Art technisches Museum, in welchem “was immer die Hand des Menschen ... geschaffen hat” beherbergt werden sollte. Er richtete sich damit wohl auch schon an die Queen. Natürlich konnte er in seiner damaligen Position nicht hoffen, diese sofort für sein Wissenschaftsprogramm zu gewinnen; doch zeigen diese frühen Werke, wie auch die “Essays” von 1597, die der Grundstein seines schriftstellerischen Ruhmes sein sollten, deutlich, wie seine Literatur immer auch belehren und beeinflussen wollte.
Zwischen 1594 und 1603 existieren keine Schriften, die auf Bacons Reformideen hinweisen. Es ist plausibel, anzunehmen, daß er sie während dieses Lebensabschnittes noch mit politischer Macht durchsetzen zu können glaubte; jedoch erwies sich seine von der Karriere des Earl of Essex abhängige Strategie als das falsche Mittel hierzu, zunächst wohl aufgrund Essex’ Desinteresse für die Wissenschaften, später, und noch mehr, aufgrund seiner fatalen Machtgelüste. 1601 erschienen Bacon seine politischen Möglichkeiten so gering, daß er sich entschloß, selbst als Philosoph tätig zu werden. Aus der Zeit von 1603 bis 1607 stammen einige zu seinen Lebzeiten unveröffentlichte Manuskripte, die man auch aufgrund der starken stilistischen Unterschiede wohl als Ecksteine einer Suche nach der richtigen Form ansehen kann. In diese Zeit fällt auch das Buch “Proficience and Advancement of Learning Divine and Humane” von 1605, das, enzyklopädisch angelegt, einen ersten Versuch Bacons darstellt, seine Ideen praktisch umzusetzen. Auch war es dem neuen König James I. gewidmet, offenbar wiederum in der Absicht, Unterstützung für eine praktische Umsetzung wissenschaftlicher Reformen zu erlangen. Doch James war zwar ein hochgebildeter Mann, hatte aber zu sehr mit anderen politischen Problemen zu kämpfen um sich darum zu kümmern, und so sollte es auch während des nun doch folgenden politischen Aufstiegs Bacons im wesentlichen bleiben. Auch 1620, kurz vor Erscheinen seines unvollendeten Hauptwerkes “Instauratio Magna”, als er dem König gegenüber in einem Brief als Hauptgrund für die frühe Veröffentlichung angab, er hoffe “... Hilfe für einen geplanten Teil [seines] Werkes zu erlangen, nämlich die Zusammenstellung einer Natur- und Experimentalgeschichte, die die hauptsächliche Grundlage einer wahren und aktiven Philosophie sein muß”, wurde er nach kurzer Korrespondenz wiederum vertröstet, obwohl er zu diesem Zeitpunkt als Lordkanzler im höchsten Ansehen stand.
Nach seinem Sturz blieb ihm somit nichts, als sich erneut alleine seinem Projekt zu widmen. Er vervollständigte das “Advancement of Learning” und übersetzte es ins lateinische, sodaß ihm das nunmehr “De Dignitate et Augmentis Scientarium” genannte Werk als der erste Teil seiner “Instauratio”, der Einteilung der Wissenschaften, dienen konnte, und schrieb die Fragment gebliebene und erst posthum veröffentlichte, jedoch umso einflußreichere Gesellschaftsutopie “New Atlantis”. Auch begann er mit der Arbeit am dritten Teil, der “Natur- und Experimentalgeschichte zur Grundlegung der Philosophie”, den er für wichtiger hielt als den bereits erschienenen zweiten Teil, das “Neue Organon”. Er vollendete eine Beschreibung der Winde sowie eine Beschreibung des Lebens und des Todes, ein Werk über das Schwere und Leichte blieb Manuskript; ein Versuch einer umfassenderen, jedoch im Nachhinein betrachtet qualitativ minderwertigeren Wissenssammlung stellte, posthum veröffentlicht, “Sylva Sylvarum” dar. Bacon hatte keine Hoffnung mehr, das Ziel zu erreichen, das er schon als 31jähriger seinem Onkel gegenüber formuliert hatte, “über den Verstand von mehr Köpfen ... als nur über den eigenen” zu gebieten; daher musste er vollenden, was er selbst noch schaffen konnte und im übrigen auf die Nachwelt hoffen. Diese Hoffnung sollte nicht vergebens sein.
2. Die puritanische Revolution: Fruchtbarer Boden
Gesellschaftliche Kreise, auf die der königstreue Bacon wohl zu seiner eigenen Zeit am wenigsten gesetzt hätte, sollten schließlich völlig in seinem Sinne weiterverfahren: die zunehmend an Einfluß gewinnenden Puritaner. Diese religiöse Gruppe, die einen gewichtigen Teil der englischen Reformationsbewegung darstellte und seit elisabethanischer Zeit in scharfer Opposition zum Monarchen als dem Oberhaupt der anglikanischen Kirche stand, zeichnete sich durch eine besondere Art von “Endzeitstimmung” aus. Der Konflikt mit dem englischen König und der von Protestanten gegen Katholiken geführte dreissigjährige Krieg auf dem Kontinent wurden als letzte Schlacht gegen den “Antichristen” angesehen, bei der die von Gott unterstützten reformatorischen Bewegungen schließlich den Sieg davontragen würden. Danach erwartete man das Heraufziehen eines goldenen Zeitalters, ja sogar den Wiedereinzug der Menschheit ins Paradies.
Die weiterverbreitete Ansicht, daß das Mittel zur Erreichung dieses Wiedereinzugs eine göttlich legitimierte Rückgewinnung der Herrschaft des Menschen über die Natur sein würde (die eben zu Zeiten Adams bereits bestanden haben musste), stützte sich dabei vor allem auf die Bibelstelle Daniel 12,4: But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Man hielt, wie gesagt, die “Zeit des Endes” bereits beinahe für gekommen; auch die Prophezeihung “many shall run to and fro” schien bereits erfüllt (mit der Entdeckung und Besiedlung der neuen Welt). Nun sollte also die Erkenntnis vermehrt werden.
Es erscheint kaum verwunderlich, daß Bacons Philosophie hier großen Anklang fand. Schließlich zitiert auch er bereits die genannte Bibelstelle schon auf dem Titelbild der Instauratio Magna (“Multi pertransibunt et augebitur scientia”), sowie beispielsweise im 93. Aphorismus des Neuen Organon, und zieht ähnliche Schlüsse:
Auch die Prophezeiung Daniels über die letzten Zeiten der Welt ist nicht zu überhören: “Viele werden vorübergehen, und von vielerlei Art wird die Wissenschaft sein.” Sie deutet klar an ..., es sei von der Vorhersehung beschlossen, daß die Durchwanderung der Welt, die nach so vielen langen Seereisen so gut wie erreicht ... scheint, und die Vertiefung der Wissenschaften in dasselbe Zeitalter fallen.
Bacon teilt die Auffassung der Puritaner, die Herrschaft über die Natur sei beim Sündenfall verlorengegangen, könne jedoch gemäß biblischer Prophezeiung demnächst wiedergewonnen werden - und es gibt weitere Anknüpfungspunkte. Die in seinem Fragment New Atlantis beschriebene utopische Insel Bensalem kann sogar als Vorbild für die zukünftige paradiesische Gesellschaftsordnung dienen, nicht nur wegen der Darstellung des “Hauses Salomons”, Bensalems wissenschaftlicher Akademie (auf die es Bacon wohl in erster Linie angekommen sein dürfte); besonders attraktiv für eine Übernahme in die puritanische Ideologie wird es vor allem wegen der harmonischen und christlichen Lebensweise der Insulaner (Bacon flechtet die Geschichte ihrer Christianisierung hier als eine Art von Wundererzählung ein). Bacon gehörte wie selbstverständlich zur Lektüre einflußreicher Puritaner seiner Zeit, wie Samuel Hartlib, John Wallis oder John Wilkins; man könnte ihn, neben (später) Jan Amos Comenius, beinahe als den offiziellen Philosophen des Puritanismus sehen.
3. Die Royal Society: Verwirklichung von Bacons Traum
Anstrengungen, Bacons einprägsame Idee des “House of Salomon” Wirklichkeit werden zu lassen, begannen unter dem Einfluß des unter den Bürgern und dem niederen Landadel sehr weit verbreiteten Puritanismus schon relativ früh. In den dreißiger schienen aufgrund der in England vorherrschenden politischen Schwierigkeiten zunächst Kolonien der adäquate Weg hierzu; boten sie doch schließlich die vermeintliche Perspektive der Gründung einer Gesellschaft ohne religiöse Spannungen. Sogar Samuel Hartlib verfolgte zwischen 1628 und 1635 Pläne dieser Art, verblieb dann aber, wahrscheinlich auch aufgrund seiner guten Verbindungen nach Kontinentaleuropa, doch in England und versuchte sich zusammen mit Comenius und einigen anderen 1641 am Aufbau eines “Universal College”. Die Pläne gediehen relativ weit, das Parlament hatte bereits Räumlichkeiten in Aussicht gestellt, doch der heraufziehende Bürgerkrieg verhinderte letztlich ihre Umsetzung. Da eine tatsächliche, in einem Gebäude residierende Institution nun nicht mehr im Bereich des Möglichen schien, wandte sich Hartlib einer weniger anspruchsvollen Idee zu. Die Pläne zu seinem “Office of Address” von 1646 beschrieben eine staatliche Organisation, die den, auch internationalen, Informationsaustausch über die Fortschritte der neuen Philosophie organisieren und fördern sollte. Das Projekt erwies sich als vielversprechender. Nicht nur erhielt es Unterstützung vom Parlament (und auch dem Lordprotektor Oliver Cromwell), es zog auch sehr viele große Köpfe an, darunter Robert Boyle, der im Sommer 1647 mit der “Invisible College” genannten Gruppe von Intellektuellen dazustieß, die er einige Zeit zuvor um sich geschart hatte. Von einem ursprünglich stark religiös motivierten Vorhaben entwickelte sich das Office bis 1655 zu einer beinahe ausschließlich der Wissenschaft verschriebenen Institution. Doch auch diese sollte nicht von Dauer sein: Finanzielle Probleme, die auch aus Animositäten zwischen einzelnen Mitgliedern herrührten, und schließlich der Tod Oliver Cromwells beendeten 1659 ihre offizielle Existenz. Doch sie hatte immerhin lange genug existiert, um eine eng verbundene Gruppe von Gelehrten und einen Kreis von Förderern zu hinterlassen und darüberhinaus die Wichtigkeit einer nationalen wissenschaftlichen Einrichtung ins öffentliche Bewußtsein zu bringen.
Eine davon unabhängige Gruppe von Mathematikern und Naturwissenschaftlern hatte sich vom Jahre 1645 an bereits regelmäßig im Londoner Gresham College getroffen, darunter John Wilkins, John Wallis und Robert Hooke. Die Gruppe vergrößerte sich im Laufe der Zeit ebenfalls, beispielsweise kann man mit ihrem späteren Oxforder Ausläufer ab 1655 wiederum Robert Boyle in Verbindung bringen, und auch einige Personen aus dem Umfeld von Hartlibs Office stießen in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre hinzu. Aus dieser “Gresham-Gruppe”, die ihre Treffen gegen Ende der Republik kurz einstellte, ging nach allgemeiner Annahme nach der Thronbesteigung Charles II. der Vorläufer der Royal Society hervor. Am 28. November 1660 wurden bei einem Treffen regelmäßige Sitzungen (und Sitzungsorte) anberaumt und John Wilkins zum Vorsitzenden gewählt. Eine Woche später schrieb man Ziele und Arbeitsregeln fest und begann schließlich am 19. Dezember mit der wissenschaftlichen Arbeit. Im 1662 beurkundete Charles II. dieser Gesellschaft den Namen “Royal Society”, im April des folgenden Jahres wurden in einer weiteren königlichen Urkunde ihre Regeln festgehalten. Die Royal Society orientierte sich in ihrer frühen Geschichte sehr stark an Bacons Idealen, wenn auch nicht immer an seiner Methode. Ihr weiteres Wirken erwies sich als sehr erfolgreich (man denke nur an Newton) und nicht zuletzt war mit ihr endlich eine dauerhafte Einrichtung geschaffen worden - sie existiert bis heute.
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Quellen
Bacon, Francis: Essays, hrsg. von L. L. Schücking. Wiesbaden 1953.
Bacon, Francis: Neu-Atlantis, neu hrsg. von Jürgen Klein. Stuttgart 1982. Bacon, Francis: Neues Organon, hrsg. von Wolfgang Krohn. Hamburg 21999.
Bacon, Francis: The Works of Francis Bacon, hrsg von James Spedding, Robert L. Ellis und Douglas D. Heath. Stuttgart 1961-1963.
Gardiner, Samuel R.: The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625-1660. Oxford 31903, ND. 1962.
Sprat, Thomas: The history of the Royal Society of London, London 1734.
2. Darstellungen
Barry, James Jr.: Measures of Science. Theological and Technological Impulses in Early Modern Thought. Evanston 1996.
Bowen, Catherine D.: Francis Bacon. New York 1993.
Hoykaas, R.: The Rise of Modern Science: When and Why? In: British Journal for the History of Science 20 (1987), S. 453-473.
Krohn, Wolfgang: Francis Bacon (= Beck’sche Reihe Nr. 509). München 1987.
MacGregor, Arthur: A Magazin of All Manner of Inventions. Museums in the quest for “Salomon’s House” in seventeenth-century England. In: Journal of the History of Collections 1 No. 2 (1989), S. 207-212.
Ornstein, Martha: The Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century (= History of Medicine Series Bd. 6). London 1963.
Schaller, Klaus: Die Pansophie des Comenius und der Baconismus der Royal
Society. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 14 (1991), S. 161-167.
Sessions, William A.: Francis Bacon Revisited. New York 1996.
Vickers, Brian: Francis Bacon. Zwei Studien (= Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek Bd. 3). Berlin 1988.
Webster, Charles: The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626- 1660. London 1975
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Francis Bacon?
Diese Arbeit gibt einen Überblick über Francis Bacons politisches Wirken, seinen Einfluss im England der Zeit von seinem Tod bis zur Gründung der Royal Society, und beleuchtet die Umstände, die seinen Ideen diesen Auftrieb verschaffen konnten.
Was waren Francis Bacons Hauptanliegen?
Bacons Hauptanliegen war die Erneuerung der Wissenschaften. Er wollte die Wissenschaft von den etablierten Lehren der alten Philosophen befreien und sie institutionalisieren, staatlich gefördert voranbringen.
Welche Rolle spielte Bacon in der Politik?
Bacon war Jurist und Politiker. Er bekleidete hohe Staatsämter und versuchte, zwischen König und Parlament zu vermitteln. 1621 wurde er der Korruption angeklagt und schuldig gesprochen, was seine politische Karriere beendete.
Was ist die Instauratio Magna?
Die "Instauratio Magna" ist Bacons unvollendetes Hauptwerk, das er in mehrere Teile gliederte. Es umfasst u.a. eine Einteilung der Wissenschaften ("De Dignitate et Augmentis Scientarium") und das "Neue Organon", das seine Methode der "wahren Induktion" darlegt.
Welchen Einfluss hatte Bacon auf die Puritaner?
Bacons Philosophie fand bei den Puritanern großen Anklang. Sie teilten seine Auffassung, dass die Herrschaft über die Natur beim Sündenfall verlorengegangen sei und durch wissenschaftliche Erkenntnis wiedergewonnen werden könne.
Was ist das "House of Salomon"?
Das "House of Salomon" ist eine wissenschaftliche Akademie, die in Bacons Fragment "New Atlantis" beschrieben wird. Es diente als Vorbild für die Royal Society.
Was ist die Royal Society?
Die Royal Society ist eine wissenschaftliche Institution, die im England des 17. Jahrhunderts gegründet wurde. Sie orientierte sich an Bacons Idealen und erwies sich als sehr erfolgreich. Sie existiert bis heute.
Welche anderen Werke hat Bacon verfasst?
Zu Bacons weiteren Werken zählen u.a. "Essays", "Proficience and Advancement of Learning Divine and Humane", "De Dignitate et Augmentis Scientarium", "New Atlantis", "Sylva Sylvarum" sowie Beschreibungen der Winde und des Lebens und des Todes.
Was waren die gesellschaftlichen Umstände, die Bacons Ideen beförderten?
Die gesellschaftlichen Umstände, die Bacons Ideen beförderten, waren u.a. die zunehmende Bedeutung des Puritanismus und die Endzeitstimmung, die mit den politischen und religiösen Konflikten der Zeit einherging.
Welche Quellen und Literatur wurden für diese Arbeit verwendet?
Für diese Arbeit wurden sowohl Werke von Francis Bacon selbst als auch Darstellungen anderer Autoren über Bacon und die Royal Society verwendet, wie im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt.
- Arbeit zitieren
- Björn Laczay (Autor:in), 1999, Francis Bacons wissenschaftspolitische Initiativen und Einflüsse, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97299