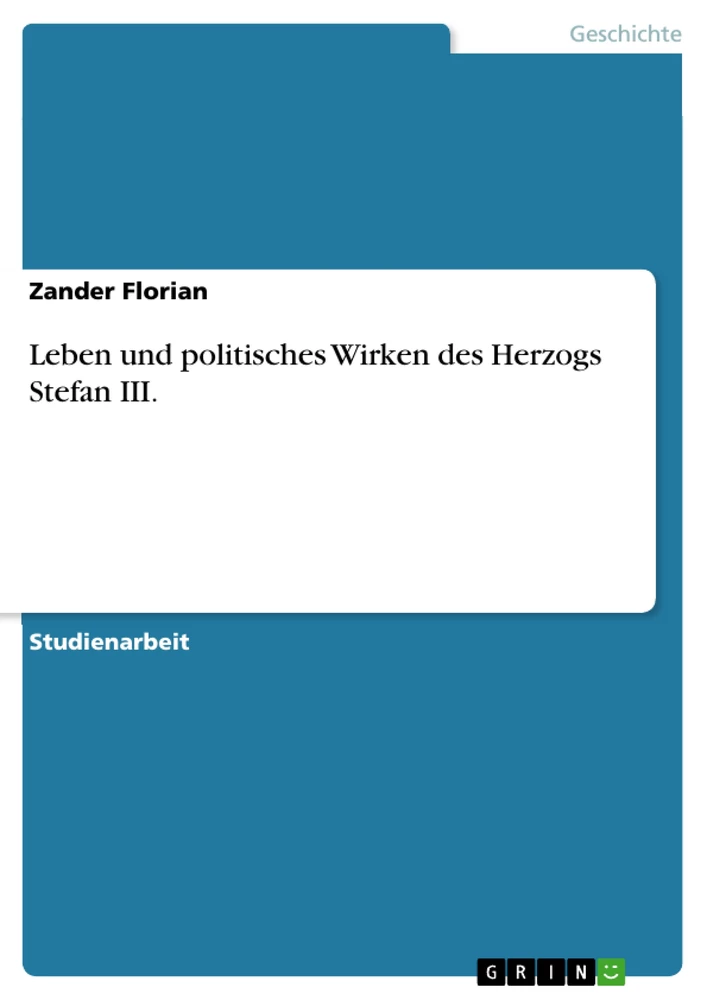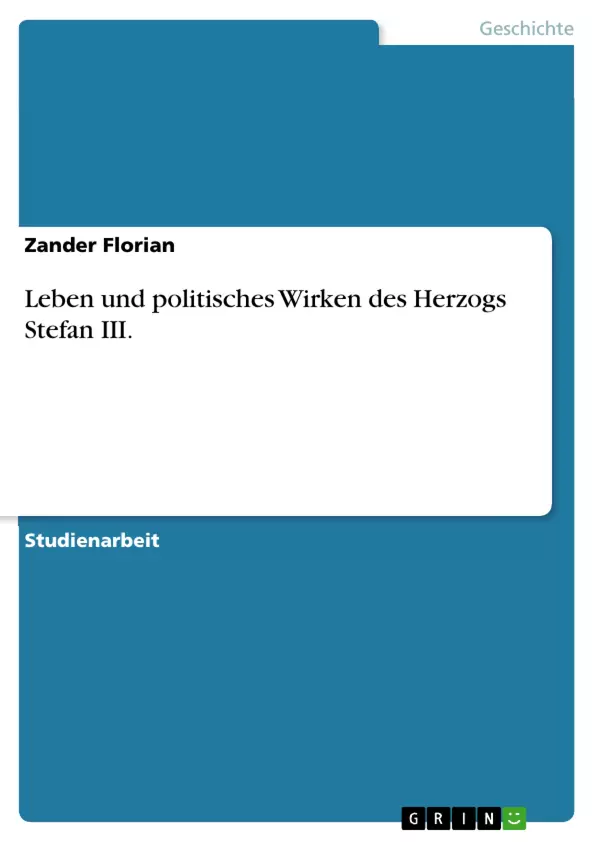Die bayerischen Herzoggestallten des Mittelaltes haben , bis auf einige wenige Ausnahmen, eines gemein: Sie wurden von der historischen Forschung bis heute wenig beachtet. Keine
Ausnahme stellt hier Herzog Stefan III. dar. Gerade das ist es aber, was die Erstellung einer Arbeit zu einem Thema wie Stefan III. so interessant macht. Anstatt ausschließlich schon
Bearbeitetes wiederzugeben, läßt die Herausarbeitung der Person Stefans III. einen großen Spielraum hinsichtlich eigener Überlegungen und Schlußfolgerungen. Daß eine Person wie Stefan III., der zu seiner Zeit sicher zu den meist bekannten aber vor allem auch gefürchtetsten Herrschen Europas zählte, so wenig Widerhall in der Forschung findet, liegt sicherlich daran, daß hinsichtlich eines politischen Wirkens des Herzogs so gut
wie nichts bekannt ist. Mit Stefan III. herrschte in Bayern ein Herzog, der hinsichtlich seines Abenteurertums, seinen ritterlichen Tugenden und seines Verständnisses von prachtvoller Herrschaftsausübung sowohl unter seinen Vorgängern als auch seinen Nachfolgern seines
Gleichen suchte.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen Überblick über das Leben und das Wirken Stefans III. zu vermitteln. Die Regierung Stefans fällt in ein Zeit, die man gelinde gesagt als unübersichtlich bezeichnen kann. Das aufstrebende Bürgertum verwickelt das Reich in einen Jahre währenden Städtekrieg, dem Reich selbst fehlt es an einem starken Herrscher (die Regentschaft eines Kaisers und von vier Königen fällt in diesen Zeitraum), in Bayern selbst scheitert 1392 endgültig der Versuch der gemeinsamen Regierung der Erben Stefans II., darüber hinaus schafft die Landesteilung ein großes Konfliktpotential zwischen den
bayerischen Herzögen. All diese und eine Reihe weiterer Faktoren führen dazu, daß es schon allein aufgrund der großen Fülle an Daten und Fakten sehr schwierig ist, eine Arbeit zu
verfassen, welche sich allein auf die Person Stefans III. bezieht. Stefan wirkt auf das Reich ein, wie das Reich auch auf ihn, er zeigt großes Engagement in auswärtigen Unternehmungen, muß aber auch (oder vielleicht besser „hätte müssen”) die innenpolitische Lage in Bayern im Auge behalten, alles in allem stellt eine Erarbeitung des Themas „StefanIII.” in einem eng begrenzten Rahmen einer Seminararbeit in erster Linie das
Zusammenstellen von historischen Material dar. Das Hauptproblem stellt hierbei, die eben angesprochene Knappheit dar, in welcher das Thema zu erarbeiten ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die „Jugend” Stefans III
2.1. Die Person Stefans III
2.2. Stefan III. bis zum Tod Stefans II. 1375
2.3. Die Lage in Bayern 1375
3. Bayern bis zur 3. Bayerischen Landesteilung 1392
3.1. Der Städtekrieg 1376- 1389
3.2. Stefans III. Verhältnis zu den Brüdern
3.2.1. Johann II
3.2.2. Friedrich
3.3. Das Verhältnis zum Königshaus bis 1392
3.4. Bayern und Habsburg
3.5. Die auswärtige Politik Stefans III
3.5.1. Italien
3.5.2. Frankreich
4. Die 3. Bayerischen Landesteilung
5. Oberbayern-Ingolstadt bis zum Tode Stefans III. 1413
5.1. Auseinandersetzungen mit Oberbayern-München
5.2. Das Verhältnis zum König
5.3. Stefan III. 1403-1413
6. Bewertung
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die bayerischen Herzoggestallten des Mittelaltes haben , bis auf einige wenige Ausnahmen, eines gemein: Sie wurden von der historischen Forschung bis heute wenig beachtet. Keine Ausnahme stellt hier Herzog Stefan III. dar. Gerade das ist es aber, was die Erstellung einer Arbeit zu einem Thema wie Stefan III. so interessant macht. Anstatt ausschließlich schon Bearbeitetes wiederzugeben, läßt die Herausarbeitung der Person Stefans III. einen großen Spielraum hinsichtlich eigener Überlegungen und Schlußfolgerungen.
Daß eine Person wie Stefan III., der zu seiner Zeit sicher zu den meist bekannten aber vor allem auch gefürchtetsten Herrschen Europas zählte, so wenig Widerhall in der Forschung findet, liegt sicherlich daran, daß hinsichtlich eines politischen Wirkens des Herzogs so gut wie nichts bekannt ist. Mit Stefan III. herrschte in Bayern ein Herzog, der hinsichtlich seines Abenteurertums, seinen ritterlichen Tugenden und seines Verständnisses von prachtvoller Herrschaftsausübung sowohl unter seinen Vorgängern als auch seinen Nachfolgern seines Gleichen suchte.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen Überblick über das Leben und das Wirken Stefans III. zu vermitteln. Die Regierung Stefans fällt in ein Zeit, die man gelinde gesagt als unübersichtlich bezeichnen kann. Das aufstrebende Bürgertum verwickelt das Reich in einen Jahre währenden Städtekrieg, dem Reich selbst fehlt es an einem starken Herrscher (die Regentschaft eines Kaisers und von vier Königen fällt in diesen Zeitraum1 ), in Bayern selbst scheitert 139 2 endgültig der Versuch der gemeinsamen Regierung der Erben Stefans II., darüber hinaus schafft die Landesteilung ein großes Konfliktpotential zwischen den bayerischen Herzögen. All diese und eine Reihe weiterer Faktoren führen dazu, daß es schon allein aufgrund der großen Fülle an Daten und Fakten sehr schwierig ist, eine Arbeit zu verfassen, welche sich allein auf die Person Stefans III. bezieht. Stefan wirkt auf das Reich ein, wie das Reich auch auf ihn, er zeigt großes Engagement in auswärtigen Unternehmungen, muß aber auch (oder vielleicht besser „hätte müssen”) die innenpolitische Lage in Bayern im Auge behalten, alles in allem stellt eine Erarbeitung des Themas „Stefan III.” in einem eng begrenzten Rahmen einer Seminararbeit in erster Linie das Zusammenstellen von historischen Material dar. Das Hauptproblem stellt hierbei, die eben angesprochene Knappheit dar, in welcher das Thema zu erarbeiten ist. Einzelnen Abschnitten, wie z.B. dem Verhältnis zwischen Bayern und Tirol oder den Städtekriegen könnte man mit Sicherheit ganze Doktorarbeiten widmen. Die Folge ist, daß ich mich bei der Erstellung dieser Arbeit in erster Linie auf die gängigen Handbücher gestützt habe. Genannt seien hier im besonderen die Werke von Max Spindler und Siegmund von Riezler.
Ein weiteres Problem stellt die Regierungszeit Stefans bis 1392 dar. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man eigentlich nicht einer Regierung Stefans, sondern nur von der Regierung der bayerischen Herzöge sprechen. Es ist schlichtweg unmöglich, diesen Zeitraum abzuhandeln ohne nicht auf Herzog Johann und insbesondere Herzog Friedrich, der bis zur Landesteilung das Land in einer Doppelspitze mit Stefan vereint regierte, einzugehen Anders als es die Autoren zum Thema tun, möchte ich in dieser Arbeit nicht rein chronologisch vorgehen. Ich möchte zuerst auf den Zeitraum vor der 3. großen Landesteilung eingehen, die Person Stefans darstellen und die Situation zum Zeitpunkt seines Regierungsantritts skizzieren. Darüber hinaus möchte ich auf die Rolle Bayerns im langwährenden Konflikt mit den Städten eingehen, das Verhältnis der Herzöge untereinander aufgreifen und die Beziehungen zum Nachbarn Österreich und auch zum Königshaus darstellen. Auch das in diesen Abschnitt fallende außenpolitische Engagement Stefans, besonders bezüglich Italiens und Frankreichs, soll knapp beschrieben werden.
In einem nächsten Abschnitt wird auf die Landesteilung von 1392, deren Ursachen, Umsetzung und Folgen eingegangen. Den Abschluß bildet die Zeit Stefans als Herzog von Oberbayern-Ingolstadt, seine Auseinandersetzung mit den Herzögen von Oberbayern- München, seine Abkehr von König Wenzel und seine Bestrebungen zur Wiedererlangung Tirols.
Zu guter Letzt möchte ich noch einige Gedanken hinsichtlich der Bewertung der Person Stefans III. und seiner Leistungen anstellen.
In Anbetracht des knapp bemessenen Umfangs der Arbeit habe ich darauf verzichtet, auf den Verwaltungsapparat unter Stefan III., wie er bei Inge Turtur-Rahn beschrieben wird, einzugehen. Turtur-Rahn beschreibt zwar ausführlich die Funktionen und Aufgaben der einzelnen Hofämter, beschreibt die Personen, welche diese Ämter unter Stefan innehatten, um jedoch erarbeiten zu können, inwieweit Stefan dieses Verwaltungssystem von seinen Vorgängern übernommen hat, inwieweit er es modifiziert oder umstrukturiert hat, bedürfte eines gründlichen Vergleichs zu den Verwaltungsapparaten der Vorgänger Stefans III, eine Aufgabe, die den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde.
2. Die „Jugend” Stefans III.
2.1. Die Person Stefans III.2
Stefan III. wurde um das Jahr 13373 alsältester Sohn von Herzog Stefan II. von Bayern und dessen erster Ehefrau Elisabeth von Sizilien geboren. Ebenfalls dieser Ehe entstammten 1339 und 1341 Stefans Brüder Friedrich4 und Johann II.5 die späteren Herzöge von Niederbayern bzw. Oberbayern-München, wie auch die 1338 geborene Agnes, die spätere Gemahlin König Jacobs von Cypern6.
1364 heiratete Stefan III. Thadäa Visconti, die Tochter des Herrschers über Mailand, Signore Barnaba Visconti und dessen Frau Beatrix. Aus der Ehe mit Thadäa gingen zwei Nachkommen hervor: Ludwig VII. auch „Der Bärtige” genannt wird 1368 geboren, Elisabeth, bekannt als Isabeau de Bavière, kommt 1371 zur Welt.
20 Jahre nach dem Tod Thadäas 1381 heiratet Stefan im Jahr 1401 die 40 Jahre jüngere Elisabeth von Kleve.
Am 26. September 1413 stirbt Herzog Stefan III. 76jährig in Niederschönfeld bei Donauwörth, seine Grabstätte befindet sich in der Liebfrauenkirche zu Ingolstadt. Über den Charakter Stefans schreibt Füetrer folgendes:
„Item hertzog Steffan war ainer klainen person des leibs, aber des hertzen und seins muets vast gross. Er diente gern zu willen den schönen frawen und suecht all höf der turnay mit großer kostung. Des kam er zu dem jüngsten in vast grosse schuld. [...] Dieser hertzog Steffan was allzeit mit seinem wesen kostlich und wol geputzt; umb das nant in yederman den hertzog Kneyssl.”7
Daß Stefan, wie in sämtlichen Quellen berichtet, ständig in Geldnot war, mag auf den ersten Blick nicht sonderlich verwundern, da Geldknappheit wohl ein Merkmal der meisten Fürsten seiner Zeit war. Jedoch muß in diesem Zusammenhang betont werden, daß die finanziellen Voraussetzungen für Stefans Herrschaft eigentlichäußerst günstig gewesen wären. Bayern hatte für die Abtretung Tirols (1369) und Brandenburgs (1373) die enorme Summe von ungefähr einer halben Millionen Gulden in bar und in Schuldverschreibungen erhalten. Die Höhe der Mitgift Thadäas kann zwar nicht zweifelsfrei beziffert werden, doch mit Sicherheit handelte es sich hier um eine nicht unwesentliche Summe.8 Zu guter Letzt verfügte Stefan über die Verheiratung seiner Tochter Elisabeth mit dem König von Frankreich über exzellente Verbindungen zum französischen Hof, welche er mindestens in einem belegten Fall zu seinem finanziellen Vorteil zu nutzen wußte.9
Ein Grund für seine finanziellen Nöte war mit Sicherheit Stefans prunkvoller Lebensstil, welcher sich in seiner Kleidung, der Ausrichtung von zahlreichen Turnieren und der Vorliebe zu großen Festlichkeitenäußerte, was ihm, wie schon erwähnt den Beinamen „Der Kneisel” (der Prachtliebende) einbrachte. Den Grund für Stefans Prunksucht sieht Riezler darin, daß Stefan durch seine Heirat schon in jungen Jahren einen tieferen Einblick in die verhältnismäßig prächtigen Herrschaftsgebaren der norditalienischen Höfe gewann.10
Jedoch war es wohl ein anderer Faktor, der Stefans Kassen immer größere finanzielle Mittel abverlangte. Wie kaum einer seiner Zeitgenossen war Stefan voll und ganz dem Kriegshandwerk verfallen. Stefan führt fast ohne Unterbrechung sein Leben lang Krieg. Hierzu schreibt Riezler:
„Dem unruhigen Stefan galt kriegerische Kraftentfaltung als unerläßlich, bei ihm erscheint sie fast ebenso sehr als Selbstzweck oder als finanzielles Hilfsmittel, als daß ein tatsächliches oder vermeintes Staatsinteresse ihn zu den Waffen gerufen hätte. Es erinnert an die Gefolgsherren der Urzeit, wie er mit seinen Rittern und Reisigen, selten mehr als ein paar hundert Pferden, überall hinzog wo Ruhm und Ehre lockten.”11 Charakteristisch für Stefan war, daß er nicht nur Krieg führen ließ, wie dies allmählich immer üblicher wurde, sondern bis ins hohe Alter auf den meisten Kriegszügen selbst mit seinen Truppen ins Feld ritt. Dies brachte ihm einen weiteren Beinamen, nämlich den des „Tapferen” ein. Stefan stellte gewissermaßen die Verkörperung des ritterlichen Menschenbildes dar und wurde auch von seinen Zeitgenossen als dieses gesehen.
2.2. Stefan III. bis zum Tod Stefans II. 1375
Aus Stefans Jugendjahren gibt es wenig Greifbares zu berichten. Erstes wichtiges Ereignis dieser Phase stellte wohl seine Heirat mit Thadäa Visconti 1364 dar. Neben der in Stefan angefachten Liebe zu Prunk und Glanz, kann man wohl annehmen, daß diese Verbindung wohl auch Auslöser für Stefans wachsendes Interesse für die italienische Politik, insbesondere hinsichtlich eigener Erwerbungen in Italien war.
Stefans Leben bis zum Tode seines Vaters ist in erster Linie von militärischen Unternehmungen geprägt. 1362-1369 nimmt er an den Kämpfen um Tirol, 1371-1373 an jenen um Brandenburg teil. 1372 beteiligt sich Stefan in Litauen an einem Kreuzzug gegen die Slaven.12 Zum ersten Mal wird Stefans „italienisches Interesse” offenbar als er sich 1374 Herzog Leopold von Österreich verpflichtete, diesen gegen Venedig zu unterstützen. Im Gegenzug verspricht Leopold Stefan Unterstützung bei einem Vorgehen gegen Verona, einer Rivalin Mailands.13 Im darauffolgenden Jahr kommen Stefan und sein Bruder Friedrich einem Hilfeersuchen Leopolds nach, ihn gegen den aufrührerischen Enguerrand von Couch zu unterstützen, welcher im Elsaß mit Hilfe englischer Söldner seine Erbansprüche gewaltsam durchsetzen wollte.14 Diese Unterstützung des Habsburgers zeigt, daß Stefan gern gewillt war, sich als Söldner in den Dienst anderer zu stellen (Habsburg war schließlich alles andere als ein natürlicher Verbündeter Bayerns, dem es in mißlichen Situationen zu helfen galt). Diese Bereitschaft „den Sold zu nehmen” zeigt sich 1377 wiederholt sehr deutlich. Stefan, zu diesem Zeitpunkt schon regierender Herzog, leistet im Bischofsstreit zu Mainz Adolf von Nassau militärische Unterstützung gegen Ludwig von Meißen und fordert anschließend für seine Dienste 5500 Gulden für die geleistete Kriegshilfe.15
2.3. Die Lage in Bayern 1375
Am 19. Mai 1375 stirbt Stefan II. 56jährig. Er hinterläßt seinen Erben ein Territorium, welches in den Jahren seiner Regentschaft erheblichen Veränderungen unterworfen war. Unter Stefan II. hatte Bayern erhebliche Gebietsverluste hinnehmen müssen. Seit 1362 war es mit Habsburg zu ständigen Auseinandersetzungen um Tirol gekommen, welches sich zu diesem Zeitpunkt in bayerischen Besitz befand. 1364 hatte Kaiser Karl IV. Habsburg mit Tirol belehnt. In der Folge konnte Bayern seine Ansprüche auch durch Einsatz militärischer Mittel nicht durchsetzen. Nach sieben Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen muß Stefan II. seinen Anspruch aufgeben und verzichtet am 29. September im Frieden von Schärding auf Tirol. Als Ausgleich zahlt Österreich eine Entschädigung deren Höhe sich zwischen 116.00016 und 254.00017 Gulden belief.
Etwas später sollten auch die bayerischen Besitzungen in Brandenburg verlorengehen.18 Die 1362 von Stefan II. durchgeführte Einigung Ober-und Niederbayerns hatte zur Folge, daß sich Ludwig VI., der Römer, wittelsbachischer Herzog in Brandenburg, um seinen Anteil betrogen sah und sich den Gegnern Stefans, dem Kaiser und Habsburg annäherte. Ludwig ging sogar soweit, daß er 1363 im Nürnberger Erbvertrag den zweijährigen Sohn Kaiser Karls, Wenzel zu seinem Nachfolger bestimmte. Nach dem Tod Ludwigs VI. 1365 wird der durch Heirat an ans Kaiserhaus gebundene Otto V., der Faule, Herrscher über Brandenburg. Zunehmende Zerstückelung des Landes (Otto verkauft Karl große Teile Brandenburgs, 1367 beispielsweise die Lausitz) und zunehmende Verschuldung führen 1368 zu einer Rebellion der Landstände gegen Otto. Als Otto die Absichten des Kaisers, nämlich die Gewinnung der Mark Brandenburg erkennt, setzt er 1371 Friedrich, den Sohn Stefans II. zu seinem Erben ein. Der Kaiser geht in der Folge militärisch gegen Brandenburg vor, welches von Bayern unterstützt wird. Im Frieden von Fürstenwalde schließlich tritt Wittelsbach 1373 die Mark an Luxemburg ab. Als Ausgleich werden 200.000 Gulden in bar und 100.000 Gulden in Form von Schuldverschreibungen gezahlt. Otto V. erhält als Ersatz für Brandenburg das sog. „Neuböhmen” in der Oberpfalz und behält darüber hinaus die brandenburgische Kurstimme. Den territorialen Verlusten unter Stefans Herrschaft steht die von ihm durchgeführte Wiedervereinigung Ober-und Niederbayerns von 1362 gegenüber. Stefan II. hatte zwar umfangreiche territoriale Besitzungen verloren, hinterließ jedoch seinen Nachfolgern ein geschlossenes, homogenes Herrschaftsgebiet.19 Es umfaßte Oberbayern mit den Mittelpunkten München und Ingolstadt, Niederbayern mit Landshut, „Neuböhmen”, eine Reihe schwäbischer Herrschaften und Städte und darüber hinaus die wirtschaftlich besonders einträglichen Ämter Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg. Auch sollte nicht vergessen werden, daß sich der Verlust Tirols und Brandenburgs aus finanzieller Sicht überaus positiv für Wittelsbach ausgewirkt hatte.
Der Frieden von Fürstenwalde führte darüber hinaus zu einer völligen Aussöhnung mit dem Kaiserhaus Luxemburg, die sich darinäußerte, daß Stefan III. und Friedrich 1374 die 1347 verlorengegangenen Reichsvogteien Elsaß und Oberschwaben zum Lehen erhalten.20 Im Gegenzug wird am 10. Juni 1376 Karls Sohn Wenzel mit Hilfe beider wittelsbachischen Kurstimmen, derer Brandenburgs und der Pfalz, in Frankfurt zum König gewählt. Das Ende des Gegensatzes zum Kaiserhaus ermöglichte es Bayern sich nach langer Abstinenz wieder aktiv an der Reichspolitik zu beteiligen.
Aufgewachsen in einem geteilten Bayern erkennen die Nachfolger Stefans II. schnell die Bedeutung eines politisch und territorial geeinten Bayerns. So wird am 29. November 1375 in Burghausen durch Stefan III. Friedrich und Johann II. die Aufrechterhaltung eben dieser territorialen und politischen Einheit beschlossen. Auch Otto V. ist bereit, seinen Landesteil einem geeinten Bayern beizusteuern. Am 24. März 1376 werden folgende Formalia hinsichtlich einer gemeinsamen Regierung beschlossen: Bayern wird in zwei Verwaltungsbezirke aufgegliedert.21 Der oberbayerische Teil wird von Johann II. und Stefan III. regiert, während der niederbayerische Landesteil an Otto V. und Friedrich geht. Es ist geplant, die Herrschaft über die beiden Landesteile in einem zweijährigen Zyklus zu wechseln. Zu einem solchen Wechsel sollte es jedoch nie kommen und nach Ottos Tod 1379 ist die hier beschlossene Verwaltungsteilung in Hinblick auf eine gerechte Aufteilung ohnehin hinfällig.
3. Bayern bis zur 3. Bayerischen Landesteilung 1392
3.1. Der Städtekrieg 1376- 1389
Stefans frühe Regierungszeit wurde besonders von einem politischen Ereignis bestimmt, dem Ausbruch der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und den immer mehr nach Selbständigkeit strebenden Städten. Die Gründe für diesen Konflikt sind zu vielschichtig, als daß sie hier in der zu Gebote stehenden Kürze sämtliche dargelegt werden könnten, doch als Auslöser für die Erhebung der Städte zu diesem Zeitpunkt lassen sich einige Faktoren klar bestimmen. Zum einen hatte Karl IV. in Bedarf größerer finanzieller Mittel, wie sie beispielsweise zur Auszahlung der Entschädigungszahlungen für Brandenburg oder zum Anlaß von Wenzels Königswahl anfielen, die anfallenden Kosten durch hohe Sonderbesteuerung der Städte zu kompensieren versucht.
Noch schwerer wog wohl die Tatsache, daß Karl zur Durchsetzung seiner politischen Ziel wiederholt Reichsstädte gegen deren Willen an Dritte verpfändete.22
Der wachsende Unmut der Städte hatte zur Folge, daß sich am 4. Juli 1376 vierzehn schwäbische Städte unter der Führung Ulms zum Schwäbischen Städtebund gegen den Kaiser zusammenschlossen.
In ihrer Funktion als schwäbische Landvögte verhielten sich die bayerischen Herzöge Stefan und Friedrich zu Beginn des Konflikts noch neutral und versuchten zu vermitteln. So ist es vor allem ihrer Initiative zu verdanken, daß es am 9. Oktober vor Ulm, welches Karl schon belagerte, noch einmal zu einem Waffenstillstand zwischen Kaiser und Städtebund kam. Doch schon am 28. Oktober als Karl Bayern und Württemberg in der Person des Grafen Eberhard mit der Weiterführung des Krieges gegen die Städte beauftragt, ist es vor allem Stefan, der nun aktiv gegen die Städte vorgeht23. Um Weihnachten 1376 erleidet Stefan bei Alpeck nördlich von Ulm eine Niederlage gegen den Städtebund, welche zwar weniger von taktischer Bedeutung, jedoch aufgrund der Tatsache, daß Stefan sein Banner an die Ulmer verlor, ziemlich peinlich für den Herzog war.24 Nicht besser ergeht es Eberhard von Württemberg, der am 14. Mai des folgenden Jahres eine schwere Niederlage bei Reutlingen erleidet. Friedrich, welcher, wie auch die übrigen bayerischen Herzöge vorerst von militärischen Aktionen gegen die Städte Abstand genommen hatte gelingt es schließlich seinen kriegerischen Bruder davon zu überzeugen, daß im Städtekrieg für ihn nichts zu gewinnen sei. So geschieht es auch auf Friedrichs vermittelnde Initiativen in, daß Wenzel, von Karl IV. bevollmächtigt, am 31. Mai 1377 in Rothenburg mit den Städten Frieden schließt.25 Der Schwäbische Städtebund wird hierbei zwar nicht offiziell anerkannt, jedoch wird die zuvor verhängte Reichsacht gegen ihn aufgehoben. Für seine vermittelnden Verdienste wird Friedrich im August vom Kaiser mit den Landvogteien in Niederschwaben bedacht, welche dieser mit Stefan zusammen verwaltet26.
Das Modell des Städtebundes hatte sich bewährt. Zwar war man nicht offiziell anerkannt, hatte aber in Rothenburg praktisch eine Duldung des Bundes durchgesetzt. Immer mehr Städte schlossen sich in der Folgezeit dem Schwäbischen Städtebund an, so daß er bald auf 31 Mitglieder angewachsen war.27 Im Februar 1378 schließen sich sogar kurzfristig die österreichischen Herzöge an. Das Stärkepotential der Städte wuchs gewaltig als sich 1381 der neugegründete Rheinische Städtebund mit den Schwäbischen zur sog. Heidelberger Stallung verband.28
Trotz des Friedens von 1377 kehrte man bis 1379 zum allmählichen Spannungsverhältnis zwischen Städten und Fürsten zurück.
Zum Ausbruch kommt der Konflikt erneut als es 1381 zwischen den bayerischen Herzögen und der Stadt Regensburg zum Streit wegen der geplanten Eiführung einer außerordentlichen Judenbesteuerung kam. Die Stadt sah in einem solchen Plan der Herzöge, und dies wohl auch nicht ganz zu Unrecht, einen direkten Angriff auf Handel und Wirtschaft der Stadt. Der Städtebund nimmt am 2. September Regensburg in seine Reihen auf und schließlich gehen auch Augsburg und Nürnberg zum Bund.29
Der im Frühjahr 1383 in Nürnberg stattfindende Reichstag muß so auch im Zusammenhang mit eben erwähnten Ereignissen gesehen werden. Zwar ging es hier vordergründig um die Einrichtung eines neuen Landesfriedens, zu dessen Umsetzung das Reich in vier Partien unterteilt wurde, doch war dieses Treffen in erster Linie ein klares Signal an die Städte, welches Einmütigkeit und Geschlossenheit demonstrieren sollte. So spricht man in diesem Zusammenhang auch vom Nürnberger Herrenbund.30
Anfang 1384 versucht Wenzel vermittelnd im Konflikt zwischen bayerischen Herzögen und Städten zu intervenieren, konnte jedoch nicht mehr als einen sehr unsicheren Waffenstillstand herbeiführen. Die bayerischen Herzöge, vor allem Stefan und Friedrich scheinen für einen großen Schlagabtausch mit den Städten bereit zu sein.31 Während Stefan vor allem mit Augsburg im Händel liegt, konzentrieren sich Friedrichs Ambitionen besonders auf Regensburg. Ziel der Herzöge ist es, die wirtschaftliche Grundlage dieser Städte, den Handel zu zerstören. So kommt es immer wieder zu Scharmützeln und Überfällen, Waren der Städte werden auf bayerischem Boden als Kriegsbeute konfisziert. Eine größere militärische Auseinandersetzung scheint unvermeidlich.32
Als sich jedoch die Nachricht vom Untergang und Tod Leopolds von Österreich im Reich verbreitet, ist die Kampflust der bayerischen Herzöge bald gezügelt. Herzog Leopold von Österreich hatte gegen den sich auflehnenden Eidgenössischen Städtebund im Frühjahr 1386 eine militärische Entscheidung gesucht, eine verheerende Niederlage erlitten und dabei selbst den Tod gefunden.
Unter Leitung Friedrichs kommt es im August 1386 zu einer Versammlung von Fürsten und Vertretern der Städte in Mergentheim. Ziel ist es, zu einem Ausgleich zu kommen. Stefan jedoch setzt seine kriegerische Politik gegen Augsburg fort und untergräbt so jegliche Friedensbemühungen. Bevor es schließlich zum Auszug des Städteheeres gegen Stefan kommt, welcher für den 18. November festgesetzt ist33, gelingt es Friedrich noch einmal zwischen Augsburg und Stefan zu vermitteln. Wieder scheint es als wäre die Gefahr eines eskalierenden Städtekrieges gebannt, doch der Friede währt nur kurz.
Am 25. Juli 1387 schließt Bischof Pilgrim von Salzburg im Geheimen ein Bündnis mit den Städten.34 Diese Verbindung des „natürlichen Feindes Bayerns”, Salzburg mit den Städten war tatsächlich in erster Linie auch gegen Bayern gerichtet. So verpflichtete man sich auch dann zur gegenseitigen Bündnishilfe, wenn ein Wittelsbacher zum Reichsverweser erhoben werden sollte (seit Juni kursierten Gerüchte, die Fürsten wollen den schwachen Wenzel absetzen und Friedrich mit den Regierungsgeschäften beauftragen). Auch geostrategisch stellte ein solches Bündnis für Bayern eine ersthafte Bedrohung dar, da es nun im Norden Westen und Südosten vom Feinden umklammert war. Lange Zeit jedoch wissen die bayerischen Herzöge nichts von diesem Zusammenschluß ihrer Feinde. So nehmen sie noch am 5. November 1383 an einer Fürstenversammlung in Mergentheim teil, wo eine Verlängerung des Bündnisvertrages von 1383 beschlossen wird. Unter anderem wird in diesem Vertrag Salzburg als Gegner des Bundes ausgenommen, ein Sachverhalt, den die bayerischen Herzöge bei Kenntnis eines Bündnisses zwischen Salzburg und den Städten nie akzeptiert hätten.
Schließlich jedoch werden die Wittelsbacher um die Jahreswende hinsichtlich des Bündnisses in Kenntnis gesetzt. Die Art und das Ausmaß der Bedrohung durch die Umklammerung waren es wohl, die den sonst eher besonnenen Friedrich zu drastischen Maßnamen greifen ließen. Während er versucht mit einer Oppositionsgruppe in Salzburger Domkapitel in Kontakt zu treten, lädt Stefan Bischof Pilgrim zu Verhandlungen ins Kloster Raitenhaslach. Pilgrim kommt dieser Einladung nach und erscheint Anfang des Jahres 1388 mit 34 Begleitern in besagtem Kloster. Nachdem nun auch Friedrich hinzukommt und beide Herzöge beginnen, den Bischof zu verhören wird Pilgrim mitsamt Begleitern kurzer Hand gefangengenommen und nach Burghausen verbracht.
Hätten Friedrich und Stefan um die Folgen ihres Handelns gewußt, hätten sie wahrscheinlich von der unklugen Gefangennahme Pilgrims abgesehen. Während man den vom Salzburger Domkapitel ausgesprochenen Bann noch gelassen hinnehmen konnte, so beschwor der entführerische Akt der Herzöge eine Reihe von Reaktionen hervor, angesichts derer sie bald die Gefangennahme des Bischofs bereuen sollten. Schon am 1. Januar 1388 rief Papst Urban VI. den deutschen König, die Fürsten und die Bischöfe auf, Pilgrim zur Hilfe zu eilen.35 Die Folge dieses Aufrufs ist, daß der schwache Wenzel, welcher am 8. Januar den Reichskrieg gegen Bayern anordnet. Es ist nicht verwunderlich, daß die Städtebünde die ersten sind, welche der Aufforderung des Königs am schnellsten Folge leisten. Nachdem am 17. Januar der Schwäbische und am 20. Januar der Rheinische Städtebund Bayern den Krieg erklärt hatte, bricht schon am 25. Januar das Bundesheer unter Graf Heinrich von Montfort von Augsburg aus gegen Bayern auf.36 Das Heer verwüstet die Gegend um Landsberg, zieht sengend und brennend nach Regensburg. Der Zug zurück nach Ulm an der Donau entlang verläuft ohne Feindkontakt.
Unter dem Eindruck des militärischen Drucks von außen sah man sich in Bayern gezwungen, Bischof Pilgrim noch im Januar freizulassen. Vor seiner Freilassung jedoch mußte sich Pilgrim unter Eid dazu verpflichten, eine Reihe von kaum realisierbaren Bedingungen zu erfüllen. Die bayerischen Herzöge forderten vom Salzburger neben hohen Geldzahlungen und der Auflösung des Bundes mit den Städten, keine Revanche für begangenes Unrecht gegenüber Bayern anzustreben. Nachdem das Salzburger Domkapitel die Forderungen, wie nicht anders zu erwarten, abgelehnt hatte, begab sich Pilgrim mitsamt seinen 34 Begleitern schon im März wieder in bayerische Gefangenschaft.
Wenzel, welchem man im Januar nur von Pilgrims Freilassung, nicht aber von den daran geknüpften Bedingungen berichtete hatte, hatte in der Zwischenzeit die Städte von einem Krieg mit Bayern abgemahnt, jedoch bereits am 7. Februar, nachdem die „bayerische Täuschung” aufgeflogen war, erneut den Reichskrieg erklärt.
Besonders schlimm muß die bayerischen Herzöge getroffen haben, daß sich nun auch einige ihrer eigenen Lehnsleute mit den Städten verbündeten. In diesem Zusammenhang sind Wilhelm von Seefeld, der sich mit Augsburg verbündete und das Geschlecht der Zenger, die eine Verbindung mit Regensburg eingingen, zu nennen.37
Es ist in erster Linie Stefan, der gegen die „Verräter” vorgeht. Am 24. Januar beginnt er mit der Belagerung Peißenbergs, der Burg des Seefelders, welche er am 29. Januar einnimmt und zerstört. Nach der erfolglosen Belagerung Neuburgs an der Donau, welches zu Regensburg gehört und von Otto dem Zenger verteidigt wird, kommt es am 3. März in Nürnberg zu Friedensverhandlungen.
Zur Schlichtung einigt man sich darauf, Ruprecht von der Pfalz als Schiedsrichter einzusetzen. Darüber hinaus verpflichtet sich Bayern Pilgrim endgültig freizulassen und das Bündnis mit Salzburg von 138238 zu erneuern. Der Salzburger Bischof wird daraufhin am 15. März tatsächlich freigelassen und seines Eides entbunden. Der Grund, daß die bayerischen Herzöge nun einlenkten, ist wohl hauptsächlich im wachsenden Druck weniger von Seiten der Städte, sondern seitens des Papstes, des Königs und einer großen Anzahl der Reichsfürsten zu sehen.
Während man mit Salzburg und dem Reich zumindest formell Frieden geschlossen hatte, zog sich der Krieg gegen die Städte weiter hin. Mit seinem Rückzug nach Prag hatte Wenzel klar gemacht, daß er nicht mehr im Konflikt intervenieren wollte.
Im Laufe des Sommer entwickelt sich die Auseinandersetzung immer ungünstiger für die bayerischen Herzöge, was dazu führt, daß immer mehr Fürsten auf der Seite Bayerns in den Krieg eintraten. In diesem Zusammenhang seien genannt: Kurfürst Ruprecht II. von der Pfalz, der Burggraf von Nürnberg, Albrecht II. von Niederbayern-Straubing, Eberhard von Württemberg und die Bischöfe von Augsburg und Würzburg.39
Zur bedeutendsten Schlacht des Krieges kommt es am 23. August 1388 als Eberhard von Württemberg bei Döffingen ein schwäbisches Heer entscheidend schlägt. Anfang September vereinen sieben bayerische und pfälzische Herzöge ihre Kräfte, um Regensburg zu belagern.40 Die Lage für Bayern verschärft sich wieder als am 19. Oktober der auf Rache sinnende Pilgrim trotz Aufforderung zur Neutralität durch Wenzel, Bayern den Krieg erklärt. Nun war genau das eingetreten, was Friedrich und Stefan im Jahr zuvor durch die Gefangensetzung Pilgrims zu verhindern gesucht hatten, eine Umschließung Bayerns durch kriegsbereite Feinde. Friedrich begibt sich nun zu Wenzel nach Prag, um über einen Frieden zu verhandeln. Regensburg kann trotz des großen wittelsbachischen Engagements nicht genommen werden, vielmehr gelingt es der Bürgerschaft am 13. November unter Parzival Zenger, den Herzögen einen schwere Niederlage beizubringen. Friedrichs Gang nach Prag bewirkt, daß sich Pilgrim am 8. Dezember 1388 schließlich der Aufforderung des Königs beugt, die Waffen niederzulegen.41
Seinen endgültigen Abschluß fand der Städtekrieg im Landtag zu Eger im Mai 1389. Die Auflösung der Städtebünde, welche von Wenzel am 2. Mai befohlen wird, geht ohne große Probleme vonstatten. Die Städte waren einerseits kriegsmüde und andererseits hatte die Belagerung Regensburgs, welches während der Belagerung durch die Wittelsbacher kaum Unterstützung von außen erhalten hatte, gezeigt, daß es mit dem Zusammenhalt des Bundes doch nicht so weit her war.42
Am 6. Mai schließlich wir eine neue auf sechs Jahre befristete Landfriedensordnung verabschiedet, zu dessen Vollzieher und Hüter Herzog Friedrich von Bayern bestimmt wird. In der Folgezeit schließen die Herzöge Frieden mit den einzelnen Städten.43 Einen Sieger im Ausgang des Städtekrieges zu erkennen istäußerst schwierig. Militärisch hatte sich keine der Parteien durchsetzen können. Die größten Vorteile aus dem Ausgang des Konflikts hatte wahrscheinlich Friedrich gezogen. Durch seine vermittelnde Initiative im Herbst 1388 und auch die Tatsache, daß es ihm gelang mit Sophia, der 13jährigen Tochter Herzog Johanns eine Wittelsbacherin zur Frau zu nehmen44, gelang es Friedrich, die Bindung Bayerns zum Königshaus zu festigen. Wohl diesem Umstand ist es zu verdanken, daß es Friedrich war, welcher zum Hauptmann des Landesfriedens eingesetzt wurde.
3.2. Stefans III. Verhältnis zu den Brüdern
3.2.1. Johann II.
Johann II., jüngster Sohn Stefans II., war seit 1376 zusammen mit Stefan mit der gemeinsamen Verwaltung Oberbayerns betraut worden. Johann jedoch tritt völlig hinter seinemälteren Bruder zurück. Im Gegensatz zu Stefan ist Johann von einem ruhigen, besonnenen Temperament. In den unruhigen 70ger, 80ger und 90ger Jahren unterstützt er seine Brüder zwar in militärischen Unternehmungen, doch hat das Kriegshandwerk bei ihm lange nicht den hohen Stellenwert, den es bei Stefan oder auch bei Friedrich hat. Johanns Leben ist vor allem von seiner Frömmigkeit und seiner Liebe zur Jagd gekennzeichnet. Arnpeck sagt über ihn:
„Auf seinen Jagdschlössern um München hausend, ließ Johann die Falken steigen oder im Dickicht der Forsten den Hirsch aufstöbern, Gott jeden Morgen dankend, daß er nicht brauchte fürs römische Reich zu sorgen; er ward genannt der frumm und einfältig Herzog.”45
Seine Enthaltsamkeit steht im Gegensatz zur Verschwendungssucht seiner Brüder. Wenig begeistert ist Johann auch von den Ambitionen seiner Brüder im Ausland, vor allem Stefans kostspielige und kaum einträgliche Italienpolitk sei hier genannt. Vor allem Stefan scheint Johanns Untätigkeit als Schwäche gedeutet zu haben, was dazu führte, daß Johann als er, nicht mehr Willens die Unternehmungen seines Bruders mitzufinanzieren, 1392 leichtes Spiel hatte, die Initiative an sich zu reißen und die 3. große Landesteilung durchzusetzen. Der Bayerische Hauskrieg von 1394/95 sollte zeigen, daß Johann durchaus gewillt und fähig war, seine politischen Ziele, auch gegen seine Brüder, mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Als eigentlichen Auslöser für den plötzlichen Aktionismus Johanns sieht Joseph Maria Mayer des Herzogs Heirat mit Katharina von Görz im Jahre 1365. Zum einen war die ehrgeizige Herzogin wenig von Johanns bescheidener Zurückhaltung angetan, so daß sie ihn wohl immer wieder auf die Durchsetzung seiner eigenen Interessen drängte. Johann ist gezwungen seine Passivität schließlich endgültig aufgeben als er erkennen muß, daß es drastischer Maßnahmen bedarf, das Erbe seiner Söhne Ernst und Wilhelm III. zu erhalten.46
3.2.2. Friedrich
Gänzlich anders als das Verhältnis Stefans zu Johann stellte sich jenes zu Friedrich dar. War es Stefan II. Wunsch gewesen die Brüder sollten gemeinsam regieren, so wurde dies, zumindest was Stefan III. und Friedrich betrifft, auch umgesetzt. Bis zur Landesteilung von 1392 regierten die beiden Herzöge Bayern ohne daß es jemals zu einem ernsthaften Konflikt zwischen den beiden kam. Die Vereinbarungen zwischen den beiden Herzögen von 1384 und 139047, welche die politische Ungeteiltheit Bayerns bekräftigten, zeigen, daß sie bereit waren, auch langfristig an einer gemeinsamen Machtausübung festzuhalten. Friedrich wird von allen Autoren als der intelligenteste beschrieben. Den politischen etwas unbeholfenen Stefan vor Augen möchte man so schnell zur Schlußfolgerung gelangen, Friedrich hätte sich der Persons Stefans bedient als einer Art Marionette und versucht durch ihn seine Ziele durchzusetzen. Doch wie ich es auch in meiner Schlußbewertung sagen werde, glaube ich nicht, daß Stefan so wenig Verstand besaß, als daß er sich von Friedrich als eine Art willenloses Werkzeug hätte mißbrauchen lassen, vielmehr sehe ich das Verhältnis Stefan- Friedrich geprägt von gegenseitiger Achtung, Anerkennung und Loyalität. Wenn Friedrich auch der umsichtigere gewesen sein mag, so schätzte er sicher die Art seines Bruders, wie er kompromißlos und geradlinig seinen Zielen nachging. In der schweren Zeit der Städtekriege erwies sich das bayerische Herzogenduo alsäußerst schlagkräftig. Während der eine noch im Felde stand, konnte der andere diplomatisch tätig werden. Wenn Stefan auch kein genialer Stratege und Taktiker war, so war er doch im Reich wohl einer der fähigsten Militärs. Gerade in Zeiten, da Bayern von mehreren Seiten zugleich bedroht war, erwies sich die Doppelspitze alsäußerst vorteilhaft.
Stefans Loyalität zu Friedrich zeigt sich auch darin, daß er nie Anspruch auf Niederbayerische Gebiete erhoben hat, auch nicht nach dem Tod Friedrichs. Zwar war dies auch im Teilungsvertrag von 1392 so vereinbart worden, doch zeigt Stefans skrupellose Bestrebung nach Johanns Tod sich sofort ganz Oberbayerns zu bemächtigen, daß Stefan sich nicht sonderlich an den Vertrag gebunden fühlte, wenn es darum ging seine Macht zu mehren.
3.3. Das Verhältnis zum Königshaus bis 1392
Wie schon erwähnt, hatte sich Bayern 1374 nach dem Verlust Brandenburgs mit Luxemburg ausgesöhnt, was dazu führte, daß Wenzel mit Hilfe der wittelsbachischen Kurstimmen 1376 zum König gewählt wurde. Das gute Verhältnis zu Luxemburg wird jedoch nach dem Tod Kaiser Karls IV. am 29. September 1378 in eine tiefe Krise gestürzt, nachdem Wenzel am 25. Februar 1379 die nieder- und oberschwäbischen Landvogteien, Augsburg und Giengen an Leopold III. von Österreich verpfändet. Ziel dieser Verpfändung sah Wenzel darin, sich der bis dahin ausgebliebenen Anerkennung seines Königtums durch Österreich zu versichern. Dies sollte sich jedoch als schwerer Fehler herausstellen. Besagte Vogteien waren erst am 8. Februar Friedrich von Bayern auf drei weitere Jahre bestätigt worden. Nicht nur die bayerischen Herzöge sehen sich verraten sondern auch die Städte, denen Karl IV. noch versprochen hatte von zukünftigen Verpfändungen abzusehen. Die Folge war, daß Bayern am
4. Juli 1379 dem Schwäbischen Städtebund beitrat.
Zum endgültigen Bruch kommt es jedoch nicht, da Wenzel48 die Signale aus Bayern richtig deutete und Friedrich die Vogteien beließ.49 Leopold wird in diesem Zusammenhang vom König durch einige Privilegien entschädigt.
Daß sich das Verhältnis zu Wenzel in der Folgezeit wieder verbesserte, läßt sich wohl am besten im Romzug Stefans von 1380 sehen. Hier setzt sich der bayerische Herzog aktiv für die Kaiserkrönung des Königs ein.
Zu einer erneuten Verschlechterung der Beziehungen kommt es 1388 als Wenzel als Reaktion auf die Ereignisse in Raitenhaslach den Reichskrieg gegen Bayern ausruft, doch schon im folgenden Jahr gelingt es Friedrich durch seine Vermittlung, sich nicht nur mit dem König auszusöhnen, sondern darüber hinaus dem Städtekrieg ein Ende zu setzen.
3.4. Bayern und Habsburg
In den zwei bedeutendsten Mächte im süddeutschen Raum standen sich in Wittelsbach und Habsburg zwei gewissermaßen „natürliche” Konkurrenten gegenüber. Im 14. Jhd. war es besonders der Besitz Tirols, welcher den ewigen Dualismus der beiden Kontrahenten immer wieder aufs neue entfachte. Der Verlust Tirols 1369 war von den bayerischen Herzögen nie gänzlich akzeptiert worden. Insbesondere Stefans späte Außenpolitik zeigt, wie wenig der Wittelsbacher bereit war, gänzlich auf Tirol zu verzichten. Auch können zeitweilige Annäherungen zwischen Bayern und Österreich, wie das Bündnis zwischen Stefan und Leopold 1374 oder der Nichtangriffspakt mit Albrecht III. von Ober- und Niederösterreich anläßlich der Verpfändung der schwäbischen Landvogteien an Albrechts Bruder 1379 (Albrecht hatte sich mit Leopold entzweit)50 nicht über den latenten Dualismus hinwegtäuschen.
Wie grundlegend der Gegensatz zwischen den Nachbarn war, wird nach dem Tod Stefans II. erstmals 1382 wieder offenbar. Im Streit um die Probsteinsetzung in Berchtesgaden gerät Friedrich an den Salzburger Bischof Pilgrim.51 Die vordergründige Zwistigkeit ist für beide Kontrahenten genug, um den ständigen Konflikt zwischen Salzburg und Niederbayern in Form einer militärischen Auseinandersetzung ausbrechen zu lassen. Österreich unterstützt von Anfang an ohne Vorbehalte die Sache Salzburgs, was dazu führt, daß die im April 1382 unter den bayerischen Herzögen im Berchtesgadener Land einmarschierenden Truppen bei Mühldorf und Berchtesgaden bald unter gewaltigen Druck der vereinten Salzburgischen und österreichischen Truppen geraten, was die Bayern am 5. Dezember 1382 schließlich an den Verhandlungstisch zwingt.52
Es scheint als könne man in diesen Friedensverhandlungen tatsächlich zu einem Ausgleich gelangen. Neben dem Beschluß für ein 10jähriges Bündnis der Achse Bayern-Salzburg- Österreich, welches wegen des akuten Gegensatzes zwischen Bayern und Salzburg von eher geringer Bedeutung war, schlossen sich Bayern und Österreich zu einem Schutz- und Trutzbündnis gegen die Städte zusammen.
Die Zukunft sollte jedoch zeigen, daß auch diese Annäherungsversuche auf längere Sicht ziemlich erfolglos war. Ab 1410 gipfelt der Gegensatz Habsburg-Wittelsbach erneut in einer längeren kriegerischen Auseinandersetzung als Stefan versucht, Tirol an sich zu reißen.
3.5. Die auswärtige Politik Stefans III.
3.5.1. Italien
Im Zuge seiner Bestrebungen, sein Königtum mit der Kaiserkrone zu vergolden, muß Wenzel nicht lange im Reich suchen, um einen geeigneten Fürsten zu finden, den er mit zur Aushandlung der Krönungsbedingungen zum Papst nach Rom schicken konnte. Der unternehmungslustige Stefan mit seinen exzellenten Beziehungen zu Mailand bot sich als idealer Kandidat an.
Im Frühjahr 1380 bricht Stefan nach Italien auf.53 Was genau er bei Papst Urban IV. erreichen kann, ist nicht bekannt, doch Gerüchten zufolge hat der Papst Wenzel durch Stefan den Befehl zukommen lassen, er solle sich im Frühjahr des folgenden Jahres zur Kaiserkrönung nach Rom begeben. Anstatt nach dem Treffen mit dem Papst nach Hause zu ziehen, zog Stefan es vor, sich im Herbst des Jahres 1380 vier Monate lang in den Dienst des Papstes zu stellen und diesen militärisch zu unterstützen. Unter anderem schlichtete er zu dieser Zeit einen Parteienstreit in der umbrischen Stadt Todi, worauf er vom dortigen Adel, Stadtrat und der Kommune zum neuen Herrscher erwählt wir. Diesem Beispiel schlossen sich kurz darauf auch die Nachbarstädte Acquasparta, Massa, Collemedion und Collazon an.54 Es erscheint überaus kurzsichtig von Stefan, eine solcherart angebotene Herrschaft überhaupt anzunehmen. Zum einen lagen diese Herrschaften weit von seinen Stammlanden entfernt, und zum anderen hätte ihm bewußt sein müssen, daß der päpstliche Stuhl wohl kaum gewillt sein konnte, auf diesen Besitz zu verzichten. So überträgt bereits Urbans Nachfolger Bonifaz IX. besagte Städte Malatesta von Rimini als seinem Statthalter. Zwar versucht Stefans Sohn Ludwig 1406 über seinen Anwalt Konrad Wolf die umbrischen Besitzungen wieder zu erlangen, doch waren diese Anstrengungen wenig erfolgreich.
Schon bald nach dem Ende des Ständekrieges findet der ruhelose Stefan ein neues scheinbar zukunftsträchtiges Betätigungsfeld.
1385 hatte Giangalezzo Visconti, Graf von Hertus und Herr von Pavia und Schwager Stefans die Herrschaft in Mailand gewaltsam an sich gerissen, seinen Onkel Barnabas Visconti gefangensetzen und im Kerker sterben lassen. In der Folgezeit vertreibt Giangalezzo das Geschlecht der Scala aus den Städten Verona und Viacenza. Er verbündet sich mit Venedig, vertreibt Franz von Carrara aus Padua und bedroht Bologna und Florenz.55 Die bedrängten Gegner Giangalezzos, die sog. „Viscontierben” wenden sich in ihrer Verzweiflung an Herzog Stefan und bitten ihn um Hilfe. Stefan ist durch seine Mailänder Verbindung in Oberitalien wohlbekannt, außerdem stellt er als Herzog von Bayern einen der mächtigsten Fürsten des Reiches dar.
Im Juni 1390 folgt Stefan bereitwillig dem Hilferuf der Viscontierben und zieht, begleitet von Ludwig mit über 3000 Reitern nach Oberitalien. Dort gelingt es ihm zwar, die Herrschaft des Franz von Carrara in Padua wieder einzurichten, auch schließt er ein vielversprechendes Bündnis mit Samaritana de Polenta, Vorstehende des Hauses Scala ab, welches zum Inhalt hat, daß Viacenza und Verona bei einer Wiedererlangung unter direkte Herrschaft Stefans und seine Nachfolger geraten sollten,56 doch gelingt es Stefan nicht, eben diese Städte zu erobern. Nachdem Stefan sich im Herbst des Jahres schließlich gezwungen sieht, sein Heer in Padua aufzulösen, soll er dort seinen Sold mit schönen Frauen in Saus und Braus durchgebracht haben.57
Anläßlich des Jubeljahres begibt sich Stefan nach Rom, wo er Papst Bonifaz IX. die militärische Unterstützung seines Schwiegersohnes, des Königs von Frankreich gegen den in Avignon residierenden Gegenpapst Clemens VII. versichert (im Zuge dieser Versicherung schickt Stefan Ludwig an den französischen Hof). Darüber hinaus soll Stefan beim Papst den Befehl erwirkt haben, in Bayern das tägliche Avemarialäuten, welches er in Rom lieben gelernt hatte, einzuführen.58
Anfang 1391 ist Stefan wieder in Bayern. Trotz des großen Engagements hatte er nicht viel ausrichten können. Giangalezzo war immer noch im Besitz Mailands, wie auch der Städte Verona und Viacenza
3.5.2. Frankreich
Während sich Stefans wiederholtes Engagement in Italien als wenig gewinnbringend für Bayern erweisen sollte, entwickelte er doch eine sehr geschickte Bündnispolitik mit Frankreich. 1385 vermählt Stefan seine 14jährige Tochter Elisabeth mit dem 17jährigen Karl IV. von Frankreich.59
Neben dem schon erwähnten finanziellen Aspekt konnte Stefan seine Verbindung zum französischen Hof dazu nutzen sie in der Reichspolitik immer wieder als Druckmittel einzusetzen. Um die Verbindung mit Frankreich zu bekräftigen,60 schickt Stefan 1391 seinen Sohn Ludwig für 5 Jahre an den französischen Hof (tatsächlich hält sich Ludwig dort bis 1393 auf).
Inwiefern Stefan mit diesem Handeln eine Mitschuld daran trägt, daß sich Ludwig allzu stark an den französischen Hof gebunden sieht, sei dahin gestellt. Fest steht, daß sich Ludwig vor und vor allem nach seinem Regierungsantritt in Oberbayern-Ingolstadt die meiste Zeit in Frankreich aufhält, dort zweimal heiratet61 und eigene Herrschaften aufbaut. Dies führt dazu, daß er sich völlig von seinen Vettern, den übrigen bayerischen Herzögen entfremdet, seine „französischen Hilfsmittel” völlig falsch einschätzt und so schließlich die völlige Isolation seines bayerischen Landesteils heraufbeschwört.
4. Die 3. Bayerischen Landesteilung
Johann hatte schon seit geraumer Zeit die verschwenderische Art seiner Brüder mit Mißmut beobachtet. Nicht nur ihren prunkvollen Lebensstil, sondern auch die kostspieligen Unternehmungen waren dem jüngsten Bruder immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Schon im Juni 1384 als die Herzöge nach dem Tod Ottos V. 1379 in Ingolstadt über eine Neuaufteilung der Verwaltungsbezirke verhandelten, wird sich Johann nicht mit seinen Brüdern einig. Es scheint, daß Johann schon damals auf eine Landesteilung bestanden hat. Um ihren Bruder unter Druck zu setzten beschließen Stefan und Friedrich am 31. Juli 1384 in Landshut, den ober- und niederbayerischen Landesteil zu vereinigen, einen gemeinsamen Rat einzusetzen und sich zu gegenseitigen Erben bei söhnelosem Tod einzusetzen.62 Johann sah sich nun vor die Wahl gestellt, entweder mit seinen Brüdern offen in Konflikt zu treten, denn eine solche Einigung hätte seine Ansprüche gänzlich übergangen oder sich zurück an den Verhandlungstisch zu begeben. Er tat letzteres, was seine Brüder durch die geplante Vereinigung wohl auch bezwecken wollten. Es ist unwahrscheinlich, daß sie tatsächlich eine Vereinigung der ober- und niederbayerischen Verwaltungsteile anstrebten. Am 10. Dezember 1384 beschließen die drei Brüder in Aichach eine Beibehaltung der Verhältnisse auf weitere drei Jahre.63
Im Februar 1390 sind es wiederholt Stefan und Friedrich, welche darauf bestehen die politische Ungeteiltheit Bayerns auf weitere sechs Jahre zu beschließen.64 Johann, der allmählich immer weniger bereit war zuzusehen wie seine Brüder, und von diesen beiden vor allem sein Mitregent Stefan, durch Prunksucht und wenig einträgliche auswärtige Unternehmungen Bayern zunehmend in finanzielle Nöte brachten, wagte im Herbst 1392 den entscheidenden Schritt in Richtung einer Aufteilung der bayerischen Lande. Am 21 September besetzt Johann Stefans Stützpunkt in München, die Neue Feste und vertreibt so gewissermaßen seinen Bruder aus München.65 Im folgenden Treffen der Herzöge am 18. Oktober gelangt Johann schließlich an sein Ziel und beschließt zusammen mit seinen Brüdern die Teilung. Bei diesem Treffen wird bereits beschlossen, daß Friedrich den niederbayerischen Landesteil (ohne Straubing) behalten und im Gegenzug dafür seine Brüder mit Ausgleichszahlungen entschädigen solle. 40 Räten aus dem Oberland (24 Ritter und 16 Bürger) wurde es übertragen, Oberbayern in zwei gleichwertige Teile aufzuteilen. Die Verteilung der Landesteile sollte schließlich durch das Los entschieden werden.
Am 19. November 1392 wird die endgültige Teilungsurkunde ausgestellt.66 Friedrich sollte, wie bereits vereinbart Niederbayern erhalten, seine Brüder jedoch durch Ausgleichszahlungen entschädigen.67
Johann erhielt mit der südlichen Hälfte Oberbayerns und einer Reihe Ämtern im Norden einen relativ geschlossenen Landesteil. Im Gegensatz dazu wurden Stefan mehrere Gebietszellen zugeteilt, welche verstreut im Alpen- und im Donauraum lagen. Als größtes zusammenhängendes Gebiet erhielt er den nordwestlichen Teil Oberbayerns mit der Hauptstadt Ingolstadt. Im Süden wurden Stefan die Ämter Rattenberg, Kitzbühel und Kufstein zugesprochen. Darüber hinaus erhielt er die zwischen Oberbayern-München und Niederbayern-Landshut gelegenen Herrschaften Wasserburg, Falkenberg und Kling und eine Anzahl schwäbischer Besitzungen längs der Donau.
Der Teilungsvertrag von 1392 enthielt darüber hinaus eine Reihe weiterer Vereinbarungen, welche das Zusammenleben der drei bayerischen Staaten regeln sollten. Man beteuerte die brüderliche Verbundenheit und schloß ein Bündnis gegen alle Angriffe von außen. Diesbezüglich wurde Albrecht von Niederbayern-Straubing explizit als potentieller Gegner genannt, gegen den ein gemeinsames Vorgehen beschlossen wurde für den Fall, er oder seine Nachkommen würden Ansprüche auf Oberbayern erheben. Ferner vereinbarte man, keinen „bedeutenden” Krieg ohne das Wissen und die Zustimmung der Brüder zu beginnen. Für den Fall des sohnlosen Todes setzte man sich gegenseitig zum Erben ein. Um den innerbayerischen Handel nicht zu behindern, wurde beschlossen, die Maut- und Straßenrechte so zu belassen wie bisher. Man verpflichtete sich dazu, im Falle eines geplanten Verkaufs von Ländereien diese immer zuerst den Brüdern zum Kauf anzubieten. Zu guter Letzt wurde im Vertrag festgehalten, daß die wichtigen Ämter der einzelnen Regierungen nicht an Ausländer vergeben werden durften. Diese letzte Vereinbarung stellte gewissermaßen ein Zugeständnis an die Landstände dar.
Die Schwächen des Teilungsvertrages liegen auf der Hand. Seine Hauptschwäche ist wohl die Tatsache, daß er überhaupt zustande kam. Es war zwar eine sich abzeichnende Auseinandersetzung zwischen den Brüdern vermieden worden, doch geschah dies zu einem hohen Preis: die von Stefan II. mühsam erkämpfte Geschlossenheit von Dynastie und Territorium war endgültig verloren. Eine weitere Schwäche des Vertrages war es, daß durch ihn die bayerischen Landesteile alles andere als gerecht verteilt wurden. Es wird auf den ersten Blick klar, daß Friedrich eindeutig übervorteilt worden ist, indem er ganz Niederbayern erhielt. Darüber hinaus hatten die 40 mit der Aufteilung Oberbayerns beauftragten Räte rein nach dem fiskalischen Wert der Gebiete geteilt. Strategische oder wirtschaftliche Gesichtspunkte wurden bei der Zusammenstellung der beiden Teile überhaupt nicht berücksichtigt. Leidtragender dieses Vorgehens war Stefan, dessen Besitzungen sich auf ganz Oberbayern verstreuten.
Die logische Folge war, daß Stefan sich zurecht benachteiligt fühlte und in der Folgezeit alles daran setzte, diesen Nachteil wieder auszugleichen. Der Vertrag scheiterte genau an dem Punkt, der eigentlich zu seiner Unterzeichnung geführt hatte. Anstatt das Konfliktpotential zwischen den Brüdern, wenn auch nicht gänzlich aus der Welt zu schaffen, so jedoch zumindest abschwächen, schuf er neuen Konfliktstoff, der sich in der Zukunft alsäußerst brisant erweisen sollte.
5. Oberbayern-Ingolstadt bis zum Tode Stefans III. 1413
5.1. Auseinandersetzungen mit Oberbayern-München
Schon kurz nach dem Abschluß des Vertrages wurden seine Schwächen auch auf politischer Ebene offenbar. Johann wie auch Friedrich werden sich rasch der Tatsache bewußt, daß der auf Ausgleich sinnende Stefan für sie eine Gefahr darstellen könne. Um einer solchen Bedrohung vorzubeugen, schließen sie neue Bündnisse. Johann verbündet sich mit Albrecht von Niederbayern-Straubing, Friedrich mit dem Bischof von Passau. Am 16. September 1393 kommt es schließlich zu einem Schutz und Trutz Bund zwischen Friedrich und Johann gegen Stefan.68 Mit diesen Verbindungen verstoßen Johann und Friedrich nur ein Jahr nach Abschluß klar gegen die Vereinbarung im Teilungsvertrag.
Seitens der Brüder gibt es jedoch auch Bestrebungen, die Benachteiligung Stefans zu mildern. Am 8. Oktober 1393, als die Hinterlassenschaften Ottos V., die böhmische Pfandschaften im Nordgau, aufgeteilt werden, verzichtet Friedrich gänzlich auf einen Anteil, während Johann 1/3 und Stefan 2/3 der Besitzungen erhalten.69 Was folgt ist eine kurze Phase der Entspannung.
Ehe man jedoch mit Friedrich über weitere Abtretungen seines größeren Landesteils verhandeln kann, stirbt jener am 4. Dezember 1393 in Budweis. Ohne den diplomatisch geschickten Friedrich, dem es immer wieder gelang, zwischen seinen Brüdern zu vermitteln, stand einer Eskalation des Konflikts zwischen Stefan und Johann nichts mehr im Wege. Gleich nach Friedrichs Tod kommt es zum Streit um die Vormundschaft über dessen erst 7jährigen Sohn Heinrich. Erst auf die Vermittlung Ruprechts II. von der Pfalz hin einigt man sich am 11. Februar 1394 zu einer gemeinsamen Ausübung der Vormundschaft. Niederbayern sollte derweil von Oswalds Törringer als Vitztum verwaltet werden.70 Doch nachdem sich diese gemeinsame Vormundschaft als undurchführbar erweist, wird am 8. Mai 1394 in Leuchtenberg beschlossen, diese für ein Jahr an Stefan zu übertragen und anschließend in einem 2jährlichen Zyklus zu wechseln.
Der Gegensatz zwischen den Brüdern nimmt dennoch in der Folgezeit immer bedrohlichere Züge an. Beide Seiten streben die militärische Lösung des Konflikts an. Zu diesem Zweck sieht sich Johann nach Verbündeten um. Im Mai 1394 reist Johann mit seinem Sohn Ernst nach Linz, um dort einen Bündnisvertrag mit Albrecht III. und Wilhelm von Österreich zum Abschluß zu bringen.71 Man verpflichtet sich zur Unterstützung bei allen Angriffen von außen und befristet die Verbindung auf 10 Jahre. Auch mit dem österreichischen Kanzler, Berthold Währinger, dem Bischof von Freising kann am 9. Juni ein Bund geschlossen werden.72 Johann versucht zusätzlich eine Ehe Elisabetta Visconti, der Tochter Giangaleazzos, Stefans italienischem Erzfeind, mit seinem Sohn Ernst in die Wege zu leiten.73
Stefan hält sich mit der Suche nach Verbündeten vorerst zurück, da er gegenüber Johann schon dahingehend im Vorteil ist, momentan über Niederbayern verfügen zu können. Im Sommer 1394 reist Stefan an den französischen Hof, um dort um finanzielle Unterstützung zu werben, die er wohl auch erhält.74
Es war die reichspolitische Situation, die in Bayern den Konflikt auf die Spitze zutrieb. Zur selben Zeit zeichnete sich im Reich eine Auseinandersetzung um die Krone zwischen Wenzel auf der einen, Jobst von Mähren und Wenzels Bruder Sigmund auf der anderen Seite ab. Während Stefan auf der Seite Wenzels stand, war Johann durch sein Bündnis mit dem „anti- Wenzel”-orientierten Habsburg auf der anderen Seite gebunden. Als am 8. Mai 1394 Jobst Wenzel gefangengesetzt wird, ist es Stefan, der sich unter den Fürsten am energischsten für dessen Freilassung einsetzt. Zum Dank für diese Initiative erhält Stefan am 30. November 1394 von Wenzel, der am 2. August freigelassen wurde, die schwäbischen Landvogteien verliehen.75
Der Krieg, der sich zwischen Wenzel und seinen Gegnern abzeichnet, kommt Ende 1394 schließlich im ersten bayerischen Hauskrieg zum Ausbruch.
Am 24. Dezember 1394 eröffnet Ludwig der Bärtige den Konflikt mit einem mißlungenen Handstreich gegen Freising.76 In der Folge greifen die Ingolstädter Pfaffenhofen an und plündern Neuburg an der Donau. Im Gegenzug belagern Münchner Truppen Aichach, erobern Friedberg und zerstören den Markt Schwaben.77 Die Auseinandersetzung zieht sich sechs Wochen hin. Erst als sich Jobst und Wenzel wieder annäherten und darüber hinaus sich Stefans Verhältnis zu Wenzel gravierend verschlechtert hatte, waren beide Seiten Ende März 1395 zu Friedensverhandlungen bereit. Jetzt ist Stefan auch geneigt, mit Johann Frieden zu schließen. Am 15. September einigen sich beide Seiten auf die Einsetzung eines 10köpfigen Schiedsgerichts unter dem Vorsitz des Bischofs Johann von Regensburg. Durch die Vermittlung des Ausschusses in die Wege geleitet, wird am 25. September in Landshut der Beschluß gefaßt, die beiden Regierungen Oberbayerns wieder zusammenzufassen.78 Der Versuch, auch Niederbayern unter diese wiedervereinte Regierung zu stellen, scheitert jedoch am Widerstand der niederbayerischen Stände.
Doch auch dieser Friede war nicht von Dauer. Zwar nimmt Stefan mit Rücksicht auf den neuerlich mit ihm verbundenen Johann 1395/96 weitgehend Abstand von der Italienpolitik Ludwigs des Bärtigen, welcher versucht, ein Verlöbnis mit Johanna, der Schwester Königs Ladislaus von Sizilien in die Wege zu leiten und desweiteren anstrebt, mit Frankreich und den Viscontierben ein Offensivbündnis gegen Giangaleazzo Visconti zu schmieden. Als am 16 Juni 1397 Johann stirbt, versucht Stefan entgegen aller Abmachungen, sich nun ganz Oberbayerns zu bemächtigen. Er findet hierbei auch die Unterstützung seines Sohns Ludwig, obwohl dieser noch am 30. März ein Bündnis mit den Münchner Herzögen in spe, Wilhelm und Ernst geschlossen hatte.
Johanns Erben sind jedoch nicht gewillt, sich den Aussprüchen der Ingolstädter unterzuordnen, so daß es ab Februar 1398 wieder zur Rüstung zum Krieg kommt. Bevor diesmal der Konflikt eskalieren kann, einigen sich die gegnerischen Parteien am 2. Juni darauf, Ruprecht III. von der Pfalz und Eberhard von Württemberg zu Schiedsrichtern hinsichtlich der strittigen Punkte zu bestimmen. Ruprechts Spruch zu Göppingen, welcher die gemeinsame Regierung über Oberbayern wieder herstellte und die Gleichrangigkeit der Münchner und Ingolstädter betonte, wurde von beiden Partein angenommen.79
Doch schon im Frühjahr 1399 nimmt Stefan die Gelegenheit wahr, wieder gegen die Münchner Herzöge tätig zu werden. Tatkräftig verhilft er einer Erhebung der Handwerker in München zum Erfolg. Die den Münchner Herzögen freundlich gesinnten Patrizier werden aus der Stadt vertrieben und München gerät unter die Herrschaft der sog. Handwerkerregierung.80 Auch Versuche, am 24. August 1399 in Ingolstadt einen Waffenstillstand herbeizuführen oder ein erneuter Schiedsspruch am 10. Januar 1400 durch Ruprecht, welcher Stefan wiederholt auf gleichberechtigte Stellung Wilhelms und Ernst ihm gegenüber hinwies, können über die starken Gegensätze nicht hinweghelfen. Einer der Hauptstreitpunkte ist erneut die Vormundschaft über Heinrich von Niederbayern. Die gemeinsame Regierung erweist sich als undurchführbar und wieder werden Bündnisse gegeneinander geschlossen. Auch Ruprecht sind zu diesem Zeitpunkt als Vermittler die Hände gebunden, da er vollauf damit beschäftigt war, sein eben erst erworbenes Königtum zu erhalten und es sich so nicht leisten konnte, einen der Kontrahenten durch einen Schiedsspruch zu vergrämen.
Die bayerischen Herzöge sehen wieder keinen anderen Ausweg als eine erneute Teilung. Ab 1401 trifft man sich zu Teilungsverhandlungen in Augsburg, Erding und Amberg. Diese Verhandlungen scheitern aber immer wieder an der starren Haltung Stefans, der auf den Besitz des Münchner Landesteils besteht, ohne daß er dazu bereit wäre, Wilhelm und Ernst dafür Entschädigungen zu zahlen. Für die Münchner Herzöge sind nur drei Alternativen akzeptabel, entweder gar keine Teilung zu vollziehen, die Landesteile genau wie 1392 zu verteilen, oder die Landesteile neu zu definieren, wobei sie es selbst sein sollten, die eine Neufestlegung der Gebiete vollziehen würden.
Nach dem Scheitern der Verhandlungen schlagen die Münchner Herzöge wieder den Weg des Krieges ein und erobern im Herbst 1402 Wasserburg und Aichach. Derart zur Einsicht gezwungen, stimmen dann auch die Ingolstädter am 11. November der Einsetzung eines Schiedsgerichts bestehend aus 24 Mitgliedern ihrer Landschaft zu, welches über die neue Aufteilung Oberbayerns entscheiden soll. Der Schiedsspruch vom 6. Dezember dürfte Stefan wenig glücklich gestimmt haben, besagte er doch die Rückkehr zu den Teilungsverhältnissen von 1392.81 Dennoch ließ sich Stefan nicht dazu hinreißen, die immer noch bestehende Münchner Handwerkerregierung, welche sich der Herrschaft Wilhelms und Ernsts widersetzte, zu unterstützen.82
5.2. Das Verhältnis zum König
Wie bereits erwähnt, war dem Friedensschluß zwischen Johann und Stefan im März 1395 eine tiefgehende Verschlechterung der Beziehungen zwischen Stefan und dem König vorausgegangen. Wie kam es dazu?
Zu ersten Verstimmungen kommt es 1395 als Wenzel am 11. Mai Giangaleazzo Visconti am 10. Jahrestag seiner Usurpation zum Herzog erhebt und dies noch dazu mit der Begründung, ein Gegengewicht zu französischen Ambitionen in Italien schaffen zu wollen. Die Folge ist, daß Stefan Verbindungen mit den Gegnern Wenzels, Jobst von Mähren, Johann von Görlitz und Wilhelm von Meißen aufbaut. Zum endgültigen Bruch kommt es schließlich als der König Jobst im Juni 1395 zu Verhandlungen nach Burg Karlstein lädt und diesem durch Stefan das freie Geleit versichern läßt, Jobst dann dennoch gefangensetzt. Zwar versucht Wenzel Stefan noch einmal an sich zu binden, indem er ihm am 19. Juni, gewissermaßen als Wiedergutmachung, die schwäbischen Landvogteien verleiht, doch hatte sich Stefan bereits von ihm abgewandt.83
Der Gegensatz zwischen dem bayerischen Herzog und dem König sollte sich bald auch auf reichspoltischer Ebene bemerkbar machen. 1397 verleiht Wenzel die schwäbischen Landvogteien nicht mehr an Stefan, sondern an Friedrich von Öttingen.84 Während sich Stefan 1395 beim König noch für ein deutsch-französisches Königstreffen stark gemacht hatte, nimmt er 1398, als das Treffen schließlich zustande kommt, nicht daran teil. Ab 1399 sind es insbesondere Stefan und Ludwig, welche auf diversen Fürstentagen die Absetzung Wenzels und die Aufstellung eines wittelsbachischen Gegenkönigs propagieren. Am 1. Februar 1400 einigen sich in Frankfurt 7 Fürsten (darunter Stefan und Ludwig) und 5 Kurfürsten darauf, einen neuen König zu wählen. Nachdem Wenzel im Sommer 1400 nicht auf dem Fürstentag in Oberlahnstein erscheint, wird er dort am 20. August 1400 für abgesetzt erklärt.85 Tags darauf wird Ruprecht III. von der Pfalz mit den Stimmen der drei geistlichen Kurfürsten zum König gewählt.86 In der folgenden Auseinandersetzung zwischen Ruprecht und Wenzel macht sich Stefan seine französischen Beziehungen zunutze, um eine Neutralität Frankreichs, welches eigentlich die Luxemburger Seite favorisierte, zu erwirken.
Wie nicht anders zu erwarten schlug sich der reichspolitische Gegensatz auch auf innerbayerischen Konflikt nieder. Während Stefan und Ludwig Ruprecht unterstützen, wandten sich die Münchner dem Luxemburger zu. Im Herbst 1400 eröffnete Ruprecht in der Oberpfalz den Angriff auf die böhmischen Besitzungen Wenzels, welcher im Juni 1401 in einem Waffenstillstand endete. Mit dieser Waffenruhe war das Ende der politischen Kariere Wenzels endgültig besiegelt.87
Ruprechts Königtum stand keineswegs auf festen Füßen. Viele der Fürsten im Reich waren gegen ihn. Zu seinen treuesten Verbündeten zählten die Ingolstädter. Der geplante Italienzug Ruprechts im Herbst 1401 ist für Ludwig eine ideale Gelegenheit, selbstständig in der auswärtigen Politik tätig zu werden. Neben der Erlangung der Kaiserkrone ist ein weiteres Ziel die Ausschaltung Giangaleazzo Viscontis, was sich direkt mit den Interessen der Ingolstädter deckt. Ludwig unterstützt Ruprecht intensiv bei den Vorbereitungen des Zuges, er führt, wenn auch erfolglos, Verhandlungen mit Florenz hinsichtlich finanzieller Unterstützung, auch handelt er mit Leopold IV. von Österreich die Öffnung der Alpenstraßen aus.88
Der Zug selbst steht von Anfang an unter ungünstigen Vorzeichen. Aufgrund unzureichender finanzieller Mittel muß Ruprecht den Umfang seines Heeres drastisch verringern (angeblich. 5000 Reiter). Am 21. Oktober 1401 unterliegen Ludwig und Franz von Carrara bei Bressia den Truppen Giangaleazzos. Im darauffolgenden Winter versuchen Ruprecht und Ludwig erfolglos in Venedig und Padua eine Fortführung des Krieges zu organisieren. Ruprecht schickt Ludwig nach Rom, um mit dem Papst über die Kaiserkrönung zu verhandeln, doch auch dieses Unterfangen bleibt erfolglos, was wohl auf die überzogenen Forderungen Bonifaz IX. zurückzuführen ist. Im Sommer 1402 begibt sich Ludwig nach Frankreich, um dort ein Bündnis gegen Mailand in die Wege zu leiten. Noch vor seinem Eintreffen in Paris stirbt Giangaleazzo Visconti jedoch im September 1402, so daß Ludwigs Mission hinfällig wird.
Die Reihe der Mißerfolge 1401/1402 führen dazu, daß sich Ludwig frustriert von der Reichspolitik abwendet. Eine entscheidende Schwächung findet Ruprechts Königtum als sich nach und nach ganz Bayern von ihm entfernt. Wilhelm und Ernst waren von jeher Gegner Ruprechts gewesen. Über seine engen Verbindungen zum französischen Hof entwickelt schließlich auch Ludwig eine feindliche Haltung gegenüber dem König und tritt 1407 dem antiköniglichen Marbacher Bund bei. Letztendlich kommt es auch zum Bruch zwischen Stefan und Ruprecht, herbeigeführt vor allem durch Streitigkeiten in Kirchenfragen.89
5.3. Stefan III. 1403-1413
Nach der erneuten Teilung Oberbayerns im Jahre 1402 scheint sich hinsichtlich Stefans Innenpolitik ein Wechsel abzuzeichnen. Im Gegensatz zu früher zeigt sich Stefan von einer milderen, nachsichtigeren Seite. Er versucht, trotz der Gegensätze der nachkommenden Herzogsgenerationen an Gemeinsamkeiten in inneren undäußeren Fragen festzuhalten. In diesem Zusammenhang kann man wohl auch die von ihm initiierten Münzverhandlungen und Abmachungen von 1400, 1405/6 und 1412 sehen. Zugegebenermaßen wurden diese Vereinbarungen in erster Linie aus wirtschaftlichem Interesse heraus getroffen. Neben der Eindämmung des Münzabflusses, der Aussperrung fremder Währungen oder der Stabilisierung des Goldkurses .ging es auch um die Erhaltung eines einheitlichen Währungsgebietes, eines wirtschaftlich und finanziell geeinten Bayerns. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß 1412 unter Stefans Regierung der vorerst letzte Landfrieden für ganz Bayern zustande kam.90 Es muß Stefan tief verbittert haben, daß seine späten Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des einheitlichen Grundsatzes weder von den Herzögen in München, noch von Ludwig dem Bärtigen mitgetragen wurden.
Nachdem 1410 König Ruprecht I. stirbt und der Luxemburger Siegesmund, König von Ungarn am 17. Juni 1411 zu dessen Nachfolger gewählt wird, erhebt Stefan vergeblich Anspruch auf die pfälzische Kurstimme. Es sei erwähnt, daß er in dieser Forderung nicht einmal die Unterstützung der übrigen wittelsbachischen Bayernherzöge fand.91 Im Jahre 1410 macht sich der bereits 63jährige Stefan noch einmal zu einer kriegerischen Außenunternehmung auf. Ziel seiner Begierde war Tirol, dessen Verlust von 1369 er wohl nie gänzlich hingenommen hatte.92
In Tirol hatte sich seit der Mitte des Jahrzehnts eine Adelsopposition gegen den regierenden Habsburger Friedrich IV. gebildet. Der Führer dieser anti-habsburgischen Bewegung, Hofmeister Heinrich von Rottenburg, tritt bereits 1408 mit Ludwig in Verbindung. Der Rottenburger verspricht Bayern im Falle einer Unterstützung seiner geplanten Erhebung die Öffnung von nicht weniger als 40 Burgen.93
Was folgt, ist die vorerst letzte kriegerische Unternehmung, welche von Ingolstadt und München gemeinsam getragen wird. Niederbayern unter dem inzwischen volljährigen Heinrich XVI. verhält sich trotz seiner engen Verbindung zu Habsburg94 vorerst neutral. 1410 sperrt Bayern den Inn für den Salzverkehr, was für Österreich Grund genug ist, am 23. Juli den Krieg zu erklären. Die bayerischen Truppen sammeln sich in Rattenberg. München stellt ein Aufgebot von etwa 700 Reitern, 200 Schützen und 800 Mann Fußvolk. Stefans Beitrag an Truppen war, wohl aufgrund der Ermangelung der nötigen finanziellen Mittel, sehr bescheiden. Aus Angst vor einem Aufstand in München sieht sich darüber hinaus Herzog Ernst gezwungen, einen Teil seiner Truppen nach München zurückzubeordern.95 Die bayerischen Truppen ziehen den Inn aufwärts, um die von Friedrich IV. belagerte Burg Friedberg bei Volders zu entsetzen. Das Eintreffen Ernsts von Habsburg schließlich beendete die Kampfhandlungen bei Friedberg und am 3. September 1410 wird in Hall und Rattenberg ein Waffenstillstand ausgehandelt. Ungewiß ist, ob die Herbeiführung neuer Truppen durch Ernst, oder eine Verständigung der Habsburger mit Heinrich von Rottenberg ausschlaggebend für den Abbruch der kriegerischen Auseinandersetzungen war.
Warum der Versuch der Eroberung Tirols letztlich scheiterte, läßt sich anhand einer Reihe von Faktoren begründen. Zum einem war die von Heinrich von Rottenberg angekündigte Adelsrevolte in Tirol ausgeblieben, so daß die bayerischen Herzöge allein gegen Habsburg standen. Desweiteren hatten fehlendes Engagement hinsichtlich der Bereitstellung von Truppen, nicht nur von Seiten Stefans, sondern auch der Städte, dazu geführt, daß nur unzureichende militärische Mittel für die Unternehmung zur Verfügung standen.
1411 wird der Waffenstillstand von Hall und Rattenberg um ein weiteres Jahr verlängert, doch bereits 1413, am 6. Januar marschiert Stefan erneut in Tirol ein. Dieses Mal jedoch steht das Unternehmen unter noch ungünstigeren Vorzeichen wie drei Jahre zuvor. Nicht nur, daß die Münchener Herzöge jegliche Unterstützung verweigern, auch ist Heinrich von Niederbayern nun nicht gewillt, sich in Neutralität zu üben. Im November 1412 hatte er die Tochter Herzog Albrecht IV. von Habsburg geheiratet und stand so in direkter Gegnerschaft zu Stefan. Auch wenn sich 1410 die eingesetzten militärischen Mittel seitens Bayerns als unzureichend erwiesen hatten, zog nun Stefan mit einem noch viel kleineren Aufgebot bestehend aus 300 Reitern und 700 Fußsoldaten in den Krieg, wobei es sich hier bei den meisten um nur notdürftig ausgerüstete Bauern handelte. Zwar war Stefans Feldzug zu Beginn erfolgreich, Forcher spricht in diesem Zusammenhang von einem „mittelalterlichen Blitzkrieg”96. Es ist dennoch nicht verwunderlich, daß Stefan bereits an der Einnahme von Hall scheitert und unverrichteter Dinge den Rückzug antreten muß.
Nachdem Stefan III. am 26. September in Niederschönfeld bei Donauwörth stirbt, beendet sein Nachfolger Ludwig den latenten Kriegszustand mit Habsburg, indem er, auf Vermittlung von König Siegesmund hin, am 2. Oktober 1413 von Paris aus Frieden mit Österreich schließt und somit endgültig auf die Tiroler Gebiete verzichtet.97
6. Bewertung
Betrachtet man das bewegte Leben Stefans III., so muß man doch feststellen, daß er in erster Linie der war, als der von den Autoren immer wieder bezeichnet wird, ein ruheloser Abenteurer. Dieses beinahe draufgängerische Abenteurertum legt er auch sein ganzes Leben lang nicht ab. Möchte man auch ab 1402 eine Abschwächung dieses Charakterzuges bei Stefan zu erkennen versuchen, so zeigen die Kriegszüge gegen Tirol von 1410 und vor allem von 1413, daß der Herzog Anfang des 15. Jhds. keineswegs einen Wandel hin zum einsichtigen Staatsmann vollzogen hatte.
Wenn man nach Gründen dafür fragt, warum denn Stefan gar so kriegerisch, spontan und ruhelos und so wenig diplomatisch, vorausschauend oder rücksichtsvoll veranlagt war, dann kann man dafür nicht nur seine eigene Person verantwortlich machen, sondern muß auch dieäußeren Umstände beachten, in welchen sich der bayerische Herzog entwickelte. Seine Vorliebe für das Kriegshandwerk ist sicherlich darin begründet, daß er schon von frühester Jugend an daran gewöhnt worden war, quasi damit aufgewachsen ist. Zu Beginn seiner Regierung steht der Städtekrieg, der trotz einiger Unterbrechungen dafür sorgt, daß sich die bayerischen Herzöge bis 1389 nahezu ständig im Kriegszustand befinden.
Die Tatsache, daß Stefan auf der diplomatischen Bühne nie ein sonderliches Geschick entwickelte, liegt meiner Meinung nach zu einem großen Teil daran, daß er, während er bis 1392 Bayern zusammen mit seinen Brüdern regierte, einfach kaum Praxis in der Diplomatie hatte. Wenn man von Johann einmal absieht, dann wurde Bayern zu dieser Zeit von Stefan und Friedrich in einer Art Personalunion regiert. Während in vielen Fällen Friedrich seinem Bruder das Kriegsführen überließ (beispielsweise auf die Anordnung Kaiser Karls IV., den Krieg gegen die Städte 1376 fortzusetzen), ließ Stefan Friedrich den Vorzug in diplomatischen Belangen. Solange Friedrich und Stefan im Einvernehmen miteinander regierten, war es einfach für Stefan nicht notwendig, auf diesem Gebiet aktiv zu werden, wozu hatte er denn seinen Bruder. Es wird zwar immer wieder darauf hingewiesen, Friedrich sei der intelligentere der beiden gewesen und somit sei es nicht verwunderlich, daß er Stefan in staatsmännischen Belangen überragte, doch kann ich dem nicht uneingeschränkt zustimmen. Selbst wenn Friedrich seinen Bruder geistig überragt haben sollte, hat Stefan diesen Umstand erkannt und auch akzeptiert, sonst hätte das gemeinsame Wirken der Brüder nicht so reibungslos funktioniert. Eine solche Fähigkeit zur Einsicht um die eigenen Schwächen und die Stärken anderer, setzt meiner Meinung nach einen hohen Grad an Reife voraus.
Über all den Mißgeschicken und den unbedacht wirkenden Handlungen während des Betreibens seiner Politik darf man einige Aspekte nicht übersehen, welche doch von großem staatsmännischen Verstand zeugen. Zum einen sei hier die Verbindung genannt, welche er zum mächtigen Frankreich nicht nur knüpfte, sondern auch während seiner ganzen Regierungszeit zu erhalten und auszubauen wußte. Auch das Bündnis, welches Stefan 1390 mit Samaritana de Polenta abschloß, durch welches er beinahe in der Lage gewesen wäre, direkte Herrschaft auf Viacenza und Verona auszuüben, zeigt, daß der Bayernherzog durchaus auch in der Lage war, realistische Ziel zur Mehrung seiner Macht mit diplomatischen Mitteln zu verfolgen.
Es ist schwierig, die Leistungen Stefans für Bayern und Wittelsbach zu bewerten. Meiner Meinung nach fällt ihm jedoch die unglückliche Rolle des Hauptverantwortlichen für die Landesteilung von 1392 zu. Zwar gibt es Stimmen, die wie Arnpeck behaupten, die Hauptschuld an der Teilung träge Friedrich98, habe er seine Brüder doch geistig weit überragt, aber wie ich in diesem Zusammenhang bereits erwähnt habe, bin ich von Stefans Inkompetenz wenig überzeugt. Meiner Meinung nach liegt Stefans Hauptschuld an der Teilung darin begründet, daß er Johann völlig unterschätzt hatte und Johanns Initiative hinsichtlich einer Landesteilung nie in Erwägung gezogen hatte. Diesen Vorwurf kann man sicherlich auch Friedrich machen, doch muß man beachten, daß Stefan Johann durch die gemeinsame Herrschaftsausübung in Oberbayern weit näher stand als Friedrich. Als Johann im September 1392 Stefan mehr oder weniger aus München vertreibt, ist es bereits zu spät, die Landesteilung zu verhindern. Mit seinem Akt läßt Johann nur noch zwei Wege offen, den unseligen Hauskrieg oder die Aufteilung Bayerns.
Auch wurden Johanns Bestrebungen zur Teilung hervorgerufen durch das verschwenderische Verhalten seiner Brüder, und man kann wohl davon ausgehen, daß sich Johanns Zorn diesbezüglich vor allem gegen Stefan, seinen Mitregenten richtete.
Meiner Ansicht nach war die größte Schwäche in Stefans Charakter weder sein Hang zum Kriegführen, noch seine Prunksucht, sondern seine große Sprunghaftigkeit verbunden mit fehlender Weitsicht. Stefans gesamtes Wirken zeigt, daß er mit langfristigen Plänen wenig im Sinn hatte. Wenn er in Umbrien Herrschaften auf päpstlichem Gebiet einrichtet und im Städtekrieg Kämpfe auch nach Waffenstillständen fortsetzt, wird deutlich, daß bei ihm das Jetzt und nicht die Folgen im Vordergrund stehen. Nicht nur in der Politik wird Stefans „Kurzsicht” deutlich, sondern auch in seinem sonstigen Schaffen. So ist es doch verwunderlich, daß ein Herrscher, noch dazu einer der mächtigsten in Europa, trotz seiner Liebe zum Prunk und zum Schönen überhaupt nicht bestrebt war, auch architektonisch tätig zu werden, sei es sich selbst ein Denkmal zu setzen oder schon zu Lebzeiten mit prunkvollen Bauten Ruhm erwerben zu können. Sicherlich verbot die ständig unruhige, von Kriegen gekennzeichnete Zeit ein ausgeprägteres bauliches Wirken, doch ist für mich das Fehlen jeglicher Tätigkeit in dieser Richtung auch ein Zeichen dafür, daß Stefan längerfristigen und zu planenden Aktionen grundsätzlich wenig Liebe entgegenbrachte.
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen:
Veit Arnpeck, Sämtliche Chroniken, hg.. Georg Leidinger in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 3., München 1905.
Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, hg.. Reinhold Spiller in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 2., Abt. 2., München 1909.
Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Hg. Fr. Michael Wittman in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 6. München 1898.
Wittelsbacher Hausverträge des späten Mittelalters, Die haus- und staatsrechtlichen Urkunden der Wittelsbacher von 1310, 1329, 1392/93, 1410 und 1472, hg.. Rudolf Heinrich, Benedikt Mayer, Werner Gerike und Christa Fischer, München 1987.
Ritter Hans Ebram von Wildenberg, Chronik von den Fürsten aus Bayern, hg.. Friedrich Roth in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 2., Abt. 1., München 1909
Sekundärliteratur:
1Michael Forcher, Bayern-Tirol, Geschichte einer Freud-Leidvollen Nachbarschaft, Wien 1981.
2
3 Andreas Kraus, Geschichte Bayerns, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1988.
4
5 Joseph Maria Mayer, Das Regentenhaus Wittelsbach, Regensburg 1880. 6
Inge Turtur-Rahn, Regierungsform und Kanzlei Herzog Stefans III. von Bayern (1375- 1413), Diss. masch., München 1952.
Hans und Marga Rall, Die Wittelsbacher in Lebensbildern, Graz, Wien, Köln 1986.
1 Josef Riedmann, Tirol im Spätmittelalter (1250-1490), in Geschichte des Landes Tirol, Bd.
1., hg.. Josef Riedmann, Walther Leiter, Peter W. Haider et al., Bozen 1985 2
Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964.
Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966.
[...]
1 bis 1378 Karl IV. von Luxemburg
1 1378-1400 Wenzel von Luxemburg
2 1400-1410 Ruprecht von der Pfalz (Wittelsbach)
3 1410-1411 Jobst von Mähren
4 ab 1410 Sigesmund von Luxemburg
2 Die Angaben zu Stefans familiären Verbindungen werden dargestellt in: Hans und Marga Rall, Die Wittelsbacher in Lebensbildern, Graz, Wien, Köln 1986, S. 77.
3 Ein genaues Datum und der Geburtsort sind nicht bekannt. In den Quellen wird Stefan III. 1346 erstmals erwähnt. Entnommen aus: Inge Turtur-Rahn, Regierungsform und Kanzlei Herzog Stefans III. von Bayern (1375-1413), Diss. masch., München 1952, S. 2.
4 ca. 1339-1393 Herzog, 1375-1393
5 ca 1341-1397 Herzog, 1375-1397
6 1338-1398
7 Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 333. hg.. Reinhold Spiller in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 2., Abt. 2., München 1909, S. 202. Eine Ähnliche Charakterisierung findet sich bei Ritter Hans Ebram von Wildenberg, S. 127, Z. 15-18. 4
8 Inge Turtur Rahn spricht von 100.000 Gulden. Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 9.
9 So berichtet beispielsweise Füetrer von großzügigen Schenkungen welche Elisabeth Bayern über den jungen Ludwig zukommen ließ: „Im [Ludwig] gab auch die swester gros guet, das er alles gen Bairen sante von gold, silber, gelt und der geleich.” in: Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 334, S. 202. 1 Inge Turtur Rahn berichtet, Stefan hätte 1394 und 1401 durch Reisen nach Paris bewirken können, daß „große Summen Geldes und ein beträchtlicher Teil des Kronschatzes nach Bayern wanderten. Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 11.
10 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 107.
11 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 109.
12 Theodor Straub, Bayerns Rolle im Reich und im Städtekrieg (1374-1391), in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 210
13 Der Originaltext des am 2. März zu Hall ausgehandelten Vertrages ist unter der Überschrift: „Vertrag zwischen den Herzogen Leupolt von Oesterreich und Stefan von Bayern auf gegenseitige Hilfeleistung in den Kriegen gegen den von Bern vnd die Venediger” zu finden in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Hg. Fr. Michael Wittman in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 6. München 1898, S. 512- 517. 1 Die Kampfhandlungen wurden jedoch erst 1376 begonnen und beschränkten sich auf die Auseinandersetzung zwischen Habsburg und Venedig.
14 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 109.
15 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 109.
16 Diese Zahlenangabe ist zu finden sowohl bei: Josef Riedmann, Tirol im Spätmittelalter (1250-1490), in Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1., hg. Josef Riedmann, Walther Leiter, Peter W. Haider et al., Bozen 1985, S. 458., als auch in: Michael Forcher, Bayern-Tirol, Geschichte einer Freud-Leidvollen Nachbarschaft, Wien 1981, S. 35.
17 Diese Angabe macht Theodor Straub in: Der Verlust von Tirol und Brandenburg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, Anm. 1., S. 200.
18 Vom Verlust Brandenburgs und den Ausgleichszahlungen wird ausführlich berichtet in: Theodor Straub, Der Verlust von Tirol und Brandenburg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 200/201
19 Die folgende überblicksmäßige Erfassung der bayerischen Besitzungen zum Zeitpunkt des Todes Stefans II. ist zu finden bei: Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 4.
20 Zu finden bei: Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 4.
21 Der Entschluß und die Umsetzung des Grundsatzes des Ungeteiltheit wird beschrieben bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 107
22 Diese Faktoren werden sowohl von Riezler (S. 112/113) als auch Straub (in Spindler, S. 211) genannt.
23 Die anderen bayerischen Herzöge vermeiden zunächst die militärische Auseinandersetzung mit den Städten.
24 Ausführlich von der Niederlage bei Alpeck berichtet: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 114.
25 Theodor Straub, Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 211.
26 Zuvor hatte Karl diese Vogtein Eberhard von Württemberg entzogen.
27 Diese Zahl ist entnommen aus : Theodor Straub, Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 214.
28 Dies geschah am 17. Juni. Entnommen aus: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 121.
29 Zu den Ereignissen in Regensburg siehe: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 121.
30 Beschrieben bei: Theodor Straub, Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 214.
31 Kraus sagt, in ihrer Eigenschaft als schwäbische Landvögte wären die Bayernherzöge besser beraten gewesen auf der Seite der mächtigen Städte in den Konflikt einzutreten, anstatt sich im „Herrenbund” an die Fürsten und den König zu binden. 1 Andreas Kraus, Geschichte Bayerns, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1988, S. 166.
32 Die Auseinandersetzung dieser beiden Städe mit den Herzögen ist beschrieben bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 134.
33 Datum entnommen aus: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 134.
34 Zum Abschluß des Bündnisvertrages kam es in Nürnberg. Der folgende Konflikt zwischen Salzburg und Bayern wird beschrieben in: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 135-138.
35 Theodor Straub ,Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 215
36 Daten entnommen aus: Theodor Straub, Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 215.
37 Was im einzelnen zwischen den Herzögen und ihren abspenstigen Lehnsmännern vorfiel ist zu finden in: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 139/140.
38 Hierauf wird noch genauer im Kapitel 3.4., „Bayern und Habsburg” eingegangen.
39 Abgesehen von Österreich zeigte sich fast der ganze Herrenbund zur Unterstützung des bedrängten Bayerns bereit. 1 Theodor Straub, Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 215.
40 Ruprecht von der Pfalz, Albrecht von Niederbayern-Straubing, Herzog Stefan mit Sohn Ludwig, Herzog Johann mit Sohn Ernst und Herzog Friedrich. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 144..
41 Obwohl Wenzel am 13. September Pilgrim den Befehl zukommen ließ, neutral zu bleiben, erklärte dieser Bayern den Krieg. Die Herzöge zogen Truppen von Regensburg und Donaustauf ab, um Mühldorf anzugreifen. Die Salzburger ihrerseits setzten zum Angriff auf Burghausen an. Auch einem weiteren schriftlichen Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen vom 31. Oktober ignoriert Pilgrim. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 146/147. 14
42 Über den Ausgang des Städtekrieges berichtet: Theodor Straub ,Bayerns Rolle Im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 215/216.
43 Friedensschlüsse: mit Regensburg am 4. Mai, mit Augsburg am 20. Juli. Im Sommer 1389 Friedensschlüsse mit Nürnberg, Kaufbeuern, Kempten, Memmingen und Ulm. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 149/150.
44 In Bayern war Sophia als Offnei oder Offemia bekannt. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 145.
45 Veit Arnpeck, Sämtliche Chroniken, hg.. Georg Leidinger in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 3., München 1905, Z. 15-20, S. 667.
46 Joseph Maria Mayer, Das Regentenhaus Wittelsbach, Regensburg 1880, S. 295.
47 Hierauf wird noch im Kapitel zur 3. Bayerischen Landesteilung genauer Bezug genommen
48 Dieses Bündnis, welchem auch die Pfalz und die Markgrafen von Baden beitraten, richtete sich zwar in erster Linie gegen Leopold von Österreich, stelle aber auch für den König eine Bedrohung dar. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 116/117.
49 Friedrich wurden die Vogteien wie vereinbart bis 1382/83 belassen. Beschriebene Vorgänge sind entnommen aus: Theodor Straub, Bayerns Rolle im Reich und im Städtekrieg (1374-1391), in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 212.
50 Durch das Zugeständnis Wenzels an Leopold sah sich Albrecht übervorteilt. Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 117.
51 Man hatte den Probst Ulrich Wulp vertrieben, welcher sich an Friedrich um Hilfe wandte. Pilgrim hatte in der Zwischenzeit Wulp offiziell für abgesetzt erklärt und seinen neugewählten Nachfolger Eighard Waller bestätigt. Entnommen aus: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 124. 18
52 Riezler berichtet ausführlich vom Zug der Bayern nach Tirol. S. 123-126.
53 Stefan Italienzug von 1380 wird dargestellt bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964,S. 218-220.
54 Diese Städte nennt unter anderem Inge Turtur Rahn. Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 9.
55 Beschrieben bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 153.
56 Weiter wird vereinbart, daß (im Falle eines Gelingens des Unternehmens) jährlich 15.000 Dukaten in Gold an Bayern zu zahlen sein. Darüber hinaus verpflichtet sich die verwitwete Samaritana de Polenta in Zukunft nicht mehr zu heiraten. 1 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 156.
57 Aus: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 156.
58 Der Verlauf und die Ergebnisse von Stefans Romreise werden erläutert bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 158.
59 Die Verhandlungen darüber und die Hochzeit selbst werden ausführlich dargestellt bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 128/129.
60 Hierbei ging es in erster Linie darum, Frankreich zu einem Engagement gegen den Papst in Avignon zu bewegen, welches Stefan 1390 auf seinem zweiten Italienzug Bonifaz IX. zugesichert hatte.
61 1402 Anna von Bourbon, 1413 Katharina von Alceon
62 Der genaue Wortlaut der Vereinbarung findet sich in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 530-533.
63 „Die Herzoge Steffan Friedrich und Johann kommen mit einander überein, drei Jahre ungetheilt bei einander zu bleiben” in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 533-537.
64 Der Vertrag wurde am 25. Februar in München ausgestellt und ist im Wortlaut abgedruckt in :Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 540-543.
65 Am „Sant Matheus tag man hertzog Johanns die newen vest zu München ein wider seinen brueder hertzog Steffan.” Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 328, S. 201.
66 Der gesamte Vertragstext findet sich abgedruckt in: Wittelsbacher Hausverträge des späten Mittelalters, Die haus- und staatsrechtlichen Urkunden der Wittelsbacher von 1310, 1329, 1392/93, 1410 und 1472, München 1987, S. 192-197 (Originalversion) bzw. S. 198-201 (Übersetzung ins Neuhochdeutsche). 1 Eine Kopie des Originaltextes findet sich im Anhang unter Nr. 1.
67 Eine genaue Summe wurde nicht festgelegt. Die Ausgleichszahlungen sollten sich danach bemessen, wie hoch die Einkünfte Niederbayerns diejenigen der beiden oberbayerischen Teile überstieg. 1 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 165.
68 Zu finden bei: Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 331, S. 201. Der gesamte Wortlaut der in München getroffenen Abmachung findet sich unter „Die Herzoge Friedrich und Johann verbinden sich gegen ihren Bruder Stephan im Falle eines Angriffs von dessen Seite” in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 558/559.
69 Der Vertragstext ist abgedruckt in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 560-562. 1 Und: Wittelsbacher Hausverträge des späten Mittelalters, Die haus- und staatsrechtlichen Urkunden der Wittelsbacher von 1310, 1329, 1392/93, 1410 und 1472, München 1987, S. 213-216.
70 Oswald von Törring war Viztum in Niederbayern von 1394- 1396. Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 175/176.
71 Der Text des am 20. Mai abgeschlossenen Vertrages findet sich in: Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 565-568.
72 Zu finden bei Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 345. hg.. Reinhold Spiller in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 2., Abt. 2., München 1909, S. 207.
73 Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 348, S. 208.
74 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 173.
75 Entnommen aus: Theodor Straub ,Auflösung der politischen Einheit, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 217/218.
76 Füetrer sagt, Johann sei rechtzeitig „gewarnet worden, das herzog Ludwig Freysing wolt eingenomen haben. Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 347, S. 207.
77 Beschrieben bei Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik, cap. 347, S. 207/208.
78 „Die Herzoge Steffan und Johann werfen ihre Lande zusammen und wollen versuchen, auch Herzog Heinrich Land mit dem ihrigen zu vereinigen.” in Monumenta Wittelsbachensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 6., München 1898, S. 569-573.
79 Näheres zum Göppinger Spruch: Theodor Straub ,Auflösung der politischen Einheit (1392-1402), in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 219.
80 Eine gute Darstellung des Konflikts zwischen Patriziern und Handwerkern in München ist zu finden in: Andreas Kraus, Geschichte Bayerns, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1988, S. 167/168.
81 Über den erneuten Beschluß zur Teilung: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 195-197.
82 Erst am 1. Juni 1403 gelingt es Ernst und Wilhelm die Münchner Handwerkerregierung endgültig auszuschalten.
83 Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 176/177..
84 Theodor Straub ,Auflösung der politischen Einheit (1392-1402), in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 220.
85 Man begründete dies mit der Unfähigkeit Wenzels, „als einen unnutzen, verschmächlichen, unachtpern entlader und unwirdign handthaber des heiligen römischen reiches...”. Aus: Ritter Hans Ebram von Wildenberg, Chronik von den Fürsten aus Bayern, hg.. Friedrich Roth in: Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, hg.. durch die historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Bd. 2., Abt. 1., München 1909, S. 133, Z. 26-28.
86 Die Krönung König Ruprechts I. findet im Januar 1401 statt.
87 Die Auseinandersetzung wird dargestellt bei: Siegmund von Riezler, Geschichte Bayerns, Bd. III, Aalen 1964, S. 177.
88 Ludwigs Italienzug wird beschrieben bei: Theodor Straub ,Auflösung der politischen Einheit (1392-1402), in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 221.
89 Während Stefan (wie auch die übrigen bayerischen Herzöge) den anläßlich des Konzils von Pisa (1409) gewählten Papst Alexander V. und dessen Nachfolger Johannes XXIII. unterstützten, hielt das Pfälzer Königshaus an Gregor XII. fest. 1 Theodor Straub ,Schisma, Konzilien, Klosterreform, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 223.
90 In diesen Landfrieden wurde auch Niederbayern-Straubing miteinbezogen. 1 Theodor Straub ,Das erste Jahrzehnt der Teilherzogtümer 1403-1413, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 223.
91 Straub berichtet, Ernst von Oberbayern-München hätte diese Bestrebungen nicht nur nicht unterstützt, sondern in der Frage um die pfälzische Kurwürde eine Gegenposition zu Stefan eingenommen. 1 Theodor Straub ,Das erste Jahrzehnt der Teilherzogtümer 1403-1413, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II., München 1966, S. 233.
92 Dieser Ansicht ist auch Inge Turtur Rahn. Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 7.
93 Die genaueren Umstände, welche zum bayerischen Angriff auf Tirol führten, sind nachzulesen in: Josef Riedmann, Tirol im Spätmittelalter (1250-1490), in Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1., hg. Josef Riedmann, Walther Leiter, Peter W. Haider et al., Bozen 1985, S. 465.
94 Heinrich hatte sich 1402 mit Magarete, der Tochter Herzog Albrechts IV. von Österreich verlobt und darüber hinaus 1407 mit Habsburg ein Bündnis geschlossen.
95 Michael Forcher, Bayern-Tirol, Geschichte einer Freud-Leidvollen Nachbarschaft, Wien 1981, S. 36.
96 Laut Forcher war Stefans Truppe aufgrund seiner geringen Größeäußerst wendig und glich seine Schwäche an Mannschaften durch den Überraschungseffekt aus. 1 Michael Forcher, Bayern-Tirol, Geschichte einer Freud-Leidvollen Nachbarschaft, Wien 1981, S. 36.
97 Dargestellt bei: Inge Turtur-Rahn, München 1952, S. 7.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse des Lebens und Wirkens von Herzog Stefan III. von Bayern, insbesondere seiner Regierungszeit von 1375 bis 1413. Es behandelt seine Jugend, seine Rolle im Städtekrieg, seine Beziehungen zu seinen Brüdern und zum Königshaus, seine Außenpolitik (insbesondere in Italien und Frankreich) und die dritte bayerische Landesteilung.
Wer war Stefan III. von Bayern?
Stefan III. war ein Herzog von Bayern, bekannt für seinen abenteuerlichen Geist, seine ritterlichen Tugenden und seine prunkvolle Herrschaftsausübung. Er regierte in einer unruhigen Zeit, die von Konflikten zwischen Städten und Fürsten sowie internen Auseinandersetzungen in Bayern geprägt war.
Was waren die wichtigsten Ereignisse in Stefans Leben bis zum Tod seines Vaters, Stefan II.?
Zu den wichtigsten Ereignissen gehören seine Heirat mit Thadäa Visconti, seine Teilnahme an Kämpfen um Tirol und Brandenburg sowie seine Beteiligung an einem Kreuzzug in Litauen. Er zeigte auch frühzeitig Interesse an der italienischen Politik.
Was war der Städtekrieg und welche Rolle spielte Stefan III. dabei?
Der Städtekrieg war eine Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser und den nach Selbstständigkeit strebenden Städten. Stefan III. war zunächst neutral, beteiligte sich dann aber aktiv an den Kämpfen gegen die Städte. Später vermittelte sein Bruder Friedrich zwischen den Parteien.
Wie war Stefans Verhältnis zu seinen Brüdern, Johann II. und Friedrich?
Sein Verhältnis zu Johann II. war distanziert, während er zu Friedrich eine enge Zusammenarbeit pflegte. Friedrich wird als intelligenter und besonnener beschrieben, während Stefan eher kriegerisch und abenteuerlustig war.
Welche Rolle spielte die dritte bayerische Landesteilung von 1392?
Die Landesteilung führte zur Aufteilung Bayerns unter Stefan III., Johann II. und Friedrich. Stefan erhielt Oberbayern-Ingolstadt, was zu Auseinandersetzungen mit Oberbayern-München führte.
Was war Stefans Außenpolitik und welche Rolle spielte Italien dabei?
Stefan engagierte sich stark in der italienischen Politik, insbesondere durch seine Verbindung zur Familie Visconti in Mailand. Er unterstützte verschiedene Parteien und versuchte, seinen Einfluss in Oberitalien auszubauen, wenn auch mit begrenztem Erfolg.
Wie war Stefans Verhältnis zum Königshaus?
Stefan hatte anfangs ein gutes Verhältnis zum Königshaus Luxemburg, das sich aber im Laufe der Zeit verschlechterte. Er beteiligte sich an der Absetzung Wenzels als König und unterstützte Ruprecht von der Pfalz.
Warum scheiterte Stefans Versuch, Tirol zurückzugewinnen?
Der Versuch scheiterte aufgrund mangelnder Unterstützung durch andere bayerische Herzöge, ausbleibender Adelsrevolte in Tirol und unzureichender militärischer Mittel.
Wie wird Stefan III. abschließend bewertet?
Stefan III. wird als ruheloser Abenteurer und Krieger beschrieben, dem es an Weitsicht und diplomatischem Geschick mangelte. Er wird für die Landesteilung von 1392 mitverantwortlich gemacht, auch wenn er andererseits ein geschickter Bündnispolitiker war und das Bündnis zu Frankreich zu nutzen wusste.
- Quote paper
- Zander Florian (Author), 2000, Leben und politisches Wirken des Herzogs Stefan III., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97018