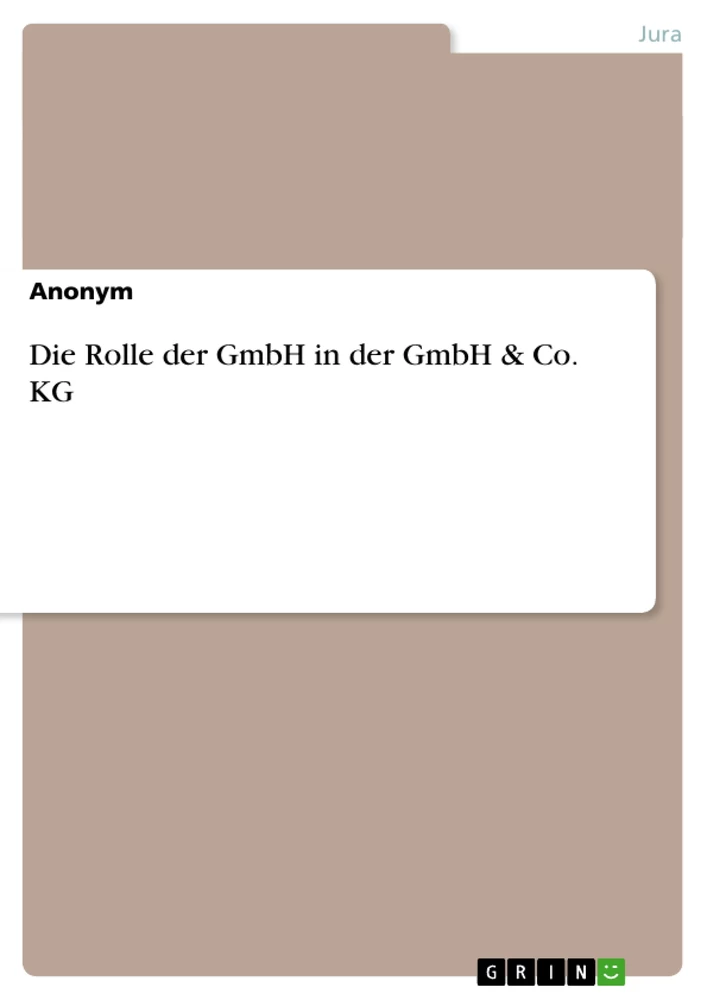Enthüllen Sie die Geheimnisse der GmbH & Co. KG, einer faszinierenden hybriden Unternehmensform, die die Vorteile von Kapital- und Personengesellschaften vereint. Diese umfassende Analyse dringt tief in das komplexe Geflecht des deutschen Gesellschaftsrechts ein und beleuchtet die strategische Bedeutung der GmbH als Komplementärin innerhalb der KG-Struktur. Untersuchen Sie die vielfältigen Aspekte der Haftungsbeschränkung, ein Kernmotiv für die Wahl dieser Rechtsform, und erfahren Sie, wie sie das finanzielle Risiko für Unternehmer und Gesellschafter minimiert. Erforschen Sie das Innen- und Außenverhältnis der GmbH & Co. KG, um die Machtdynamiken und Vertretungsbefugnisse zu verstehen, die diese einzigartige Konstruktion prägen. Tauchen Sie ein in die steuerrechtliche Behandlung und enthüllen Sie die Feinheiten der Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer im Kontext dieser Unternehmensform. Entdecken Sie die Möglichkeiten zur Unternehmensperpetuierung, die die GmbH & Co. KG im Vergleich zu traditionellen Personengesellschaften bietet, und erfahren Sie, wie sie die Kontinuität und den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sichert. Abschließend werden firmenrechtliche Überlegungen zur Sachfirma beleuchtet, die es der GmbH & Co. KG ermöglicht, sich in einer Branche zu etablieren und ihre Marktposition zu stärken. Dieses Buch bietet eine unverzichtbare Ressource für Unternehmer, Juristen und Studierende, die ein tiefes Verständnis für die GmbH & Co. KG und ihre strategischen Vorteile im deutschen Wirtschaftsraum suchen. Erfahren Sie, wie Sie diese flexible und bewährte Gesellschaftsform nutzen können, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen und sich in der komplexen Welt des Gesellschaftsrechts zurechtzufinden. Ergründen Sie die Vor- und Nachteile, von der Haftungsbeschränkung bis zur potenziellen Bonitätsminderung, und treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre unternehmerische Zukunft. Tauchen Sie ein in die Welt der GmbH & Co. KG und entdecken Sie das Potenzial für Wachstum, Stabilität und langfristigen Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
I. Unternehmensformen
1.1. Die GmbH
1.2. Die GmbH & Co. KG
II. Die Rolle der GmbH in der GmbH & Co. KG
2.1. Haftung
2.2 Innenverhältnis
2.3. Außenverhältnis
2.4. Die steuerrechtliche Behandlung der GmbH
2.5. Unternehmensperpetuierung
2.6. Sachfirma
III. Schlußbetrachtung
Literaturverzeichnis
I. Unternehmensformen
1.1. Die GmbH
Die GmbH (= Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist eine Kapitalgesellschaft und ohne historisches Vorbild aus Zweckmäßigkeitsgründen durch das GmbHG von 1892 geschaffen worden. Angesichts der komplizierten und kostspieligen Gründungsvorschriften, der meist zwingenden organisatorischen Regeln der AG, die auf Gesellschaften mit großer Mitgliederzahl und hohem Kapitalbedarf zugeschnitten sind, hielt es der Gesetzgeber für zweckmäßig und notwendig, eine Gesellschaftsform zu schaffen, die es auch Gesellschaften mit typischerweise wenigen Gesellschaftern und geringerem Kapitalbedarf ermöglichte, ein Unternehmen ohne persönliche Haftung zu betreiben1.
Die GmbH ist eine Handelsgesellschaft (§ 13 Abs.3 GmbHG) mit eigener Rechtspersönlichkeit, also eine juristische Person, die zu jedem zulässigen Zweck errichtet werden kann und für deren Verbindlichkeiten den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen haftet2. Nach § 11 Abs.1 GmbHG entsteht die GmbH als solche erst durch die Eintragung in das Handelsregister.
Grundlage der Organisation einer juristischen Person ist der Gesellschaftsvertrag, welcher der notariellen Form bedarf und seit der GmbH-Novelle 1980 auch von einer einzelnen Person abgeschlossen werden kann. In ihm ist der Gesellschaftszweck festgelegt, der bei der GmbH nicht auf den Betrieb eines Handelsgewerbes beschränkt ist, sondern vielmehr wie bei der AG in jedem gesetzlich zulässigen Zweck bestehen kann (§ 1 GmbHG)3.
Die GmbH handelt durch ihre Organe, d. h. den oder die Geschäftsführer und die Gesamtheit der Gesellschafter. Zwingend sind ein oder mehrere Geschäftsführer, die die GmbH vertreten und nicht Gesellschafter sein müssen (sog. Drittorganschaft, §§ 6, 35 GmbHG), sowie die Gesellschafterversammlung (§§ 45, 46 GmbHG). Der oder die Geschäftsführer werden durch den Gesellschaftsvertrag oder durch den Beschluß der Gesellschafterversammlung berufen. Die Bestellung kann jederzeit widerrufen werden, jedoch kann der Gesellschaftsvertrag die Widerrufsmöglichkeit einschränken. Die Gesellschafter als Gesamtheit sind das oberste Willensorgan der Gesellschaft. Sie üben ihre Befugnisse durch Beschlußfassung aus, die in der Regel in Gesellschafterversammlungen getroffen wird, welche durch die Geschäftsführung einberufen werden4.
Das Stammkapital der GmbH besteht aus der Summe der Stammeinlagen (§ 5 Abs.3 S.3 GmbHG). Es muss gemäß § 5 Abs.1 GmbHG mindestens 50.000,- DM betragen. Jeder Gründer kann im Gesellschaftsvertrag nur einen Geschäftsanteil übernehmen (§ 5 Abs.2 GmbHG). Die Stammeinlagen der Gesellschafter können aber unterschiedlich hoch sein. Die Einlagen können Bareinlagen oder Sacheinlagen sein5. Nach § 5 Abs.1 GmbHG muss jeder Gesellschafter eine Stammeinlage von mindestens 500,- DM übernehmen. Die Gesellschafter erhalten damit entsprechende Geschäftsanteile, die die Rechte auf Gewinn und Mitsprache sowie Pflichten verbriefen (§ 14 GmbHG)6.
Auf die GmbH ist in erster Linie das GmbHG anwendbar. Wegen der Gemeinsamkeiten zwischen GmbH und AG können aber auch einzelne Lücken des GmbHG durch Heranziehung von Normen des Aktiengesetzes geschlossen werden. Schließlich kommt subsidiär das Recht des rechtsfähigen Vereins, z. B. Organhaftung nach § 31 BGB, in Betracht7.
1.2. Die GmbH Co. KG
Die GmbH & Co. KG ist keine Kapitalgesellschaft sondern eine Personengesellschaft. Sie ist eine KG (= Kommanditgesellschaft). (STRITTIG!) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teile der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (Komplementäre)8.
Die Kommanditgesellschaft ist eine Sonderform der offenen Handelsgesellschaft (OHG). Sie ist Gesamthandsgemeinschaft und gehört nicht zu den juristischen Personen. Wie die OHG ist sie jedoch rechtlich verselbständigt und kann deshalb unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden9.
In der Form der sogenannten Publikums-KG hat die GmbH & Co. KG durch die Anwerbung einer Vielzahl von Kommanditisten bessere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung als die GmbH. Weiterhin muss der Name des persönlich haftenden Gesellschafters (Komplementär) aufgeführt sein. Dies ist die GmbH, die gemäß § 4 GmbHG Sachfirma sein kann. Schließlich kann eine einzige natürliche Person hinter einer GmbH & Co. KG stehen. Diese ist einziger Gesellschafter der GmbH und gleichzeitig Kommanditist10.
Grundsätzliches Kennzeichen einer GmbH & Co. KG ist, dass hier eine GmbH Komplementärin ist. Man spricht von einer typischen oder echten GmbH & Co. KG, wenn diese GmbH die einzige Komplementärin der KG ist. Von einer unechten GmbH & Co. KG spricht man, wenn neben der GmbH noch eine natürliche Person haftender Gesellschafter ist.
Die Besonderheit der GmbH & Co. KG gegenüber einer herkömmlichen Kommanditgesellschaft liegt darin, dass in einer GmbH & Co. KG keine natürliche Person unbeschränkt haftet, da natürliche Personen nur als Kommanditisten oder GmbH-Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligt sind und sich ihre Haftung somit nur auf ihre Einlage beschränkt. Die Komplementär- GmbH haftet dagegen für sämtliche Verbindlichkeiten der GmbH & Co. KG mit ihrem gesamten Vermögen11.
II. Die Rolle der GmbH in der GmbH Co. KG
2.1. Haftung
Bei der klassischen GmbH & Co. KG wird eine umfassende Abschwächung des Haftungsrisikos dadurch erreicht, dass sich die GmbH als einzige Komplementärin an der Kommanditgesellschaft beteiligt. Die natürlichen Personen haften als Kommanditisten nach §§ 171 ff. HGB beschränkt. Die Komplementär-GmbH haftet formell zwar unbeschränkt, die Realisierung des Gläubigerzugriffs ist jedoch faktisch beschränkt. Die GmbH haftet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen (§ 13 Abs.2 GmbHG). Die GmbH-Gesellschafter selbst haften nicht bzw. nur mittelbar mit ihrer in das GmbH-Vermögen geleisteten Einlage12. Das Problem der vollen Haftung haben damit die Gesellschafter auf die juristische Person, eben die nur mit ihrem beschränkten Vermögen haftende GmbH abgewälzt.
Diese allseitige Haftungsbeschränkung hat der GmbH & Co. KG bisweilen den Vorwurf mangelnder Seriosität eingetragen. Gleichwohl ist das Bedürfnis allseitiger Haftungsbeschränkung durchaus anerkennenswert. Der Gesetzgeber hat die GmbH & Co. KG u. a. in § 4 MitbestG anerkannt13.
2.2 Innenverhältnis
In einer Kommanditgesellschaft obliegt die Geschäftsführung immer den persönlich haftenden Gesellschaftern (§ 114 Abs.1, § 161 Abs. 2, § 164 HGB). In einer typischen GmbH & Co. KG, in der es neben der Komplementär-GmbH keine weiteren persönlich haftenden Gesellschafter gibt, ist also ausschließlich die GmbH zur Führung der Geschäfte berechtigt und verpflichtet14. Die Geschäftsführung für gewöhnliche Maßnahmen obliegt somit der Komplementär- GmbH, also deren Geschäftsführer. Außergewöhnlichen Geschäften können die Kommanditisten widersprechen. Der Geschäftsführer der GmbH ist in der Regel bei dieser angestellt und erhält von ihr die Vergütung15. Gibt es neben der Komplementär-GmbH noch weitere persönlich haftende Gesellschafter, sind auch diese zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet16 Im Gegensatz zu den Personengesellschaften, bei denen das Prinzip der Selbstorganschaft gilt, ist es bei der GmbH als Kapitalgesellschaft möglich, die Geschäftsführung auch auf Nichtgesellschafter zu übertragen (§§ 6, 35 GmbHG, sog. Drittorganschaft). Durch die Beteiligung einer GmbH als Komplementärin an einer Kommanditgesellschaft können Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse ohne Übernahme der unbeschränkten Haftung ausgeübt werden, man spricht hier auch von einer „Herrschaft ohne Haftung“17. Auch läßt sich die Vertretung der Kommanditgesellschaft durch einen Kommanditisten, der gleichzeitig Geschäftsführer der Komplementär-GmbH ist und als solcher handelt, ohne Verstoß gegen § 170 HGB erreichen18. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auch außenstehende Fachleute mit der Geschäftsleitung der Komplementär- GmbH betraut werden können19.
2.3. Außenverhältnis
Die Vertretung einer Kommanditgesellschaft obliegt den persönlich haftenden Gesellschaftern (§ 125 Abs.1, § 161 Abs. 2, § 170 HGB). Die Vertretungsmacht der Komplementäre erstreckt sich auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen20.
Bei einer GmbH & Co. KG, also bei einer Kommanditgesellschaft, bei der der einzige persönlich haftende Gesellschafter die Komplementär-GmbH ist, wird die Kommanditgesellschaft durch die GmbH vertreten. Die GmbH nimmt ihre Vertretungsbefugnisse in erster Linie durch ihre Organe, dass sind ihre Geschäftsführer (§ 35 Abs.1 GmbHG), aber auch durch ihre rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter wie Prokuristen, Handlungs- bzw. Generalbevollmächtigten wahr. Die Kommanditisten sind von der gesetzlichen Vertretung ausgeschlossen. Die Vertretungsmacht eines GmbH-Geschäftsführers ist im Verhältnis zu Dritten unbeschränkt (§ 37 Abs.2 S.1 GmbHG). Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsführer verpflichtet, sich an die Beschränkungen ihrer Vertretungsmacht, die ihnen durch Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterbeschluß auferlegt sind, zu halten (§ 37 Abs. 1 GmbHG)21.
2.4. Die steuerrechtliche Behandlung der GmbH
Hauptmotiv für die Errichtung der GmbH & Co. KG war die Doppelbesteuerung der GmbH und ihrer Gesellschafter. Diese ist durch die Körperschaftssteuerreform von 1976 dadurch weitgehend beseitigt worden, dass die gezahlte Körperschaftssteuer grundsätzlich auf die individuelle Einkommensteuer der Gesellschafter anrechenbar ist. Durch dieses Anrechnungsverfahren ist die Bedeutung der Besteuerung für die Wahl der Rechtsform geringer geworden22.
Rein steuerlich ist der Vorteil einer GmbH, dass der Unternehmer in der GmbH zum Arbeitnehmer wird und sein Gehalt und seine Pensionsansprüche damit anders als bei der Personengesellschaft, zu der die GmbH & Co. KG gehört, den Gewerbeertrag mindern. Es gibt aber auch vermögensrechtliche Nachteile: die Behandlung der Vermögenssteuer als nicht abzugsfähige Ausgabe im Anrechnungsverfahren, die hinzutretende vermögenssteuerliche Doppelbelastung auf der Ebene der Gesellschaft und der Ebene der Gesellschafter (Erfassung des Vermögens bei der Gesellschaft und in den Anteilen des Gesellschafters) und vor allem der Übergang von der Bewertung nach dem Sachwertverfahren bei Anteilen an Personengesellschaften (und den dazu gehörenden Grundstücken) auf die Bewertung nach dem Verkehrswert aufgrund des Stuttgarter Verfahrens bei GmbH-Anteilen (und den mit ihnen erfaßten Grundstücken). Daneben hat das Stuttgarter Verfahren zur Folge, dass auch in einem ertragsschwachen Jahr von den Vorjahresergebnissen ausgegangen wird, was zu einer hohen Vermögenssteuerschuld trotz Ertragsschwäche führt, die wiederum eine nicht abzugsfähige Ausgabe ist.
Die Nachteile auf dem Gebiet der Substanzsteuern verschärfen sich, wenn man eine erneute Erhöhung der Grundbesitzeinheitswerte in Betracht zieht. Entsprechend höher und auch in der Tendenz steigend ist die Erbschaftssteuer auf die GmbH-Anteile gegenüber der KG-Beteiligung.
Schließlich darf nicht übersehen werden, dass jede Möglichkeit eines Verlustausgleichs zwischen Kapitalgesellschaft und ihren Mitgliedern entfällt23.
2.5. Unternehmensperpetuierung
Stirbt ein Gesellschafter, so wird eine Personengesellschaft nach dispositivem Recht aufgelöst. Durch entsprechende gesellschaftsvertragliche Klauseln läßt sich dies zwar vermeiden, gleichwohl kommt es im Unternehmensrecht beim Tod des Inhabers zu erheblichen Krisensituationen. Durch die Gründung einer GmbH kann dies vermieden werden. Die Existenz der GmbH als Kapitalgesellschaft ist vom Tod ihrer Gesellschafter unabhängig. Man sagt, „die GmbH stirbt nicht“. Dies ist einer der Ansatzpunkte für die Wahl der GmbH & Co. KG als Unternehmensform: Die Geschäftsinhaber gründen eine GmbH und werden Kommanditisten einer anschließend zu gründenden GmbH & Co. KG. Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesellschaft liegen entweder bei den Gesellschaftern oder, sollten sich diese bereits auf das Altenteil zurückziehen wollen, bei Dritten. Denkbar ist es auch, die GmbH „in Reservestellung“ erst dann mit der Geschäftsführung zu betrauen, wenn der geraume Zeit noch als Komplementär fungierende Senior stirbt24.
2.6. Sachfirma
Bei Gründung einer GmbH & Co. KG spielen auch firmenrechtliche Überlegungen eine gewisse Rolle. Die GmbH & Co. KG führt als Kommanditgesellschaft den Namen ihrer Komplementärin. Hierbei besteht die Möglichkeit einer Sachfirma25.
Andererseits ist die GmbH & Co. KG nun aber verpflichtet (§ 19 Abs.5 HGB), auch bei abgeleiteter Firma einen Firmenzusatz, wie etwa „GmbH & Co.“ aufzunehmen26 Eine Sachfirma muss dem Gegenstand des Unternehmens entlehnt sein (§ 4 Abs.1 GmbHG). Diese Erfordernis dient dem Grundsatz der Firmenwahrheit. Der Unternehmensgegenstand soll durch die Firma im wesentlichen erkennbar gemacht werden.
Weil die GmbH als verantwortliche Komplementärin das Unternehmen der Kommanditgesellschaft betreibt, ist es auch zulässig, dass die Sachfirma der Komplementär-GmbH dem Unternehmensgegenstand der Kommanditgesellschaft entnommen wird. Dieser Art der Firmenbildung sind jedoch insoweit Grenzen gesetzt, als die GmbH-Firma dadurch täuschungsgeeignet ist (§ 18 Abs.2 HGB). Ist beispielsweise das Unternehmen der Kommanditgesellschaft eine Papierfabrik und produziert nicht selbst, darf ihre Firma auch nicht Meyer Papierfabrik GmbH lauten27.
Grundsätzlich erleichtert die Sachfirma einer GmbH der GmbH & Co. KG, es sich in einer Branche bekannt zu machen28.
III. Schlußbetrachtung
Die GmbH & Co. KG ist eine Schöpfung der Vertragsjuristen. Da sie sich in der Praxis seit vielen Jahren bewährt hat, wird sie sich auch neben anderen KG- Formen, die zunehmend ins Gespräch kommen, wie die GmbH & Co. KgaA, weiterhin gut behaupten können. Eben die Kombination kapital- und personengesellschaftlicher Elemente gibt ihr eine Flexibilität, die eine wesentliche Ursache für die Beliebtheit dieser Gesellschaftsform ist29.
Hervorragendes Element der GmbH & Co. KG ist die Komplementär-GmbH. Sie bietet die Möglichkeit, die Haftung auf das gesamte, aber doch abgrenzbare Vermögen der GmbH zu beschränken, so dass die Gesellschafter in der Regel nur einem überschaubaren Risiko unterliegen, was gerade in der heutigen Zeit mit ihrem schnellen Fortschritt im technischen und wirtschaftlichen Bereich sinnvoll ist.
Mittels Einbeziehung der GmbH wird die Selbstorganschaft der Personengesellschaften umgangen, so dass die GmbH & Co. KG über flexible Gestaltungsmöglichkeiten des Innenverhältnisses verfügt. Auch die Perpetuierung des Unternehmens wird durch die kapitalgesellschaftliche Komponente gesichert. Abschließend kann man sagen, dass die GmbH & Co. KG eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Nachteilig sei jedoch erwähnt, dass durch die Haftungsbeschränkung mittels der Komplementär-GmbH Dritten gegenüber mitunter keine ausreichende Haftungsbasis geboten werden kann, was sich potentiell bonitätsmindernd auswirken kann.
Literaturverzeichnis
Brönner/Rux/Wagner : Die GmbH & Co. KG in Recht und Praxis, Berlin 1992, 6. Auflage, Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG
Hopt : Handels- und Gesellschaftsrecht, Band II - Gesellschaftsrecht, München 1996, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck
Klamroth : Die GmbH & Co. KG, Heidelberger Musterverträge, Heft 56, Heidelberg 1998, 8. Auflage, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
Klunzinger : Grundzüge des Gesellschaftsrechts, München 1997, 10. Auflage, Verlag Franz Vahlen GmbH
Kraft/Kreutz : Gesellschaftsrecht, Juristische Lernbücher, Band 5, Berlin 1992, 9. Auflage, Alfred Metzner Verlag GmbH & Co. KG
Leuschel : Handelsrecht - schnell erfasst, Heidelberg 2000, 3. Auflage, Springer- Verlag
Mönnig : Gesellschaftsrecht, Schriftenreihe Recht für Kaufleute, München 1989, 1. Auflage, Carl Heymanns Verlag
[...]
1 Vgl. KRAFT/KREUTZ (1992), S. 241.
2 Vgl. KLUNZINGER (1997), S. 218.
3 Vgl. HOPT (1996), S. 259.
4 Vgl MÖNNIG (1989), S. 97 f.
5 Vgl BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 44 f.
6 Vgl LEUSCHEL (2000), S. 179.
7 Vgl HOPT (1996), S. 260.
8 Vgl LEUSCHEL (2000), S. 166.
9 Vgl KLUNZINGER (1997), S. 98.
10 Vgl. MÖNNIG (1989), S. 116.
11 Vgl BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 31.
12 Vgl KLUNZINGER (1997), S. 302.
13 Vgl KRAFT/KREUTZ (1992), S. 178.
14 Vgl. BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 115.
15 Vgl. MÖNNIG (1989), S. 119.
16 Vgl. BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 116.
17 Vgl KLUNZINGER (1997), S. 304.
18 Vgl. KRAFT/KREUTZ (1992), S. 178.
19 Vgl HOPT (1996), S. 193.
20 Vgl. KLUNZINGER (1997), S. 318.
21 Vgl. BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 137 f.
22 Vgl. MÖNNIG (1989), S. 114.
23 Vgl. BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 34.
24 Vgl. KLUNZINGER (1997), S. 304.
25 Vgl. KLUNZINGER (1997), S. 304.
26 Vgl. KRAFT/KREUTZ (1992), S. 178.
27 Vgl. BRÖNNER/RUX/WAGNER (1992), S. 58.
28 Vgl. HOPT (1996), S. 193.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wesentlichen Inhalte des Dokuments über Unternehmensformen?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) und die GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft), einschliesslich ihrer jeweiligen Rollen, Haftung, Innen- und Außenverhältnisse, steuerrechtlichen Behandlung, Unternehmensperpetuierung und Firmenrecht. Es enthält detaillierte Informationen über die Organisation, die Geschäftsführung und die rechtlichen Grundlagen dieser Unternehmensformen.
Was ist eine GmbH und was sind ihre Hauptmerkmale?
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie kann zu jedem zulässigen Zweck errichtet werden, und für ihre Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen. Die GmbH entsteht erst durch die Eintragung in das Handelsregister. Ihre Organisation basiert auf dem Gesellschaftsvertrag, der notariell beurkundet sein muss. Die GmbH handelt durch ihre Organe, den Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.
Was ist eine GmbH & Co. KG und wie unterscheidet sie sich von einer herkömmlichen KG?
Die GmbH & Co. KG ist eine Personengesellschaft und eine Sonderform der Kommanditgesellschaft (KG), bei der die Haftung der Kommanditisten auf ihre Einlage beschränkt ist, während der Komplementär (in diesem Fall die GmbH) unbeschränkt haftet. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen KG haftet bei einer GmbH & Co. KG keine natürliche Person unbeschränkt, da die Komplementär-GmbH mit ihrem gesamten Vermögen haftet.
Welche Rolle spielt die GmbH in der GmbH & Co. KG?
Die GmbH fungiert als Komplementärin in der GmbH & Co. KG. Das bedeutet, dass sie die Geschäftsführung übernimmt und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der KG haftet. Durch diese Konstruktion wird das Haftungsrisiko für die natürlichen Personen, die als Gesellschafter an der GmbH beteiligt sind, beschränkt.
Wie wird die Haftung in der GmbH & Co. KG geregelt?
Die Kommanditisten haften beschränkt bis zur Höhe ihrer Einlage, während die Komplementär-GmbH unbeschränkt mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet. Die Gesellschafter der GmbH haften nur mittelbar mit ihrer in das GmbH-Vermögen geleisteten Einlage.
Wie werden Geschäftsführung und Vertretung in der GmbH & Co. KG geregelt?
Die Geschäftsführung obliegt der Komplementär-GmbH bzw. deren Geschäftsführern. Die Vertretung der KG erfolgt ebenfalls durch die GmbH. Die Kommanditisten sind von der gesetzlichen Vertretung ausgeschlossen.
Wie wird die GmbH & Co. KG steuerrechtlich behandelt?
Die Doppelbesteuerung der GmbH und ihrer Gesellschafter wurde durch die Körperschaftssteuerreform von 1976 weitgehend beseitigt, indem die gezahlte Körperschaftssteuer auf die individuelle Einkommensteuer der Gesellschafter anrechenbar ist. Es gibt jedoch auch Nachteile, wie die Behandlung der Vermögenssteuer als nicht abzugsfähige Ausgabe und die vermögenssteuerliche Doppelbelastung.
Wie wird die Unternehmensperpetuierung in der GmbH & Co. KG sichergestellt?
Durch die Gründung einer GmbH kann der Fortbestand des Unternehmens gesichert werden, da die Existenz der GmbH als Kapitalgesellschaft vom Tod ihrer Gesellschafter unabhängig ist. Dies ist ein wichtiger Vorteil der GmbH & Co. KG, da Personengesellschaften bei Tod eines Gesellschafters nach dispositivem Recht aufgelöst werden.
Welche Bedeutung hat die Sachfirma bei der GmbH & Co. KG?
Die GmbH & Co. KG führt als Kommanditgesellschaft den Namen ihrer Komplementärin. Hierbei besteht die Möglichkeit einer Sachfirma, die dem Gegenstand des Unternehmens entlehnt sein muss. Die Sachfirma einer GmbH kann der GmbH & Co. KG helfen, sich in einer Branche bekannt zu machen.
Was ist das Fazit zur GmbH & Co. KG?
Die GmbH & Co. KG ist eine Kombination aus kapital- und personengesellschaftlichen Elementen, die ihr Flexibilität verleiht. Sie bietet die Möglichkeit, die Haftung zu beschränken und die Unternehmensperpetuierung zu sichern. Ein potenzieller Nachteil ist, dass die Haftungsbeschränkung Dritten gegenüber unter Umständen keine ausreichende Haftungsbasis bietet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2000, Die Rolle der GmbH in der GmbH & Co. KG, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96904