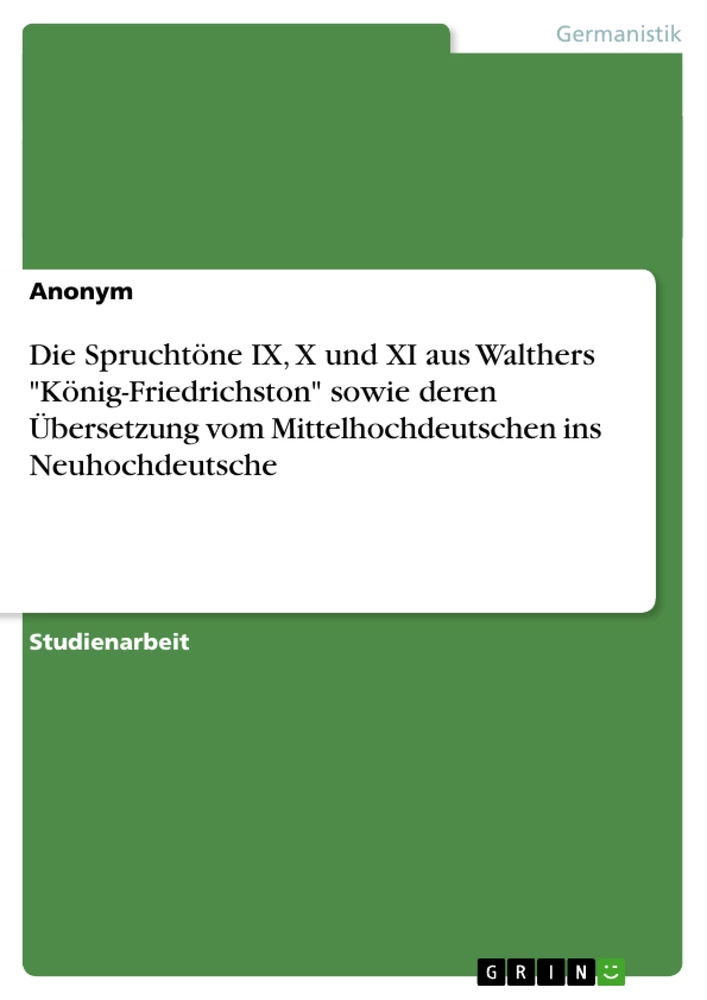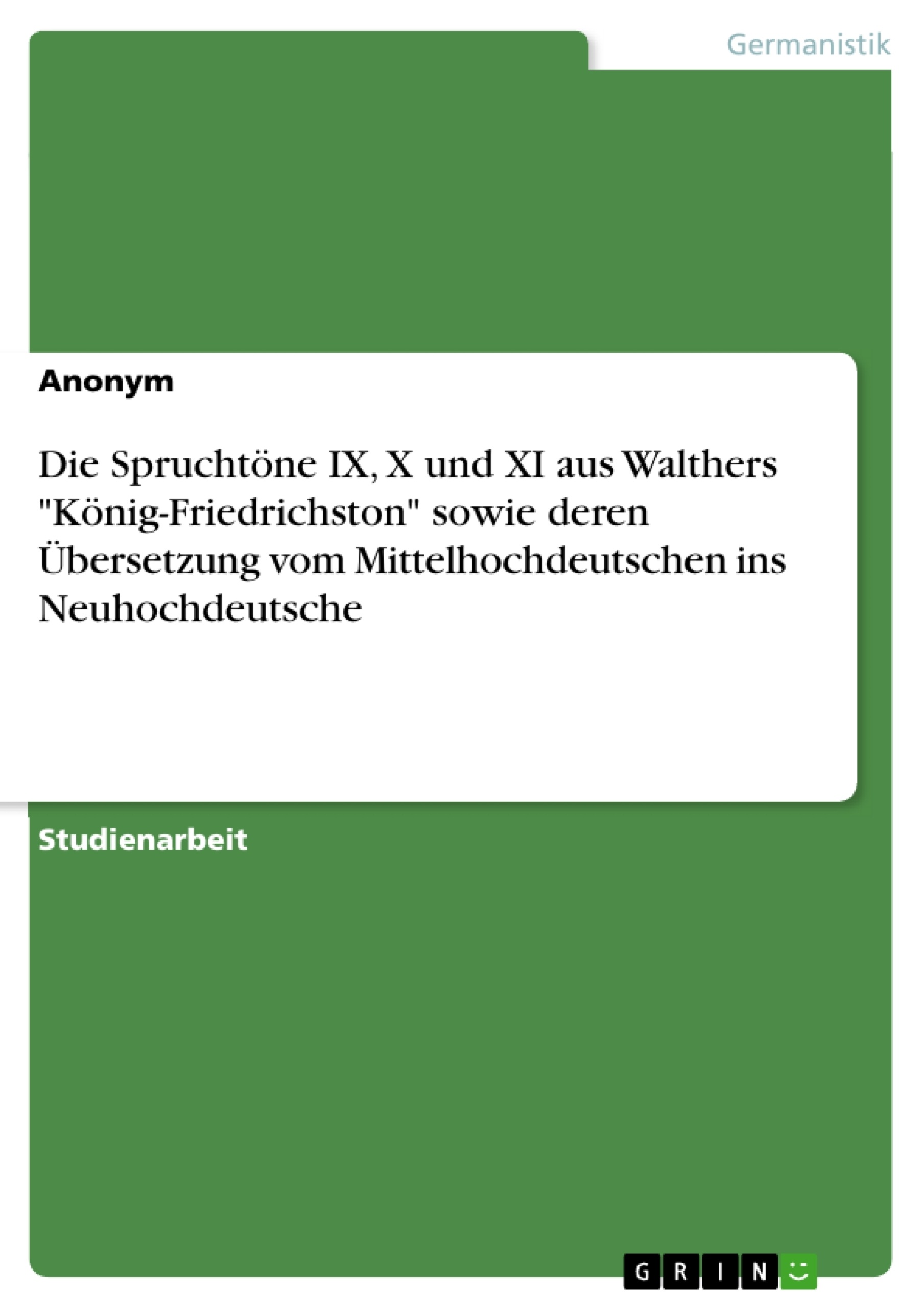Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Mittelalters, wo Macht, Intrigen und die Kunst der Sangspruchdichtung ineinanderfließen! Dieser Band enthüllt die verborgenen Botschaften und politischen Ränkespiele in den Werken Walther von der Vogelweides, insbesondere im "König-Friedrichston". Anhand detaillierter Analysen dreier ausgewählter Strophen – darunter die berühmte "Leopoldstrophe" – wird die Frage nach der Echtheit der Verse neu aufgerollt und mit überraschenden Erkenntnissen untermauert. Entdecken Sie, wie Walther seine Lyrik als Waffe einsetzte, um politische Missstände anzuprangern, Gönner zu preisen und seine eigene Position am Hofe zu sichern. War Walther ein Opportunist oder ein Idealist? Die Auseinandersetzung mit den "Hovebellen", den intriganten Höflingen, die seine Verse verfälschten, offenbart ein spannungsgeladenes Beziehungsgeflecht zwischen Künstler und Mäzen. Die Analyse der Strophen enthüllt nicht nur Walthers virtuose Beherrschung der Dichtkunst, sondern auch die komplexen historischen Zusammenhänge seiner Zeit, die Kärntner Affäre, seine Beziehung zu Leopold VI. von Österreich, Kreuzzüge und die Bedeutung von "triuwe" (Treue) und "untriuwe" (Untreue) als zentrale Motive. Erfahren Sie, wie sich Walthers Kritik an den herrschenden Verhältnissen in subtilen Anspielungen und versteckten Drohungen manifestiert und wie er durch die formale Gestaltung seiner Strophen – der "gespaltenen Weise" – eine einzigartige Ausdruckskraft erzeugte. Die Interpretation der Verse vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umstände ermöglicht ein tieferes Verständnis von Walthers Intentionen und seiner Rolle als politischer Dichter. Lassen Sie sich entführen in eine Welt, in der Dichtung zur politischen Arena wird und die Stimme eines Sängers die Macht hat, Königreiche zu erschüttern! Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für mittelalterliche Geschichte, Lyrik und die Kunst der politischen Botschaft interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt Walther von der Vogelweides, ein Meister der Worte und ein Spiegel seiner Zeit, der es verstand, seine Kunst als Mittel zum Zweck einzusetzen, um seine eigenen Interessen zu vertreten und die Mächtigen seiner Zeit zu kritisieren. Erleben Sie die Macht der Poesie im Mittelalter und entdecken Sie die subtilen Botschaften, die Walther in seinen Versen verborgen hat. Die detaillierte Analyse der formalen Aspekte, wie der "gespaltenen Weise" und der Melodienaufzeichnungen, ermöglicht ein tieferes Verständnis von Walthers Kunst und seiner Fähigkeit, politische Botschaften in ästhetisch ansprechende Verse zu kleiden.
1. Einleitung
„ Die bedeutendste Neuerung Walthers war, daß er der Sangspruchdichtung die politische Thematik erschloß . Politische Lyrik [...] bediente sich bis dahin der lateinischen Sprache. Walther beschränkte sich dabei keineswegs auf lokalgeschichtliche Ereignisse. Seine Aussagen betreffen oder berühren Themen, die für sich und in ihrer Verflechtung der heutigen Geschichtswissenschaft als die entscheidenen des Zeitraums gelten [...]. “ 1
Die politische Lyrik Walthers soll auch in dieser Arbeit anhand von drei Strophen des sogenannten „König-Friedrichstons“, dem umfangreichstem politischen Sangspruch, der unter Walthers Namen überliefert wurde und dessen Teile sich in mehr Handschriften als alle anderen Töne befinden, thematisiert und analysiert werden. Der Sangspruch wurde durch Walther von der Vogelweide gegen Ende des 12. Jahrhunderts zu einer Gattung, die gleichberechtigt neben dem Minnesang stand, und inhaltliche sowie formale Neuerungen in die Lyrik einführte. Leider sind der heutigen Wissenschaft nur einige wenige authentische Schriftstücke erhalten geblieben und so stellt sich auch am Anfang dieser Arbeit, nach der Vorstellung der Textgrundlage sowie deren Übersetzung vom Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche, die Frage nach der Echtheit der Sprüche und ihrer Überlieferung in den verschiedenen Handschriften. Um diesen Aspekt genauer untersuchen zu können ist es notwendig, biographische Zusammenhänge, Verbindungen zu anderen Spruchtönen aber auch formale Gesichtspunkte wie Form und Gestalt der Strophen, sowie deren Metrik zu betrachten. Da es sich um ursprünglich gesungene Lyrik handelt, stellt sich zudem noch die Frage nach der Melodie der Töne, die aber aufgrund unzureichender Primär- als auch Sekundärliteratur nur kurz angeschnitten werden kann. Um die Echtheit der Strophen zu beweisen bleibt es leider manchmal nicht aus, schon einige Punkte - wie zum Beispiel der Interpretation der Strophen - vorwegzugreifen.
Sicherlich wäre es bei diesen Untersuchungen interessant, nach einem möglichen Zusammenhang der Strophen im gesamten König-Friedrichston zu suchen, doch das Ausmaß des Tons, der zudem noch je nach Vortragssituation variiert werden konnte, sowie die meist nur auf Spekulationen beruhende Sekundärliteratur, machen eine solche Analyse in diesem Rahmen unmöglich.
Daher soll nur im Zusammenhang mit der Authentizität und der Interpretation der Strophen auf den sogenannten Unmutston verwiesen werden. Nach gründlicher Analyse der oben genannten Gesichtspunkte sollen die so mehr oder weniger isoliert ermittelten Ergebnisse in einer Interpretation der Strophen vor geschichtlichem Hintergrund zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden, wobei die Frage der Datierung noch genauer erörtert werden muß.
In der vorliegenden Arbeit sollen wissenschaftliche Thesen um den König- Friedrichston sichtbar gemacht werden und so ist es notwendig, die hier erarbeiteten Ergebnisse mit zahlreichen Zitaten zu fundieren. Die herausgestellten Punkte sollen als eine aufeinander aufbauende Folge gesehen werden und die Einteilung in Kapitel lediglich als formale Notwendigkeit. Da es mir aus technischen Gründen der Textverarbeitung nicht möglich war, die von Ranawake gesetzten Lesehilfen für die Elision zu übernehmen, habe ich die entsprechenden Worte im Mittelhochdeutschen Text unterstrichen. Die Kenntnis der hier von mir in alphabetischer Reihenfolge von Ranawake übernommenen Handschriftensiglen wird vorausgesetzt. Die Übersetzung der Strophen erfolgte unter Zuhilfenahme von Schweikle2, Schaefer3 und Wilmanns.4 In Hinblick auf die dürftige Auswahl an Interpretationen bezüglich der hier zu analysierenden Strophen L 28,11, L 28,21 und L XXIX,1 sollen hier Ergebnisse vorgetragen werden, die auf Noltes Arbeit „Höfische Idealität und konkrete Erfahrung“5 basieren.
2. Die Spruchtöne IX, X und XI aus Walthers „König-Friedrichston“ sowie deren Übersetzung vom Mittelhochdeutschen ins Neuhoch- deutsche.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herzoge ûz Ôsterrîche, ez ist iu wol ergangen6 und alsô schône daz uns muoz nâch iu belangen. sît gewis, swenn ir uns komet, ir werdet hôhe enpfangen. Ir sît wol wert daz wir die gloggen gegen iu liuten, dringen unde schouwen als ein wunder komen sî. ir komet uns beide sünden unde schanden frî: des suln wir man iuch loben, und die frouwen suln iuch triuten. Diz liehte lop volfüeget heime unz ûf daz ort: sît uns hie biderbe für daz ungefüege wort, daz iemen spreche, ir soldet sîn beliben mit êren dort.
Übersetzung der Strophe IX:
Herzog von Österreich, es ist Euch wohl ergangen und auf so höfische Weise, daß uns nach Euch verlangen muß! Seid gewiß, wann immer Ihr wieder zu uns kommt, werdet Ihr würdig empfangen. Ihr seid es wohl wert, daß wir Euch die Glocken entgegenläuten lassen, zusammenströmen und schauen, als ob ein Wunder gekommen sei. Ohne Sünde und Schande kommt Ihr zu uns zurück, dafür werden wir Männer Euch preisen und die Frauen lieben. Vollendet Euren glänzenden Ruhm nun zu Hause bis ins kleinste.
Seid edel auch bei uns, dann wird niemand die unpassenden Worte sagen, Ihr wäret besser in Ehren fortgeblieben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein schalc, in swelhem namen er si, der dankes triege sînen herren unde im râte daz er liege! erlamen müez ime sîn bein, swenn erz ze deheime râte biege! Sî aber er sô hêre daz er dâ zuo sitze, sô wünsche ich daz [ime] sîn ungetriuwe zunge erlame. die selben machent uns die biderben âne schame. sol liegen witze sîn, sô pflegent sie schemelîcher witze. Wan mügens in râten daz si lâzen in ir kragen sô valsch geheize oder nâch geheize niht versagen? sie solten geben ê dem lobe der kalc würd abe getragen.
Übersetzung der Strophe X:
Er ist ein Schuft, in welchem Stand er auch lebt, der absichtlich betrügt und seinen Herren das Lügen lehrt.
Erlahmen sollen ihm die Beine, sooft er sie zum Rate beugt! Ist er aber so vornehm, daß er zum Rate niedersitzt, so wünsche ich, daß seine ungetreue Zunge erlahme.
Eben diese Leute machen, daß auch die Anständigen schamlos werden. Wenn Lügen Klugheit sein soll, so üben sie ehrlose Klugheit.
Raten wir Ihnen, sie sollen Ihr Versprechen halten, oder, wenn’s gelogen ist, im Halse stecken lassen.
Sie sollten schenken, ehe dem Lobpreis der Kalk abgschlagen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Swâ nu ze hove dienet der herre sîme knehte und swâ der valke vor dem raben stêt ze rehte, dâ spürt man offenlîche unart, unadel und ungeslehte. Du werdiu ritterschaft, dîn dinc stêt jâmerlîche.
swâ der sester vor dem schilde hin ze hove vert, vrou Êre, dâ sint iuwer snellen sprünge erwert.
wol ûf mit mir und vare wir dâ heim in Ôsterrîche! Dâ vinde wir den fürsten wert, der ist iu holt.
welt ir mich dâ ze hove leiten, als ir solt, sô wirt gehœhet wol dîn name von mir, werdér Liupolt.
Übersetzung der Strophe XI:
Wo immer nun am Hofe der Herr seinem Knecht dient und wo der Falke nach geltendem Recht dem Raben nachgeordnet ist, da spürt man deutlich schlechte Art, schlechten Adel und schlechte Herkunft. Du edle Ritterschaft, Deine Sache steht jammervoll! Wo der Scheffel vor dem Schilde zum Hof geht, Frau Ehre, dort sind Euch Eure kraftvollen Sprünge verwehrt. Wohlauf mit mir - gehen wir heim nach Österreich! Dort finden wir den edlen Fürsten, der Euch gewogen ist. Wollt Ihr mich dort am Hof einführen, wie es Eure Pflicht ist, dann wird Dein Name von mir sehr gepriesen, edler Leopold.
3. Die Frage nach der Echtheit der Strophen
„ Im Verlauf eines mehrfachen Kopierens, Kompilierens, Verbesserns und Angleichens haben die Texte zahlreiche, mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen erfahren, so daß sich eine „ Originalfassung “ nicht wiedergewinnen l äß t, ganz abgesehen davon, daß die im Vortrag lebenden Lieder und Sangsprüchen wahrscheinlich bereits zu Walthers Zeit je nach Vortragssituation variiert worden sind. “ 7
Der König-Friedrichston stellt mit seinen, je nach Anerkennung der Echtheit, maximal 22 Strophen den umfangreichsten überlieferten Spruchton Walthers dar, deren Teile sich in mehr als sieben Handschriften, unter anderem im „Münsterschen Fragment“ (Z), wiederfinden lassen. Die Hauptquellen der Überlieferungen bilden die drei großen Liederhandschriften: Die „Kleine Heidelberger Liederhandschrift“, die „Weingartner Liederhandschrift“ und die „Große Heidelberger oder Manessische Liederhandschrift“, welche von Karl Lachmann mit den Siglen ABC gekennzeichnet wurden. Beschäftigt man sich mit der Frage nach der Echtheit der Strophen, so ist deren Überlieferung in den verschiedenen Handschriften sicherlich nur ein Teil der zu beachtenden Aspekte, doch geben nach Maurer „Ü berlieferung und Strophenbau [...] die wichtigsten philologischen Kriterien für den Grad der Sicherheit, mit dem wir für die Echtheit der Strophen rechnen dürfen. “ 8 Dennoch sollte man biographische Gesichtspunkte, die Form der Strophen, ihre Metrik und ihre gedanklich-syntaktische Gliederung in Hinblick auf ihre Echtheit nicht außer Betracht lassen.
3.1 Die Überlieferung der Strophen in den einzelnen Handschriften
Die hier anfänglich zu analysierende Strophe L 28,11 befindet sich sowohl in der „Kleinen“ als auch in der „Großen Heidelberger Liederhandschrift“ und wird durch die Siglen A 78 und C 359 gekennzeichnet. Die Strophe wurde in der Walther-Forschung allgemein auf Grund ihrer Überlieferung und ihrer formalen Gegebenheiten - auf die später noch genau eingegangen werden soll - als echt bezeichnet. Die bei Ranawake darauffolgende Strophe X (L 28,21) ist sowohl nach der Lachmannschen Zählung, als auch in der „Kleinen Heidelberger Liederhandschrift“ (A 79) an L 28,11 angegliedert. In der „Manessischen Liederhandschrift“ ist diese Strophe durch das Sigle C 313 markiert. Desweiteren befindet sich diese Strophe im sogenannten „Münsterschen Fragment“ (Z 20), welches mit seinen Melodienaufzeichnungen bei weitem die wichtigste Quelle für Walthers Melodien darstellt. Auch diese Strophe wurde nicht zuletzt durch ihre mehrfache Überlieferung von der Wissenschaft als authentisch betrachtet. Die letzte hier zu behandelnde Strophe (L XXXIX,1) folgt auf L 28,11 in Z und stellt eine Besonderheit dar, da sie ausschließlich im „Münsterschen Fragment“ (Z 21) überliefert wurde. Wurden die Strophen L 28,11 und L 28,21 schon allein aufgrund ihres Auftretens in mehreren Handschriften von der Wissenschaft übereinstimmend als authentisch deklariert, so differieren die Meinungen über L XXXIX, 1 um so mehr.
3.2 Biographische Aspekte
Die sogenannte „Leopoldstrophe“ (L 28,11), die sich sowohl in der „Kleinen“ als auch in der „Großen Heidelberger Liederhandschrift“ finden läßt, sowie die Strophe L 28,21, vertreten in AC und Z, werden nicht zuletzt durch ihre thematischen und formalen Verzahnungen mit den Strophen L 36,1 und L 32,27 aus dem Unmutston, welche sich als echt erwiesen haben, als authentisch betrachtet. „ Andererseits muss auch deutlich gesehen werden, dass die inhaltlichen und formalen Bezüge zwischen einzelnen Strophen sehr viel komplizierter sind, wie z.B. hier die nicht zuübersehende Beziehung zwischen L 32,27 und L 28,21; auß erdem zwischen 36,1 und 28,11 [...] “ . 9 Diese enge Beziehung zwischen einzelnen Strophen der Töne läßt sich, hier exemplarisch auch für den Zusammenhang von L 28,11 mit L 36,1 stehend, durch eine nähere inhaltliche Betrachtung von L 28,21 und L 32,27 veranschaulichen. Analysiert man die genannten Strophen unter inhaltlichen Aspekten, wird dadurch sicherlich deren Zusammenhang und deren Authentizität sichtbar, doch wird auch unter interpretatorischer Hinsicht leider einiges vorweggegriffen.
In der Strophe L 32,27 spricht sich Walther gegen die „ hovebellen “ 10 und „ lecker “ 11 aus, die sich selbst verraten wie Mäuse, denen man Schellen umgebunden hat. Er beklagt sich bei Herzog Bernard von Kärnten über einen dieser „Hofköter“, der seinen „ sanc “ 12 am Herzogshof verfälscht hat. Diesen „ hovebellen “ würde Walther eine Lektion erteilen, müßte er nicht auf den Herzog und auf die Gesundheit seines Gegners, der wohlmöglich „ ze kranc “ 13 sei, Rücksicht nehmen.
Nach Theodor Nolte stellt das „ ze kranc “ eine polemische Herabsetzung des Widerparts dar und wirft damit gleichzeitig die Frage nach dem sozialen Status des „ schalcs “ 14 auf, der eine Auseinandersetzung unter Walthers Würde erscheinen lassen könnte.15 So fordert er den Herzog in diesem Spruch auf, sich nach dem genauen Inhalt von Walthers Ton zu erkundigen und ihm danach den Verfälscher seines Liedes zu nennen. Es scheint sich hier also um eine Abwendung Walthers gegenüber dem „ lecker “ zu handeln, der seinen „ sanc “, in dem er seine Enttäuschung über ausgebliebene Kleider - eventuell ein biographischer Hinweis auf nicht erhaltenen Lohn - zum Ausdruck bringt, als „ hovebelle “ am Hof verfälscht und so den Zorn des Herzoges auf Walther lenkt. „ Die Waltherstrophe, die die ganze Affäre verursachte, wird nach [...] Willmanns allgemein mit M. 16,9/ L 28,21 identifiziert [...] “ 16 In dieser Strophe äußert Walther seinen Zorn über einen betrügerischen Ratgeber, der die „ edlen ane schamen “ 17 macht. Der „ schalc “ 18 erweist sich hier, neben der in beiden Strophen aufgeworfenen Standesfrage - „ in swelhem namen er si “ 19 und dem schon erwähnten „ ist er niht ze kranc “ 20 - als Bindeglied zwischen den beiden Strophen. Der letzte Vers - „ sie sollten geben ê dem lobe der kalc würd abe getragen “ 21 - scheint gegen die Edlen selbst gerichtet zu sein und so erwies es sich nicht als allzu schwierig, diese Strophe, die Walther nach Nolte wohl nicht selbst vor dem Herzog von Kärnten vortrug, in verfälschter Form vorzutragen. Den Zorn des Herzogs spürend, fordert Walther ihn auf, sich nach dem wahren Wortlaut zu erkundigen, da er nur so den Inhalt richtig begreifen könnte, der die falschen Ratgeber anprangert.
Durch die schon kurz besprochene Strophe L 32,27 versucht Walther daher so, den Herzog zu beruhigen: „ Edel Kerndenaere [...] milter fürste, marteraere umb ê re. “ 22 Diese wohlmöglich auf biographische Geschehnisse zurück gehende Strophe L 28,21 ist isoliert betrachtet nicht zu verstehen und wird erst durch den Zusammenhang mit L 32,27 verständlich und als authentisch deklariert. Der offensichtlich bestehende Zusammenhang zwischen dem Unmutston und dem König-Friedrichston läßt sich ebenfalls an der hier zu behandelnden Strophe XI (L XXIX,1) erkennen.
3.3 Die Verbindung zum Unmutston
Die voran beschriebenen Ereignisse, auch als „Kärntner Affäre“ bekannt, - die biographischen Ereignisse spielten sich wenn überhaupt am Kärntner Hof ab - ziehen sich ebenfalls durch den folgenden Spruch L XXIX,1, der unter anderem von Maurer und Kraus zu den unechten Sangsprüchen Walthers gezählt wurde, da diese Strophe nur im „Münsterschen Fragment“ überliefert wurde und die Personifikation der „ vrou Ê re “ 23 erst später verbreitet war. Nolte hingegen verweist auf ähnliche Personifikationen Walthers und merkt an, daß Reinmar von Zweter die Personifikation der Ehre, wenn auch ein wenig später, häufig anwandte. Allein sprachliche Besonderheiten und die Tatsache, daß L XXIX,1 nur in Z auftaucht, stellen für Nolte, Plenio und Ranawake jedoch keine ausreichende Argumentation dar, die Strophe als nicht authentisch zu betrachten, folgt sie im „Münsterschen Fragment“ doch direkt auf die als echt anerkannte Strophe L 28,21. Nolte sieht die Strophe L XXIX,1 (Z 21) zwischen der schon besprochenen Strophe L 28,21 (Z 20) und L 30,9 (Z 22), welche sich ebenfalls auf Kärnten beziehen und im „Münsterschen Fragment“ aufeinander folgen. „ Mit dem „ kneht “ , dem der Herr dienen muß , so als stehe der Rabe in der Rangfolge vor dem Falken, ist der „ schalk “ aus M. 16,9/ L 28,21 und M. 15,6/ L 32,27 gemeint. Dieser hatte ja bereits in den genannten Strophen Walther eine Angriffsfläche geboten hinsichtlich seines gesellschaftlichen Ranges.“24
Die Strophen bilden eine Art Kette, die aber nicht unbedingt zwingend zugleich auch als eine Vortragseinheit verstanden werden muß. Auch wenn hier hinsichtlich der Interpretation der Strophen schon einiges vorweg gegriffen wurde, bleibt es auch in dieser Strophe nicht aus, will man ihre Echtheit beweisen, den Zusammenhang zu den schon besprochenen Strophen, den biographischen Hintergrund und ihren Inhalt anzuschneiden, da diese Strophe nach Nolte den Abschluß der zuvor schon aufgegriffenen „Kärntner Affäre“ bildet.
In der schon als echt bewiesenen Strophe L 28,21, dem Ausgangspunkt der „Kärntner Affäre“, deutete Walther nur durch vage Anspielungen, „ in swelhem namen er s î“, auf den Verfälscher seines Tons hin. Dies ändert sich allmählich in der Strophe des Unmutstons (L 32,27), indem er ihn schon als für „ ze kranc “ hielt, um Walther einen „ widerswanc “ 25 zu versetzen. Walther, der durch L 28,21 den Zorn des Herzogs auf sich gelenkt sah und Versuche, den Herzog zu beschwichtigen (L 32,17) keine Früchte trugen, ließ seinem Unmut in L XXIX,1 freien Lauf, indem er den Urheber seines Unglücks an seinem wunden Punkt trifft und den Herzog selbst der Lächerlichkeit preisgibt. Wo der Bauer „ sester “ 26 vor dem „ schilde “ 27 - im übertragenem Sinne ist hier wohl der Ritter gemeint - „ ze hove vert “ 28 und die Ritterschaft nicht mehr ehrvoll ist, wird auch der ganze Hof und mit ihm der Herzog als unadelig bezeichnet. „ Sollte Walther die Strophe noch in Kärnten vorgetragen haben, so muß te er sein Pferd wohl schon gesattelt haben. “ 29
Diese doch offensichtlichen Zusammenhänge der Strophen untereinander und ihre aufeinander folgende Stellung im „Münsterschen Fragment“ sollten ausreichend sein, um L XXIX,1 als authentisch zu deklarieren. Wie schon anfänglich erwähnt, werden aber Überlieferung und biographische Gegebenheiten nicht die einzigen Aspekte der Echtheitsanalyse sein und so sollen die Strophen im folgenden Kapitel unter formalen Gesichtspunkten analysiert werden.
3.4 Analyse der Strophen unter formalen Gesichtspunkten
Betrachtet man die Strophen des König- Friedrichstons unter formalen Gesichts- punkten so wird auffällig, daß zumindest die als echt anerkannten Strophen einhellig dieselbe Bauweise erkennen lassen. „ Formale Eigenheit der Strophen ist eine besondere Dreiteiligkeit der metrischen Struktur und damit der Melodie, nämlich ABA (im Gegensatz zu derüblichen Stollenform AAB [...]). “ 30 Die einzelne Strophe ist offensichtlich in drei Teile geteilt, wobei sich der erste und der letzte Teil durch ihre Form entsprechen. Bei diesen Teilen handelt es sich um je drei Zeilen, die durch den Reim aneinander gebunden sind. Die jeweils ersten beiden Zeilen des ersten und letzten Teils sind als Sechsheber, die dritte Zeile jeweils als Siebenheber zu erkennen, so daß Zeile eins bis drei und Zeile acht bis zehn die gleiche Abfolge der Silben aufweisen. Maurer sieht die drei durch den Reim aneinander gebundenen Zeilen im König-Friedrichston als ineinander gefugt, da sie nach seinen Analysen am Anfang der Strophe durch weiblich volle Kadenz mit folgender Auftaktklosigkeit und am Ende der Strophe durch volle Kadenz mit folgendem Auftakt zu lesen sind.31.
Die sonst übliche Abfolge der Stollen AAB - erster Stollen, zweiter Stollen und Abgesang - wurde hier zu ABA - also erster Stollen, Abgesang und zweiter Stollen - umgestellt. Der erste Stollen ist durch den Reim mit dem zweiten Stollen verbunden und schließt den in der Mitte liegenden Abgesang, der durch sein Volumen das Gebilde dominiert, ein. Der Abgesang beinhaltet in sich einen umarmenden (b:c:c:b) Reim, der nach Kreuzweise (6:7:6:7 Hebungen) metrisiert ist und die Umarmung des ersten und letzten Teils nochmals aufgreift.32 Diese formale Gestaltung der Strophen, in der Wissenschaft auch unter dem Begriff „gespaltene Weise“ bekannt, wird nochmals durch die Melodienaufzeichnung aus dem „Münsterschen Fragment“ (Z), auf das an späterer Stelle noch kurz eingegangen werden soll, deutlich. Wapnewski spricht bei diesem Bauprinzip von einem Triptychon als Ordnungsformel, dessen symmetrische Form nicht nur die äußere, sondern auch die innere Syntax des Tons mitbestimmt und trägt.33
Bis auf die hier besprochene sogenannte Leopoldsstrophe (L 28,11) - die Begrüßung Leopolds nach einem Kreuzzug - erfüllen nach Wapnewski die Sprüche, „ die von der Forschung einhellig als „ echt “ bestimmt sind, ein präzis aufweisbares inhaltlich- thematisches und tektonisches Schema. Sie setzen sich nämlich auseinander mit dem Konflikt von triuwe und untriuwe; und sie sind sämtlich in Aufbau, Darstellung und Stil der Figur der Dreiheit verpflichtet; schließ lich verdichtet sich bei ihnen allen die Aussage im (somit dominierenden) Mittelteil. “ 34 Sicherlich kann Wapnewski in Bezug auf L 28,11 aber nur unter inhaltliche Aspekten von einem Abweichler gesprochen haben, erfüllt die Strophe doch die von ihm geforderte Dreiheit als konstitutives Formprinzip, welches auch bei den hier zu besprechenden Strophen L 28,21 und L XXIX,1 deutlich erkennbar ist.
Durch die Form wird also der Bedeutungsschwerpunkt auf den in der Mitte liegenden Abgesang gelegt, der durch die beiden gleich gebauten Seitenteile hervorgehoben wird. Diese Leseweise wird auch im „Münsterschen Fragment“ (Z) wiedergegeben und Cyril Edwards erkennt in diesem Zusammenhang unter anderem für die oft angezweifelte und nur in Z erhaltene Strophe L XXIX,1 daß, „ the syntax matches the melodic structure perfectly. “ 35
Die Melodienaufzeichnung ist wohl die wichtigste Quelle in Hinblick auf Walthers Melodien, die seinen Tönen zugrunde lagen. In Z sind die drei letzten Zeilen des König-Friedrichstons erhalten und folgt man den hier eben vorgestellten Ergebnissen Wapnewskis und Maurers, so sind die drei ersten Zeilen genauso wie die drei letzten Zeilen zu singen. „ Da es sich bei diesem Ton um eine sogenannte gespaltene Weise handelt, kann man mit einiger Gewiß heit davon ausgehen, daß der in Z nicht erhaltene Anfangsstollen [...] die gleiche Melodie hatte wie der alleinüberlieferte Schluß stollen. “ 36 Um dieses Schema dem Leser näher zu bringen, befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit eine Kopie der Melodienaufzeichnung der ersten Strophe (L 26,3) des König-Friedrichstons, indem sich die hier formal schon besprochenen ersten und letzten drei Zeilen befinden.37
Ursprünglich befinden sich im „Münsterschen Fragment“ Z die letzten drei Zeilen, also der zweite Stollen, des König-Friedrichstons. Durch die hier dargestellten Ergebnisse Wapnewskis und Maurers war es aber möglich, mittels der identische Bauweise der Stollen, den in Z nicht vorhandenen ersten Stollen zuzufügen.
Die hier erläuterten Analysepunkte in Hinblick auf die Echtheit der Strophen L 28,11, L 28,21 und L XXIX,1 deklarieren die drei Strophen als authentisch. L 28,11 überzeugt durch seine Überlieferung in den Handschriften, durch seine enge Beziehung zum Unmutston und durch seine formalen Eigenschaften. Wapnewski sah in dem gesamten König-Friedrichston ein gemeinsames inhaltlich-thematisches Schema, nämlich den Konflikt von triuwe und untriuwe, dessen Aussage sich im dominierenden Mittelteil - im Abgesang - jeder Strophe finden läßt. Sicherlich läßt sich dieser angesprochene Konflikt auf den ersten Blick nicht für die Leopoldsstrophe (L 28,11) feststellen, doch die hier schon besprochenen handschriftlichen, biographischen und formalen Aspekte und zudem noch das Zugeständnis Wapnewskis, daß „ der eine Abweichler (nämlich 28,11) [...] nicht forciert in diesen Kontext gezwungen werden “ 38 sollte, sind mehr als ausreichend , um L 28,11 als authentisch zu betrachten. Dies gilt auch für die Strophe L 28,21, an der exemplarisch die enge Verwandtschaft zum Unmutston bewiesen wurde und die zudem in der „ Kleinen Heidelberger Liederhandschrift “ direkt auf L 28,11 folgt und im „Münsterschen Fragment“ vor L XXIX,1 zu finden ist. Unter formalen Gesichtspunkten erfüllt diese Strophe nicht nur die sogenannte „gespaltene Weise“- die nach Brunner eine Walthersche Besonderheit darstellt39 -, sondern auch den Konflikt von triuwe und untriuwe, der im folgenden Kapitel noch herausgestellt werden soll. Die von der Wissenschaft oft als unecht deklarierte Strophe L XXIX,1 sollte trotz einiger sprachlichen Abweichungen und der anders gestalteten Thematik durch die Erläuterung der Überlieferung, der Bauform und dem nicht zu übersehenden Zusammenhang zum Unmutston überzeugt haben.
4. Interpretation der Strophen
„ Walthers politische Aussagen sind oft deshalb nicht eindeutig auf bestimmt Ereignisse oder sogar Personen zu beziehen, weil sie in konventionellen allgemeineren Formen wie Zeitklage, religiöse Mahnung, vor allem als Herrscherlob und -schelte gestaltet sind. Die Berechtigung, politisch zu urteilen und zu fordern, ist dabei aus allgemein verpflichtenden Idealbildern abgeleitet. Die Forderungen bleiben auffällig oft auf das beschränkt, was auch dem Sänger zukommt: selbst wenn Walther im Namen und Interesse von Fürsten spricht, ist es vor allem die milte, die er zu verlangen berechtigt ist. “ 40
Wurde in den vorherigen Kapiteln das Augenmerk auf die äußere Form gelenkt, soll nun der Inhalt der einzelnen Strophen und ihre Einbindung in den historischen Kontext diskutiert werden. Da es zu der Strophe L 28,11 nur wenige wissenschaftliche Interpretationen gibt, muß auf aufschlußreiche Zitate, welche die Analyseergebnisse fundieren könnten, größtenteils verzichtet werden.
Die hier bereits formal bestimmte „Leopoldsstrophe“ (L 28,11) gehört zu den wenigen Sangsprüchen Walthers, die sich offensichtlich auf eine auch namentlich genannte Person bezieht; sie scheint ein Willkommensgruß für den vom Kreuzzug heimkehrenden österreichischen Herzog Leopold VI. gewesen zu sein. Das es sich hier wahrscheinlich um einen Kreuzzug handelt, wird dadurch deutlich, daß Walther von einer Fahrt spricht, die den Herzog von „ sünden unde schanden fr î“ 41 gemacht hat. Der Herzog ist siegreich aus der Schlacht zurückgekehrt und hat den Glauben im Auftrag Gottes in andere Länder getragen. Auch der Aspekt des ehrenvollen Kreuzzugstod, der durch einen abschließenden Hinweis „ ir soldet s î n beliben mit ê ren dort “ 42 gegeben wird, scheint einen Kreuzzug realistisch zu machen, da der Tod auf dem Schlachtfeld für Gott und Land schon damals als ehrenvoll betrachtet wurde.
Es könnte sich hier also um eine politische Preisung Leopolds VI. handeln, der zu den wenigen Herzögen gehörte, die dem Kreuzzugsaufruf Innozenz III. tatsächlich gefolgt waren. „ Es hatte zu den vordringlichen Zielen Innozenz ‘ III. gehört, den päpstlichen Führungsanspruch auch bei der Durchführung der Kreuzzüge zu realisieren. [...] Dem Kreuzzugsaufruf fogten in gr öß erer Zahl aber nurösterreichische und ungarische Truppen unter Herzog Leopold VI. und König Andreas [...]. “ 43 Nach Nolte bewegen sich daher die Strophen des König-Friedrichston in dem Zeitraum zwischen 1213 und 1219, wobei er die These vertritt, daß sich die Strophe L 28,11 als einzige genau datieren läßt, nämlich auf das Jahr 1219.44 Zu diesem Zeitpunkt kehrte der von kirchlichem Eifer erfüllte Leopold VI. nach seinem 1217 begonnenem Kreuzzug aus Ägypten und Palästina zurück, woraufhin ihm Walther diese Strophe gewidmet haben könnte. Da Leopold aber auch um 1212 zu einem Kreuzzug gegen die Albigenser und Mauren loszog vertreten einige Wissenschaftler auch die Meinung, daß die Strophe L 28,11 schon zu diesem Zeitpunkt entstanden sein könnte. Auf die Frage nach der Datierung soll aber an späterer Stelle noch genauer eingegangen werden.
Im ersten Stollen (Zeile 1-3) der Strophe L 28,11 wird Leopold VI. als ein Herrscher beschrieben, der seine Schuld gegenüber dem Papst und somit gegenüber Gott durch den Kreuzzug ruhmreich abgetragen hat und so soll sein Sieg ehrenvoll durch die Frauen und Männer gefeiert werden. Der dominierende mittlere Teil konzentriert sich weiterhin auf die Preisung Leopolds und den Ruhm, der ihn erwartet. Gleichzeitig bittet Walther den Herzog jedoch im zweiten Stollen (Zeile 8-10), auch sich der ihm entgegengebrachten hohen Ehre würdig zu erweisen. „ It is a veiled Bittlied, in that Walther bids Leopold treat uns in such a way that the reputation he has won himself will not be tarnished. “ 45 Die Strophe L 28,11 könnte als reine panegyrische Dichtung aufgefaßt werden, würde der zweite Stollen nicht auch gleichzeitig als eine Art Forderung Walthers gegenüber Leopold verstanden werden können.
Es könnte aber auch sein, daß Walther diese Strophe gar nicht vor dem Herzog selbst vortrug, sondern vor österreichischen Adeligen sang, die Leopold VI. - in Hinblick auf den letzten Vers - lieber außer Landes wünschten. Daß es sich hier um eine Art Forderung Walthers handelt, scheint aber wahrscheinlicher, setzt man die Strophe L 28,11, wie schon vorher erwähnt, mit der Strophe L 36,1 - die wahrscheinlich an den österreichischen Adel gerichtet war - aus dem Unmutston in Verbindung.
In der Strophe des Unmutston spricht sich Walther gegen Leopolds nicht vorhandene milte aus, da Leopold vor dem kostenträchtigen Kreuzzug seine Ausgaben drastisch verringerte, was sicherlich auch die Sangspruchdichter zu spüren bekamen. Da Leopold nun ruhmreich aus der Schlacht zurückgekehrt war, sah Walther in L 28,11 vielleicht keinen Grund mehr, diese Sparmaßnahmen aufrecht zu halten und appellierte an Leopolds milte.
„ Walthers Drohung scheint das Versäumte einklagen zu wollen. Vielleicht hat er sich aber auch insgeheim sich nicht mehr viel von Leopold erhofft. “ 46 Der zweite Stollen von L 28,11 konnte daher auch als eine provozierende Drohung aufgefaßt werden, falls Leopold nach seiner Rückkehr „ daz liehte lop “ 47 nicht auch in Wien vollenden könnte. Das Leopold diese Provokation wortlos hingenommen hat, ist kaum denkbar. Es wird angenommen, daß man die Reaktion Leopolds auf die Strophe L 28,11 in der etwas später entstandenen Strophe L 35,17 des Unmutston finden kann, in der Walther beschreibt, wie er vom Herzog von Österreich „ ze walde “ 48 gewünscht wurde. Mit dieser Strophe (L 35,17) kam es zum endgültigem Bruch zwischen Herzog Leopold VI. und Walther von der Vogelweide. Walther, der aufgrund der von Leopold ausgesprochenen Verwünschungen, die als Reaktion auf L 28,11 zu verstehen sein könnten, auf ein Entgegenkommen seitens Leopold nicht mehr zu hoffen brauchte und daher auch nichts mehr zu verlieren hatte, gab die Verwünschungen postwendend mit den Worten „ wis d û von dan, l â mich b î in: s ô leben wir sanfte beide “ 49 an den Herzog zurück und das Verhältnis zwischen Herzog und Sänger war somit beendet. Ehnert erkennt an dieser Stelle die milte -Thematik als eines der Grundthemen im König-Friedrichston. Wer gutes tut, triuwe und milte besitzt und zudem noch l ô nen kann wird vom Volk geliebt. Wer aber dank falscher Ratgeber - auf diese Begebenheit soll an späterer Stelle noch eingegangen werden - seine Versprechen nicht halten kann, wird mit der untriuwe seiner Gefolgsleute rechnen müssen. Walthers eigenes Schicksal und Handeln ist nach Ehnert ein Beispiel für diese Dialektik, die sich ansatzweise hier, aber besonders in dem Verhältnis zu Otto wiederspiegelt.50
Diese biographischen Ereignisse machen daher deutlich, daß es sich bei L 28,11 also nur auf den ersten Blick um eine reine Preisung Leopolds handelt, in der oberflächlich betrachtet seine höfischen Tugenden herausgestellt werden. Die Tugenden der êre und der milte werden hier angesprochen, doch durch die in Zeile 10 zweideutige und provozierende Bemerkung leicht ironisiert.
Die zweite hier zu behandelnde Strophe L 28,21, die inhaltlich bereits kurz angesprochen wurde, steht in engem Kontakt zu der Strophe L 32,27 aus dem Unmutston. In dieser Strophe des Unmutston geht es wie auch in L 28,21 - und wie später noch deutlich wird auch in L 32,17 - um die falschen Ratgeber der Fürsten. Der Sänger wendet sich in L 32,27 gegen die „ hovebellen “ , die sich wie Mäuse, denen man Schellen umgebunden hat selbst verraten. Er beschwert sich im dominierenden Mittelteil (Zeile 5-10) beim Herzog von Kärnten über einen dieser Höfköter, der seinen Gesang beim Herzog verfälscht hat. Am liebsten würde Walther dem Verfälscher einen Gegenschlag versetzten, doch nimmt er Rücksicht auf den Herzog und auf seinen eigenen Ruf, der durch eine Auseinandersetzung mit dem niederen „ hovebellen “ angekratzt werden könnte. Schaefer übersetzt die für uns in Bezug auf L 28,21 wichtigen Strophen wie folgt:
„ Ich muß mich arg bei dir beklagen, edler Herr von Kärnten, freigebiger Fürst und Märtyrer der Ehre. Ich weiß nicht, wer an deinem Hof soübel verdreht, was ich singe. Ich schlage genauso hart zurück, wenn ich ’ s nicht lasse aus Rücksicht auf dich und wenn der Kerl mir nicht zu wenig ist. Frag doch, was ich gesungen habe, und finde heraus, wer es verdreht. “ 51
Eine weitere Parallele zu L 28,21 in Bezug auf die verlogenen Räte und falschen Ratgeber läßt sich in L 32,17 finden. Dort geht es hintergründig um ein vom Herzog versprochenes Kleidergeschenk, welches Walther aber nicht erhält und dieser sich daraufhin zu einer Unmutsäußerung verleiten läßt, die wiederum den Zorn des Herzogs auf den Sänger lenkt. Walther versucht sodann den erzürnten Herzog von Kärnten durch L 32,17 zu beschwichtigen, indem er seine Unmutsäußerung abstreitet und die Schuld auf seine Untertanen schiebt, die sicherlich gegen seine Anordnungen verstießen, als sie ihm die Kleider nicht aushändigten. An dieser Stelle sieht Ehnert eine Verbindung zwischen dem nicht ausgehändigtem Lohn und der in L 28,21 ausgesprochene Drohung in Vers Zehn.
Betrachtet man L 28,21 in Zusammenhang mit Strophe L 32,17 und L 36,1, „ so kann man wohl nicht an der Einsicht vorbeigehen, dass aus allen diesen Stellen ein gewisser Groll Walthers spricht: gegen jemanden, der sich windet wie ein Aal, um sein Versprechen nicht zu halten, eine einmal versprochene Gabe nicht zu gewähren oder auszuzahlen. “ 52
Nach Wilmanns und Kraus beziehen sich L 32,17 und L 32,27 auf ein und dieselbe Situation. Walther wendet sich in diesen Strophen gegen den „ lecker “ , der den Anweisungen des Herzogs nicht folgt, zudem noch seinen „ sanc “ verfälscht und so den Zorn des Herzogs auf den Sänger lenkt. Ursprung der ganzen Affäre soll die hier zu besprechende Strophe L 28,21 sein, in der Walther die Betrüger am Hofe angreift, die ihre Herren schamlos werden lassen, da sie sie zum Lügen verleiten.53
Als wichtigstes Bindeglied zwischen den drei Strophen stellt sich der „ schalc “ und die aufkommende Standesfrage heraus. Sollten in L 28,21 die Betrüger am Hofe angeklagt werden, so erscheint der letzte Vers - „ sie sollten geben ê dem lobe der kalc würd abe getragen “ - gegen die Adeligen selbst gerichtet zu sein.
Offensichtlich trug Walther diese Strophe nicht persönlich vor dem Herzog vor und es erwies sich aufgrund des letzten Verses als einfach, sie ihm in verfälschter Form zu überbringen, so daß er sich selbst als Lügner hingestellt sah, obwohl Walther doch die falschen Ratgeber damit meinte. Vermutlich überbrachte man dem Herzog den Spruch nur teilweise, so daß er sich selbst mit dem „ schalc “ identifizierte. So kommt es zu L 32,27, in der Walther den Herzog auffordert, sich nach dem Inhalt seines Spruches zu erkundigen, um so zu erkennen, wer wirklich mit dem „ schalc “ gemeint war.
In Bezug auf den Zusammenhang der Strophen L 28,21 und L 32,27 sind in der Walther-Forschung noch andere Meinungen vertreten. So erkennt beispielsweise Jungbluth keinerlei Zusammenhang zwischen L 28,21 und L 32,27, da er die letztgenannte Strophe als einen Aufruf Walthers an seine Gönner versteht, sie mögen die Würde seiner Sangeskunst, die durch die Nachahmung seiner Lieder durch „ hovebellen “ angetastet wird, schützen. Dies ergibt aber so keinen rechten Sinn, werden doch die Nachahmer, die Mißbrauch an seinen Liedern betreiben, als „ lecker “ bezeichnet, zielt dies doch eher auf Menschen ab, die sich auf Kosten Walthers beim Herzog ins rechte Licht setzten wollen. Schiendorfer entdeckt lediglich eine Verbindung zwischen L 28,21 und L 32,33. Dort erkennt er am Schluß der Strophe - „ fr â ge waz ich habe gesungen, und ervar uns werz verk ê re “ 54 - eine Aufforderung Walthers, der Herzog möge den Wortverdreher dadurch ermitteln, daß er jeden einzelnen seiner Höflinge über den Inhalt der im Moment gesungenen Strophe L 32,27 befragt. Nach Walthers Darstellung liegt dem Wortverdreher das Lügen im Blut und so würde er sich schnell verraten, da er es auch nicht lassen könnte diesen Spruch (L 32,27) zu „ verk ê ren “ . Nach Nolte jedoch stört diese Interpretation die Einheitlichkeit der Strophe. Er ist der Ansicht, daß sich der Überbringer der falschen Strophe schon allein dadurch als „ schalc “ zu erkennen geben hat, da er vor dem Herzog als Anschwärzer - besinnt man sich auf den verkehrt überbrachten Inhalt zurück - und nach Walthers Ansicht als Betrüger aufgetreten ist.55
Walthers schlechte Erfahrungen, die er am Kärntner Hof machte, mußten den Sänger sehr verbittert haben und so sucht er in materieller Not den Wiener Hof auf und singt wahrscheinlich die hier zu analysierende Strophe L XXIX,1 und zieht einen Schlußstrich unter die sogenannte „Kärntner Affäre“. Auch zu dieser Strophe Walthers gibt es kaum Literatur, da ein Großteil der Forschung sie als unecht deklarierte. Der Bruch zwischen Walther und dem Herzog von Kärnten war vollzogen und so ließ der verbitterte Sänger in L XXIX,1 seinem Groll freien Lauf, indem er den Herzog an seinem wunden Punkt traf. Er gibt dem Herzog der Lächerlichkeit preis und bezweifelt die höfischen Tugenden am Kärntner Hof: „ sw â nu ze hove dienet der herre s î me knehte und sw â der valke vor dem raben st ê t ze rehte “ 56. Hier stellt Walther offensichtlich den Adel des Kärntner Hofes in ein schlechtes Licht. Es läßt sich eine Verbindung zu dem „ schalc “ aus L 28,11 und L 32,27 erkennen, da der Herr dem „ kneht “ dienen muß und der Rabe in der Rangfolge vor dem Falken steht und somit abermals der gesellschaftliche Rang bei Walther thematisiert wird. Ließ er es in L 28,21 noch bei einer vagen Anspielung - „ in swelhem namen er s î - hielt er ihn bereits in L 32,34 für „ ze kranc “ , als das der „ schalc “ ihm was antun könnte. In dieser Strophe wird aber der Ritter bereits hinter dem Bauern angesiedelt.
In der zweiten Strophenhälfte kündigt Walther seine Rückkehr nach Österreich an und erweckt den Verdacht, daß L XXIX,1 für Leopold VI. gedacht war, wenn nicht sogar vor ihm vorgetragen wurde. Walther erhebt sich in diesem Strophenteil zum „ Sachverwalter der „ vrou Ere “ [...] dessen „ snelle /.../ sprünge “ beim Kärntner Hof verhindert werden. “ 57
Die Ehre soll Walther zum Hof nach Österreich begleiten und ihn dort bei Hofe einführen. Hiermit könnte sich auch Leopold angesprochen gefühlt haben, wird es hier doch deutlich, daß Walther sich vom Wiener Hof die ehrenvolle Behandlung erhofft, die ihn in Kärnten nicht zuteil wurde. Sollte Leopold bereit sein, Walther an seinem Hof aufzunehmen, so verspricht ihm der Sänger als Gegenleistung die Preisung seines Namens.
Walther tadelt hier also die verkehrten Zustände an einem Hofe - wenn auch nicht namentlich genannt, so dürften wohl die biographischen Hintergründe auf den Kärntner Hof lenken, dem nun der Verputz abgeschlagen wird - und preist demgegenüber die ‚Frau Ehre‘ am Hofe Leopolds in Österreich. Leopolds Reaktion muß zur Zufriedenheit Walther ausgefallen sein, läßt sich doch wenig später eine Dankstrophe für den Herzog finde. Walthers Verhältnis zu seinem Gönner verschlechtert sich aber wohl in der Vorbereitungszeit auf Leopolds Kreuzug, prangert der Sänger doch seine nicht mehr vorhandene Wohltätigkeit an (L 36,1). Die Beziehung erfährt einen endgültigen Bruch durch Walthers Begrüßungsstrophe (L 28,11), dessen zweideutiger Schlußvers Leopold dazu verleiten, den Sänger fort zu wünschen (L 35,17).
Eine exakte Datierung der beiden Töne erweist sich trotz der relativ genauen Einordnung der sogenannten Leopoldsstrophe (L 28,11) als recht schwierig und ungenau. Betrachtet man den Unmutston und den König-Friedrichston, so erhält man eine Vorstellung von Walthers Spruchdichtung in der zeit von 1212 bis ca. 1220. Der Unmutston erstreckt sich laut wissenschaftlicher Analysen, auf die hier nicht näher eingegangen werden sollen, zwischen Winter 1212/13 bis ungefähr 1219. Wann Walther die erste Strophe des König-Friedrichston erschuf, hängt von dem Zeitpunkt ab, als Walther das erste mal vor dem König auftrat. Der erste Ton wird zwischen 1213 und der Schlacht von Bouvines (27. Juli 1214) datiert, wofür es aber auch keine genauen Beweise gibt. Die hier genannten Zusammenhänge zwischen den beiden Tönen lassen einige chronologische Verbindungen erahnen.
Leopold brach zwischen 1212/13 und 1217 zum Kreuzzug auf, d.h., daß Walther in diesem Zeitraum mindestens einmal in Wien gewesen sein mußte. Aus L 36,1 läßt sich schließen, daß Walther, der in dieser Strophe Leopolds Sparsamkeit anprangert, die Vorbereitungen zum Kreuzzug miterlebt haben mußte.
Für die Leopoldstrophe käme also 1212/13 oder 1219 in Frage, wobei ich mich nach der Mehrheit der wissenschaftlichen Ergebnisse richten möchte, die diese Strophe auf 1219 datierten. Nach der Begrüßungsstrophe ist das Verhältnis zu Leopold zerrüttet und Walther wendet sich an Friedrich II. Die Strophe L XXIX,1 scheint auch in den Zeitraum zwischen 1212/13 und 1217 zu fallen, jedoch vor seinen Aufenthalt in Wien im Sommer des Jahres 1217, da in dieser Strophe ausdrücklich auf seine Fahrt nach Wien hingewiesen wird.
Sicherlich kann diese chronologische Abfolge nicht als absolut angesehen werden, soll sie doch nur ein Versuch sein, die einzelnen Strophen anhand von einigen wenigen Eckdaten in einem historischen Kontext unter zu bringen.
5. Schlußwort
„ Philologisch und historisch abgesichert l äß t sich hinsichtlich der Lebenswirklichkeit der Sangspruch-Sänger das folgende grundsätzlich feststellen [...]: Sie war bestimmt durch ihre existentielle Abhängigkeit von ihrem wechselndem Publikum, von Gönnern und Auftraggebern - sowie von Konkurrenz untereinander. [...] Die Abhängigkeit von Publikum und Gönnern hatte Auswirkungen auf Form und Inhalt: Herrscher- und Gönnerlob war lebensnotwendig, das Publikum muß te immer wieder an die Bezahlung (milte) gemahnt werden. “ 58
In der vorliegenden Arbeit sollten die Strophen L 28,11, L 28,21 und L XXIX,1 des König-Friedrichston von Walther von der Vogelweide unter biographischen und formalen Gesichtspunkten in Hinblick auf ihre Echtheit und ihre Interpretation untersucht und analysiert werden. Es zeigte sich hier, daß der Versuch einer biographischen Rekonstruktion der damaligen Verhältnisse überraschend viele Ergebnisse in Bezug auf Echtheit und Verständnis der Strophen beitrug. Betrachtet man das oben stehende Zitat, so kann es sich in dieser Arbeit sicherlich nur um einen Verusch handeln, die damaligen Ereignisse um Walther von der Vogelweide ausschnitthaft darzustellen, um einen ausschnitthaften Einblick in das Leben des Sängers zu erhalten. Letztendlich kann sich die Wissenschaft nur auf historische Eckdaten stützen und daraus folgernd Möglichkeiten und Vermutungen erschließen, die alles andere als authentisch sein müssen, welche aber der Schlüssel zum Verständnis von Walthers Spruchdichtung sein könnten.
Wie aus diesem Zitat und besonders durch die Strophe L 28,11 ersichtlich wird, war Walther Zeit seines Lebens auf Gönner angewiesen. Diese existentielle Abhängigkeit zwangen den Dichter oft dazu, Texte zu ändern, Strophen anders zusammen zu fügen und die Lieder auf das Publikum abzustimmen. Deutlich wird diese Situation durch die Ereignisse um L 28,21. Dem Herzog wurde eine Strophe Walthers falsch überliefert und der Sänger hatte in Anbetracht der für ihn entstehenden Konsequenzen um sein Wohl zu fürchten.
„ Gerade die höfischen Epiker, die auf die Kontinuität günstiger Arbeitsverhältnisse angewiesen waren, sind durch Gönnerverlust oder Gönnerwechsel besonders gefährdet gewesen. “ 59 Doch Standen die Sänger den Herren auch nicht ganz wehrlos gegenüber, konnten sie doch durch ihre Inhalte in ihren Liedern dem Ansehen eines Hofes nutzen und auch schaden, wie in Strophe L XXIX,1 deutlich wurde. Sicherlich hätte eine genauere und umfassendere Betrachtung der Verhältnisse Walthers zu seinen Gönnern und Auftraggebern weitere Sinnzusammenhänge erschlossen, doch wurden diese nur selten persönlich genannt und man müßte sich auch hier wieder größtenteils auf Vermutungen stützen.
6. Literaturverzeichnis
- Brunner, Horst: Walther von der Vogelweide. Epoche, Werk, Wirkung. München 1996.
- Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick. Stuttgart 1997.
- Bumke, Joachim: Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland. 1150-1300. München 1979.
- Edwards, Cyril: Edwards, Cyril: What’s in a dôn? Problems of Unity and Authenticity in the König- Frierichtston. In: Oxford German Studies. Walther von der Vogelweide. Twelve Studies. Oxford 1982.
- Ehnert, Rolf: Möglichkeiten politischer Lyrik im Hochmittelalter. Frankfurt/ M. 1976.
- Hahn, Gerhard: Walther von der Vogelweide. Eine Einführung von Gerhard Hahn. In: Artemis Einführungen. Bd. 22. München und Zürich 1986.
- Haverkamp, Alfred: Aufbruch und Gestaltung. Bd. 2. Deutschland 1056-1273. München 1984.
- Maurer, Friedrich: Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide. Tübingen 1972.
- Nolte, Theodor: Walther von der Vogelweide. Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. Stuttgart 1991.
- Ranawake, Silvia (Hrsg.): Walther von der Vogelweide. Gedichte. Teil 1. Der Spruchdichter. 11 Auflage auf der Grundlage der Ausg. Von Hermann Paul. Tübingen 1997.
- Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972.
- Schweikle, Günther (Hrsg.): Walther von der Vogelweide. Werke Gesamtausgabe. Bd. 1. Spruchlyrik. Stuttgart 1994.
- Wapnewski, Peter: Die triuwe und die Dreiheit. Zu Walthers von der Vogelweide König-Friedrich-Ton. In: Staufer Zeit. Geschichte/ Literatur/ Kunst. Stuttgart 1978.
- Wilmanns, W.(Hrsg.): Walther von der Vogelweide. In: Germanistische Handbibliothek. Bd. 2. Halle 1924.
8. Anhang
Bauform der Strophen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufzeichnung der Melodie der Zeilen Eins bis Drei und Acht und Zehn:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Hahn, Gerhard: Walther von der Vogelweide. Eine Einführung von Gerhard Hahn. In: Artemis Einführungen. Bd. 22. München und Zürich 1986. S. 109.
2 Schweikle, Günther (Hrsg.): Walther von der Vogelweide. Werke Gesamtausgabe. Bd. 1. Spruchlyrik. Stuttgart 1994.
3 Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972.
4 Wilmanns, W.(Hrsg.): Walther von der Vogelweide. In: Germanistische Handbibliothek. Bd. 2. Halle 1924.
5 Nolte, Theodor: Walther von der Vogelweide. Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. Stuttgart 1991. S. 44. (künftig zitiert als: Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung).
6 Basierend auf der Textgrundlage von: Ranawake, Silvia (Hrsg.): Walther von der Vogelweide. Gedichte. Teil 1. Der Spruchdichter. 11 Auflage auf der Grundlage der Ausg. Von Hermann Paul. Tübingen 1997.
7 Ranawake, Silvia (Hrsg.): Walther von der Vogelweide. Gedichte. Teil 1. Der Spruchdichter. 11. Auflage auf der Grundlage der Ausg. Von Hermann Paul. Tübingen 1997. S. XXIX. (künftig zitiert als: Ranawake: Walther von der Vogelweide).
8 Maurer, Friedrich: Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide. Tübingen 1972. S. 84.
9 Ehnert, Rolf: Möglichkeiten politischer Lyrik im Hochmittelalter. Frankfurt/ M. 1976. S. 291.
10 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 1. S. 29.
11 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 3. S. 29.
12 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 7. S. 29.
13 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 8. S. 29.
14 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 4. S. 29.
15 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 44.
16 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 45.
17 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,21. V 6. S. 38.
18 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,21. V. 1. S. 38 und L 32,27. V. 4. S. 29.
19 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,21. V. 1. S. 38.
20 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 8. S. 29.
21 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,21. V. 10. S. 38.
22 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 5 und V. 6. S. 29.
23 Ranawake: Walther von der Vogelweide. LXXIX,1. V. 6. S. 38.
24 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 49.
25 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 32,27. V. 9. S. 29.
26 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L XXIX,1. V. 5. S. 38.
27 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L XXIX,1. V. 5. S. 38.
28 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L XXIX,1. V. 5. S. 38.
29 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 49.
30 Brunner, Horst: Walther von der Vogelweide. Epoche, Werk, Wirkung. München 1996. S. 179.
31 Maurer, Friedrich: Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide. Tübingen 1972. S. 84.
32 Die Bauform der Strophen wird im Anhang durch eine von Peter Wapnewski übernommenen Skizze noch einmal verdeutlicht.
33 Wapnewski, Peter: Die triuwe und die Dreiheit. Zu Walthers von der Vogelweide König-Friedrich- Ton. In: Staufer Zeit. Geschichte/ Literatur/ Kunst. Stuttgart 1978. S. 116.
34 Wapnewski, Peter: Die triuwe und die Dreiheit. Zu Walthers von der Vogelweide König-Friedrich- Ton.In: Staufer Zeit. Geschichte/ Literatur/ Kunst. Stuttgart 1978. S. 116.
35 Edwards, Cyril: What’s in a dôn? Problems of Unity and Authenticity in the König-Frierichtston. In: Oxford German Studies. Walther von der Vogelweide. Twelve Studies. Oxford 1982. S. 147.
36 Ranawake: Walther von der Vogelweide. S. XLII.
37 Die Kopie der Melodienaufzeichnung stammt aus: Ranawake: Walther von der Vogelweide. S.148.
38 Wapnewski, Peter: Die triuwe und die Dreiheit. Zu Walthers von der Vogelweide König-Friedrich- Ton. In: Staufer Zeit. Geschichte/ Literatur/ Kunst. Stuttgart 1978. S. 116.
39 Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick. Stuttgart 1997. S.185
40 Hahn, Gerhard: Hahn, Gerhard: Walther von der Vogelweide. Eine Einführung von Gerhard Hahn. In: Artemis Einführungen. Bd. 22. München und Zürich 1986. S. 128.
41 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,11. V. 6. S. 38.
42 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,11. V. 10. S. 38.
43 Haverkamp, Alfred: Aufbruch und Gestaltung. Bd. 2. Deutschland 1056-1273. München 1984. S. 217.
44 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 71.
45 Edwards, Cyril: Edwards, Cyril: What’s in a dôn? Problems of Unity and Authenticity in the König-
Frierichtston. In: Oxford German Studies. Walther von der Vogelweide. Twelve Studies. Oxford 1982.
S. 146.
46 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 58.
47 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L 28,11. V. 8. S. 38.
48 Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972. L 35,17. V. 2. S. 294.
49 Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972. L 35,17. V 10. S. 294.
50 Ehnert, Rolf: Möglichkeiten politischer Lyrik im Hochmittelalter. Frankfurt/ M. 1976. S. 305.
51 Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972. L 32,27. V 5-10. S. 299.
52 Ehnert, Rolf: Möglichkeiten politischer Lyrik im Hochmittelalter. Frankfurt/ M. 1976. S. 302.
53 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 45.
54 Schaefer, Jörg: Walther von der Vogelweide. Werke. Darmstadt 1972. L 32,27. V. 10. S. 298.
55 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 46.
56 Ranawake: Walther von der Vogelweide. L XXIX,1. V. 1. S. 38.
57 Nolte, Theodor: Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. S. 49.
58 Brunner, Horst: Brunner, Horst: Walther von der Vogelweide. Epoche, Werk, Wirkung. München 1996. S. 140.
Häufig gestellte Fragen zum Text
Was ist der König-Friedrichston und worum geht es in dieser Analyse?
Der König-Friedrichston ist der umfangreichste überlieferte Spruchton Walthers von der Vogelweide. Diese Analyse konzentriert sich auf drei Strophen (L 28,11, L 28,21 und L XXIX,1) aus diesem Ton und untersucht diese hinsichtlich ihrer Echtheit und ihrer Interpretation, wobei biographische und formale Aspekte berücksichtigt werden. Es wird versucht, die Strophen in ihren historischen Kontext einzuordnen.
Wie wird die Echtheit der Strophen untersucht?
Die Echtheit der Strophen wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, darunter: die Überlieferung in verschiedenen Handschriften (z.B. Kleine Heidelberger Liederhandschrift, Große Heidelberger Liederhandschrift, Münstersches Fragment), biographische Aspekte (Verbindungen zu anderen Spruchtönen wie dem Unmutston), formale Gesichtspunkte (Form und Gestalt der Strophen, Metrik) und die gedanklich-syntaktische Gliederung.
Welche Rolle spielt der Unmutston bei der Echtheitsanalyse?
Der Unmutston, ein weiterer Spruchton Walthers, spielt eine wichtige Rolle, da inhaltliche und formale Bezüge zwischen einzelnen Strophen des König-Friedrichstons und des Unmutstons bestehen. Diese Bezüge dienen als Indiz für die Echtheit der Strophen.
Was ist die "Kärntner Affäre" und wie hängt sie mit den Strophen zusammen?
Die "Kärntner Affäre" bezieht sich auf biographische Ereignisse am Kärntner Hof, bei denen es zu Auseinandersetzungen zwischen Walther und den Ratgebern des Herzogs kam. Die Strophen L 28,21 und L XXIX,1 werden im Zusammenhang mit dieser Affäre interpretiert.
Was sind die formalen Merkmale der Strophen des König-Friedrichstons?
Die Strophen weisen eine besondere Dreiteiligkeit der metrischen Struktur auf (ABA), im Gegensatz zur üblichen Stollenform AAB. Die einzelne Strophe ist in drei Teile geteilt, wobei sich der erste und der letzte Teil durch ihre Form entsprechen. Diese Teile bestehen aus je drei Zeilen, die durch den Reim aneinander gebunden sind. Der Abgesang in der Mitte beinhaltet einen umarmenden Reim und dominiert das Gebilde.
Was ist die Bedeutung der Melodienaufzeichnungen im "Münsterschen Fragment"?
Das "Münstersche Fragment" (Z) enthält Melodienaufzeichnungen zum König-Friedrichston und ist daher eine wichtige Quelle, um die musikalische Gestaltung der Töne zu verstehen. Es unterstützt die Analyse der formalen Struktur der Strophen.
Wie wird die Strophe L 28,11 (Leopoldstrophe) interpretiert?
Die Leopoldstrophe wird als Willkommensgruß für Herzog Leopold VI. von Österreich nach seiner Rückkehr von einem Kreuzzug interpretiert. Sie kann aber auch als versteckte Bitte oder sogar Drohung Walthers an Leopold verstanden werden.
Worum geht es in der Strophe L 28,21?
Die Strophe L 28,21 thematisiert die falschen Ratgeber der Fürsten und deren negativen Einfluss. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Strophe L 32,27 aus dem Unmutston.
Wie wird die Strophe L XXIX,1 interpretiert?
Die Strophe L XXIX,1 drückt Walthers Groll über die Zustände am Kärntner Hof aus und kündigt seine Rückkehr nach Österreich an. Er tadelt die verkehrten Zustände an einem Hof und preist demgegenüber die ‚Frau Ehre‘ am Hofe Leopolds in Österreich. Sie bildet den Abschluss der "Kärntner Affäre".
Wie genau lassen sich die einzelnen Strophen datieren?
Eine exakte Datierung der Strophen ist schwierig. Die Leopoldstrophe (L 28,11) wird meist auf das Jahr 1219 datiert, während die anderen Strophen in den Zeitraum zwischen 1212 und ca. 1220 eingeordnet werden.
Welche Rolle spielt die "milte" (Freigebigkeit) in Walthers Dichtung?
Die "milte" (Freigebigkeit) ist ein wichtiges Thema in Walthers Dichtung. Er war auf Gönner angewiesen und mahnte diese oft zur Freigebigkeit. Der Mangel an "milte" bei Leopold VI. wird in Strophe L 36,1 kritisiert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2000, Die Spruchtöne IX, X und XI aus Walthers "König-Friedrichston" sowie deren Übersetzung vom Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96836