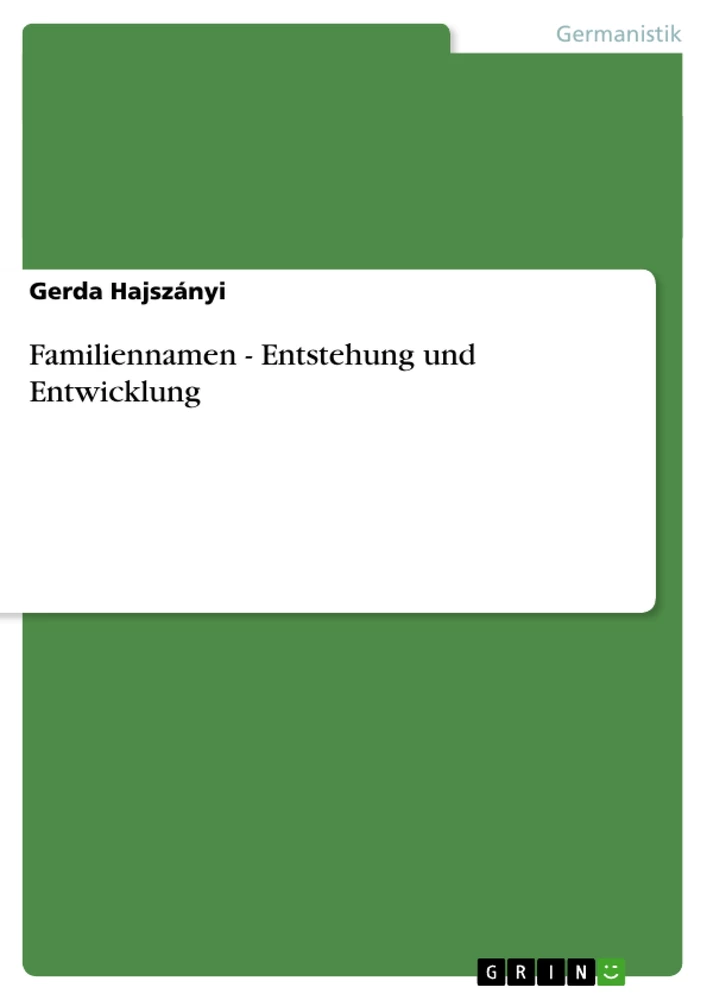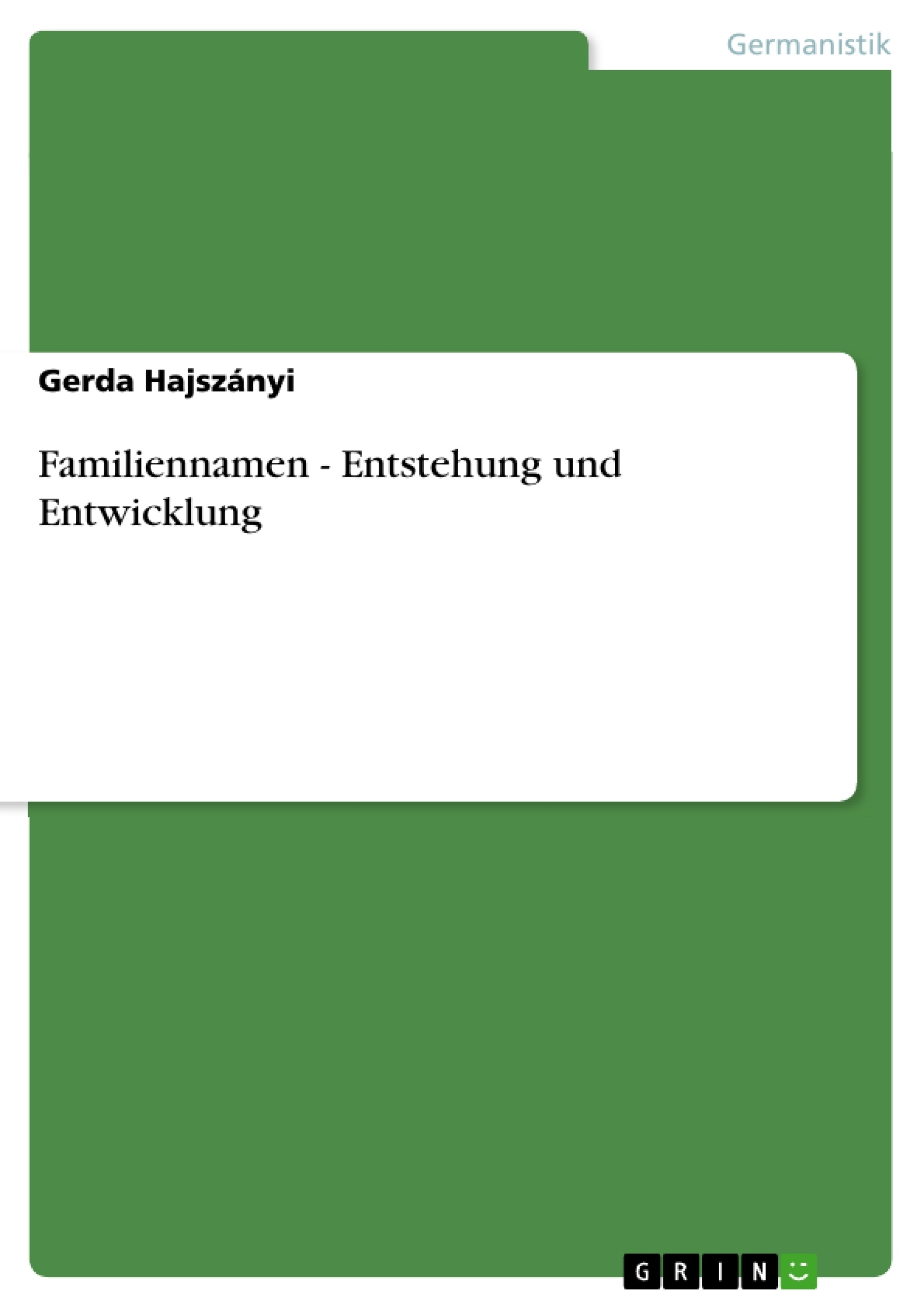Haben Sie sich jemals gefragt, woher Ihr Familienname stammt und welche verborgene Geschichte er erzählt? Dieses Buch enthüllt auf faszinierende Weise die Entstehung und Entwicklung deutscher Familiennamen, beginnend mit den frühesten Formen der Personenbezeichnung bis hin zur Festigung der Nachnamen, wie wir sie heute kennen. Tauchen Sie ein in die Welt der Rufnamen, Beinamen und ihrer allmählichen Umwandlung in ererbte Familiennamen. Entdecken Sie die vielfältigen Ursprünge: von Vatersnamen und Herkunftsbezeichnungen über Wohnstättennamen bis hin zu Berufsbezeichnungen und Übernamen, die oft skurrile Einblicke in das Leben unserer Vorfahren gewähren. Anhand zahlreicher Beispiele wird die Bedeutung bekannter und weniger bekannter Familiennamen entschlüsselt, wodurch ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Gesellschaft entsteht. Erfahren Sie, wie soziale Veränderungen, Migration und die Entwicklung der Verwaltung die Namensgebung beeinflussten. Dieses Buch ist nicht nur eine spannende Lektüre für Ahnenforscher und Sprachinteressierte, sondern auch eine lehrreiche Reise in die Vergangenheit, die uns die kulturellen und historischen Wurzeln unserer Identität näherbringt. Es beleuchtet, wie unsere Namen zu einem Spiegelbild der Geschichte wurden, der die Berufe, Herkünfte und sogar die Charaktereigenschaften unserer Vorfahren widerspiegelt. Werfen Sie einen Blick auf die häufigsten Familiennamen Deutschlands und entdecken Sie die überraschenden Geschichten, die sich hinter ihnen verbergen. Lassen Sie sich von der Vielfalt und dem Reichtum der deutschen Namenslandschaft begeistern und begeben Sie sich auf eine persönliche Spurensuche nach den Ursprüngen Ihres eigenen Namens. Dieses Buch bietet Ihnen das notwendige Wissen und die Inspiration, um die faszinierenden Geheimnisse Ihrer Familiengeschichte zu entschlüsseln. Es ist eine Fundgrube für jeden, der sich für Namenkunde, Genealogie und die Kulturgeschichte Deutschlands interessiert.
FAMILIENNAMEN
ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG
Verständigung zwischen Menschen erfolgte über Sprache; sie mussten sich dabei selbst mit einbeziehen, indem sie sich Namen gaben, die sie als Einzelwesen kennzeichnete (Individualisierung).
Dieser eine Name, der Rufname, reichte lange Zeit aus, um seinen Träger in den einstmals kleinen, weniger differenzierten Sozialverbänden zu kennzeichnen.
In manchen Situationen wurden einnamige Personen schon immer durch Zusätze besonders gekennzeichnet, etwa zu Auszeichnung (Karl der Große), zur Unterscheidung (Pippin derältere/Jüngere), zur Charakterisierung (Ludwig der Fromme) etc.
Diese Beinamen dienten der Kennzeichnung einer einzigen Person (nicht der ganzen Sippe oder Familie) und wurde nicht vererbt.
Die Zweinamigkeit wurde zur genaueren Kennzeichnung der Individuen notwendig.
1. Immer mehr Menschen trugen denselben Rufnamen, da sich die Bandbreite der germanischen Rufnamen verringert hatte und die christlichen Namen als Ersatz nicht ausreichten. Auch der Brauch der Nachbenennung erhöhte die Zahl gleichnamiger Personen. → Nachträgliches Darüberschreiben von Beinamen in Urkunden über die Rufnamen
2. In den Städten konzentrierten sich immer mehr Einwohner auf engem Raum; um 1400 haben Lübeck, Hamburg, Frankfurt/M., Nürnberg, Regensburg, Augsburg, Ulm, Straßburg, Zürich ca. 20.000 Einwohner, Köln sogar 30.000. Dies und auch die zunehmende Mobilität, besonders im Handel, erforderte klare Unterscheidung gleichnamiger Personen.
3. Rapide zunehmende schriftliche Verwaltung im Spätmittelalter mit Bürgerverzeichnissen, Urkunden usw. erforderte exakte Personenidentifizierung: „ Es klaget Heiny Huber der pfister (Bäcker) zum Holder (Hausname) uff Hansen Koffel genant Beck der pfister...“.
Übergang zur Zweinamigkeit:
In Urkunden und anderen Quellen lässt sich seit Anfang des 12. Jh. eine verstärkte, dann zunehmend regelmäßige Personenbezeichnung mit Ruf- und Beinamen beobachten.
Dabei wird oft der Beiname ausdrücklich als solcher gekennzeichnet: Giselher genant Obst („Obstbauer“), statt genannt oft auch heisset/dictus/cognomine u.ä.
Damit beginnt der entscheidendste Einschnitt unserer Namensgeschichte: der Übergang von der Einnamigkeit zur Zweinamigkeit.
Ntürlich waren Beinamen schon vorher beliebt. Viele altüberlieferte Namen lassen sich nur als Beinamen verstehen: Burgio „der Bürge“, Krispo „der Krauskopf“ oder Strubil/Strobil „der Strubelkopf“ → Familiennamen Strobel, Straub, Struve.
Nach 1350 war die Zweinamigkeit in den Städten so üblich, dass das Fehlen eines Beinamens selbst zum Beinamen werden konnte: Heinrich ane czunamen „Heinrich ohne Beinamen“ (1361 Breslau).
Die Entwicklung führt nun aus dem Nebeneinander verschiedener okkasioneller Zusätze über relativ beständige Beinamen schließlich zu den Familiennamen, die sich speziell aus folgenden Gründen entwickelt haben:
1. Erbansprüche auf Besitz, Beruf usw. lassen sich durch einen vererbten Namen ausdrücken. (Vorrangig und zuerst beim Adel.)
2. Beeinflussung durch die romanischen Nachbarländer, in denen Beinamen/Familiennamen erstmals im 9. Jh. in Venedig aufkommen.
3. Genealogische Zusammenhänge, besonders zu Verwaltungszwecken, können durch Familiennamen bestens durchschaubar gemacht werden. Daher wurden sie später behördlich vorgeschrieben.
Ein Familienname entsteht, wenn der Beiname einer Person auf deren Nachkommen vererbt wird.
„Vokabularius ex quo“ (meistbenutztes lat.-dt. Wörterbuch des MA: Beiname wird als „gemeinsamer Name der ganzen Verwandtschaft“ definiert („cognomen: zuname, quasi commune nomen totius parentelae“)
Noch Beiname oder schon Familienname ?
1. Die Vererbung ist mehrere Generationen nachweisbar. Unsicher, weil auch Berufe und Wohnstätten vererbbar sind und entsprechende Beinamen bei Vater und Sohn jeweils neu entstehen können.
2. Geschwister tragen denselben Namen: Hermann und Joseph genant Keyser.
3. Der Name passt inhaltlich nicht zur betreffenden Person:
Thewes Einarm hat zwei Arme, Fritsche genant Hamburger war nie in Hamburg. In Bürgerbüchern, die meist den Beruf mit angeben, kann man verfolgen, wie Namen nach Berufen und die tatsächlichen Berufe der Betreffenden immer häufiger voneinander abweichen, z.B. Hermann Pfannensmit der garnzuger (Garnzieher). In vielen diesen Fällen müssen ererbte Familiennamen vorliegen.
4. Wegfall von Verbindungsgliedern zwischen Rufnamen und Beinamen: Hennich Kotzhusen statt Hennich von Kotzhusen, Witche Schenke statt Witche der/genant Schenke, Johan Dietrich statt Johan Dietrichs sun (Sohn).
Die fünf Gruppen der Familiennamen
1. Vaternamen
- Patronyme, -nymika: Personen wurden nach dem Rufnamen ihres Vaters benannt. → Hans Petersohn, Karl Friedrich (s).
- Metreonyme, -nymika: Von der Mutter abgeleitete Familiennamen sind seltener. → Meiensohn „Sohn der Maria“.
- Sekundäre Patronymika: Familiennamen, die nicht aus dem Rufnamen, sondern aus einer anderen Kennzeichnung des Vaters entstanden sind: → Kurt Beckers, „Kurt, der Sohn des Bäckers“.
Entstehung:
Familiennamen aus Rufnamen sind aus der Kennzeichnung des Verhältnisses einer Person zu einer anderen entstanden. Dies ist meist der Vater, es kann aber auch eine andere Person sein.
Bildung:
- Durch Zusammensetzung mit Wörtern für Sohn/Tochter. → Andersen.
- Durch Genitiv: → Otto Hinrichs statt Otto, Hinrichs Sohn.
- Durch einfache Addition: → Andr é Gerard, Walter Franz.
Die Familiennamen, die aus Rufnamen entstanden sind, sind noch heute ein Spiegel der mittelalterlichen Rufnamengeschichte.
2. Herkunftsnamen
- nach Völkern/Ländern (Ungermann, Unger „der Ungar“), Stämmen (Bayer) und Regionen (Bergstr äß er).
→ Allgaier „der aus dem Allgäu“, Böhm/Bea/Beheim „der Böhme“. - nach Orten: Basler, Köl(l)n.
Entstehung:
Die Familiennamen entstanden in einer Zeit starker Binnenwanderungen. Die Städte blühten auf und zogen die Landbevölkerung an. Die Zugezogenen benannte man gern nach ihrer Herkunft: → van Beethoven „aus Betuwe“ (in Belgisch - Limburg). Bildung:
- Im Oberdeutschen ab 1400 der artikellose Typus auf -er, -ler, -ner. → Furtwängler, Wiesentner.
- Im Mitteldeutschen ist ab Ende 15. Jh. das von verschwunden und hat den Typ „bloßer Ortsname“ hinterlassen. → Auerbach, Steinhagen.
- Im Niederdeutschen ebenfalls „bloßer Ortsname“, doch auch die Form auf -mann.
3. Wohnstättennamen
- Einheimische wurden oft nach der Stätte banannt, an der sie wohnten: → Dorer „der am Tor“, Mo(o)ser, Holzer (am Gehölz).
- Namen nach Beschaffenheit der Landschaft → Berger, Steiner, ...
- Aus Häusernamen abgeleitet: → Lilje „der im Haus zur Lilie“.
Entstehung:
Theoretisch können sich aus den Bezeichnungen und den Namen jeder Örtlichkeit Familiennamen entwickeln.
Gruppe 2 und 3 sind oft schwer zu trennen. Ein Althaus oder Berg kann in einem alten Haus bzw. am Berg wohnen, aber auch aus einem der vielen Orte namens Althaus bzw. Berg zugezogen sein. Daher werden die Wohnstättennamen oft als Untergruppe der Herkunftsnamen behandelt.
4. Berufsnamen
Diese Gruppe stellt im deutschen Sprachgebiet mit Abstand die häufigsten Namen und gibt einen Überblick über Berufe und Berufsbezeichnungen im Spätmittelalter, der Epoche des Festwerdens unserer heutigen Familiennamen.
Personen wurden nach ihrer gesellschaftlichen Stellung benannt, besonders Stand und Beruf: → Silcher „der Fleischräucherer“.
- direkte - bezeichnen den Beruf unmittelbar → Wagner.
- indirekte - bezeichnen den Beruf nur mittelbar, z.B. nach einem
charakteristischen Werkzeug oder Merkmal dieses Berufes:
→ Mehlhose den Müller, Hebel (Sauerteig) den Bäcker, Hammer den Schmied.
Indirekte Berufsnamen beziehen sich zwar auf den Beruf, aber in der Art von Übernamen. → Kapp kann ein Übername für den Träger einer Mütze/Kapuze sein, aber auch ein indirekter Berufsname für deren Hersteller.
Entwicklung:
In der agrarwirtschaftlichen Gesellschaft war die berufliche
Differenzierung noch relativ gering; um so häufiger wiederholen sich Familiennamen wie → Bauer, Müller, Schmied, Schäfer. Die Entwicklung der Städte und mit ihnen des Handwerkerstandes brachte dagegen eine gewaltige Ausfaltung von Berufsbezeichnungen und damit Familiennamen.
Bildung:
- Endung -er: → Jäger, Fleischer, Sänger, ...
- Endung -eker: → Pötteker, Spilleker, Höseker, ...
- Endung -macher/-maker/-werker: → Hutmacher, ...
5. Übernamen
Der Träger wird nach körperlichen, charakterlichen oder biographischen Eigenheiten benannt: → Frahm „der Tüchtige“.
Bildung:
- direkt: → Greulich (schrecklich), Gro ß, ...
- metaphorisch: → Sperling für kleinen, lebhaften Menschen, Sturm für aufbrausenden Menschen, ...
- metonymisch: durch Gegenstände, Redewendungen, Ereignisse, die in realer Beziehung zur Person stehen. → Sonntag (der am S. geboren ist),
Herzog (steht im Dienst des Herzogs), ...
Die häufigsten Familiennamen in Deutschland 1995 aufgrund der Telefonanschlüsse:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Deutschsprachige Schriftsteller:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bedeutung einiger Familiennamen:
Alexander, 1140 Alexander. RN griech. „der Männer abwehrende; Schützer“.
Baedeker, → Bötticher 1395 Bothecher, 1445 Boticher. BN zu mhd. botecher „Büttner“ der Bottiche = hölzerne Gefäße mit nur einem Boden macht.
Bau(e)r, bair. Pau(e)r, nd. Buhr: 1311 Pauwer, 1486 Bawer. BN zu mhd. bür(e) „Bauer, Nachbar“ (büw → re „Bauer; Erbauer“), der in Gegensatz zum Meier nicht bevorrechtete, in bescheidenen Verhältnissen lebende Bauer. (Bermadinger, HN zu ON Bermatingen)
Chmelar, BN zu tschech. chmel, poln. chmiel „Hopfen“, einer der Hopfen anbaut oder mit Hopfen handelt.
Damisch, 1433 Domisch, 1530 Damisch. KF zu slaw. RN wie Domaslav → Domann. (slav. doma „zu Hause“)
Erhard(t), Erhardt, Erhart, 1103 Erard, 1365 Erhart. RN era-hart „Ehrt, Ansehen“ + „hart, streng“.
Fellner, Feldner, zum mehrf. ON Felden, Velden.
Faulhaber 1221 Vulhaber, 1385 Faulhaber. ÜN zu mhd. vul, voul „morsch, faul, verfault, durch Fäulnis verdorben, stinkend“ + haber(e) „Hafer“, wohl für einen Bauern, dessen Äcker durch schlechtes Getreide gekennzeichnet sind, wahrscheinlich allg. abwertend.
Gottschalk, Gottschald, Gottschlich, vor 866 Godescalc, 1317 Gottschalk,1378
Gotschalich, 1529 Gotschalh, 1661 Goschlig. RN ahd. got-scalk „Gott“ + „Knecht, Sklave, Diener“.
Huber, Hübner 1224 Huob→re. BN zu mhd. houber, houb(e)ner „Inhaber einer hoube (=ein Stück Land von einem gewissen Maße, Hufe), Erblehnbauer“.
Iffland, HN zum geographischen Namdn Livland, heute Teil Lettlands und Estlands.
Jungblut(h), 1544 Jungebloidt, 1585 Jungeblodt. ÜN zu mhd. junc „jung, vergnügt“ und bluot, pluot „lebendes Wesen, Mensch“.
Kugler 1245 Cugelar, 1380 Kugeler. Ün zu mhd. gugel → re, gugler „der eine gugel (=mhd. kugel, gugel(e) „Kapuze“) trägt; evtl. auch BN Hersteller einer gugel.
Leitner, Leithner 1336 Lextner, 1474 Lewthener. WN zum ÖN zu mhd. lite „Gergabhang, Halde; Tal“ für einen, der an einem Berghang wohnt, auch HN zum ON Leiten, Leithe, Leuthen.
Mautner, Mauter 1293 Moutt→r, 1355 Meutner. BN zu mhd. mut → re, muter „Zolleinnehmer, Zöllner“.
Niedermeier 1405 Nedermeygere. WN bzw. BN zu mhd. nider(e) „nieder, unter“ und Meyer = der unten (am Dorfende) gelegene Meier(hof).
Oswald 1294 Oswaldus, 1422 Oswald. RN asä. os-waldan „Gott“ + „herrschen“. Patzak 19. Jh. Pacak. Ün zu tschech. pacati „verpfuschen“.
Quadflieg ÜN „böse Fliege“. Mnd. quat „böse, boshaft, schlecht, falsch, zornig, aufgebracht“ oder „Kot, Dreck, Unflat“.
Rußwurm 1180 Rußwurm. ÜN zu mhd. ruoz „Ruß, Schmutz, und wurm „Wurm, Insekt“ für die Schabe, Assel; die SpottN für den Schmied und den Köhler sind jung.
Schubert, Schuchter BN zumhd. schuo(ch)würthe, -worte, -würke, mhn. schowerchte, - werte, -wart „Schuhmacher“.
Tappert 1469 Taphart. ÜN zu mhd. taphart, daphart „Art Mantel (aus dem franz. tabard, mlat. tabardum) wohl für einen Schneider.
Uebelacker, Übelacker 1224 Ubilacker. ÜN zu mhd. ü bel(e) „böse, boshafte Art“ und acker „Ackerfeld“ wohl für einen Bauern.
Val(l)entin 1494 Valentyn. RN Valentin, lat „vielvermögend“.
Wurm, nd. Worm: 1173 Wormb, 1232 Wurm. ÜN zu mhd. wurm, mnd. worm „Wurm, Insekt; Natter; Drache, bildlich Teufel“/ demin. Und patron. Würmeling: 1185/94 Würmelin, Würmelinc.
Häufig gestellte Fragen zu FAMILIENNAMEN: ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG
Was sind die Ursachen für die Entstehung von Familiennamen?
Die Entstehung von Familiennamen wurde durch mehrere Faktoren begünstigt. Dazu gehören: die Zunahme gleichnamiger Personen aufgrund begrenzter Rufnamenauswahl und Nachbenennung, die wachsende Bevölkerungsdichte in Städten, die Notwendigkeit einer klaren Personenidentifizierung in der zunehmenden schriftlichen Verwaltung des Spätmittelalters sowie Erbansprüche auf Besitz und Beruf.
Wie verlief der Übergang von der Einnamigkeit zur Zweinamigkeit?
Der Übergang zur Zweinamigkeit erfolgte schrittweise. Seit dem 12. Jahrhundert wurden Ruf- und Beinamen zunehmend gemeinsam verwendet, wobei der Beiname oft explizit als solcher gekennzeichnet wurde (z.B. durch Zusätze wie "genannt"). Nach 1350 war die Zweinamigkeit in Städten üblich. Der Entwicklung führte von okkasionellen Zusätzen über relativ beständige Beinamen zu den vererbten Familiennamen.
Welche Hauptgruppen von Familiennamen gibt es?
Es gibt fünf Hauptgruppen von Familiennamen:
- Vaternamen (Patronyme)
- Herkunftsnamen
- Wohnstättennamen
- Berufsnamen
- Übernamen
Was sind Vaternamen (Patronyme) und wie entstanden sie?
Vaternamen sind Familiennamen, die vom Rufnamen des Vaters abgeleitet sind. Sie entstanden durch Kennzeichnung des Verhältnisses einer Person zum Vater (oder einer anderen Person). Die Bildung erfolgte durch Zusammensetzung mit Wörtern für Sohn/Tochter, durch Genitiv oder durch einfache Addition der Namen.
Was sind Herkunftsnamen und wie entstanden sie?
Herkunftsnamen bezeichnen die geografische Herkunft einer Person, z.B. nach Völkern, Ländern, Stämmen, Regionen oder Orten. Sie entstanden in Zeiten starker Binnenwanderungen, als Zugezogene oft nach ihrem Herkunftsort benannt wurden.
Was sind Wohnstättennamen und wie entstanden sie?
Wohnstättennamen beziehen sich auf den Wohnort einer Person, z.B. nach der Beschaffenheit der Landschaft oder nach Hausnamen. Einheimische wurden oft nach der Stätte benannt, an der sie wohnten. Da sie schwer von Herkunftsnamen zu trennen sind, werden sie oft als Untergruppe der Herkunftsnamen behandelt.
Was sind Berufsnamen und wie entstanden sie?
Berufsnamen bezeichnen den Beruf oder die gesellschaftliche Stellung einer Person. Sie können direkt oder indirekt auf den Beruf hinweisen, z.B. durch die Bezeichnung eines charakteristischen Werkzeugs oder Merkmals des Berufs. Die Entwicklung der Städte und des Handwerkerstandes führte zu einer Vielzahl von Berufsbezeichnungen und damit Familiennamen.
Was sind Übernamen und wie entstanden sie?
Übernamen bezeichnen eine Person nach körperlichen, charakterlichen oder biographischen Eigenheiten. Die Bildung kann direkt (z.B. "Groß"), metaphorisch (z.B. "Sperling" für einen kleinen, lebhaften Menschen) oder metonymisch (z.B. "Sonntag" für jemanden, der an einem Sonntag geboren ist) erfolgen.
Welche Familiennamen sind in Deutschland am häufigsten?
Laut einer Erhebung von 1995 (basierend auf Telefonanschlüssen) gehören zu den häufigsten Familiennamen in Deutschland Müller, Schmidt, Schneider, Fischer, Weber, Meyer, Wagner, Schulz, Becker und Hoffmann.
Welche Bedeutung haben einige der genannten Familiennamen?
Der Text beschreibt die Bedeutung und Herkunft einer Reihe von Familiennamen, darunter Alexander, Baedeker, Bauer, Chmelar, Damisch, Erhard(t), Fellner, Faulhaber, Gottschalk, Huber, Iffland, Jungblut(h), Kugler, Leitner, Mautner, Niedermeier, Oswald, Patzak, Quadflieg, Rußwurm, Schubert, Tappert, Uebelacker, Val(l)entin, Wurm und Zanke. Die Erklärungen umfassen linguistische Details und historische Kontexte.
- Quote paper
- Gerda Hajszányi (Author), 2000, Familiennamen - Entstehung und Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96788