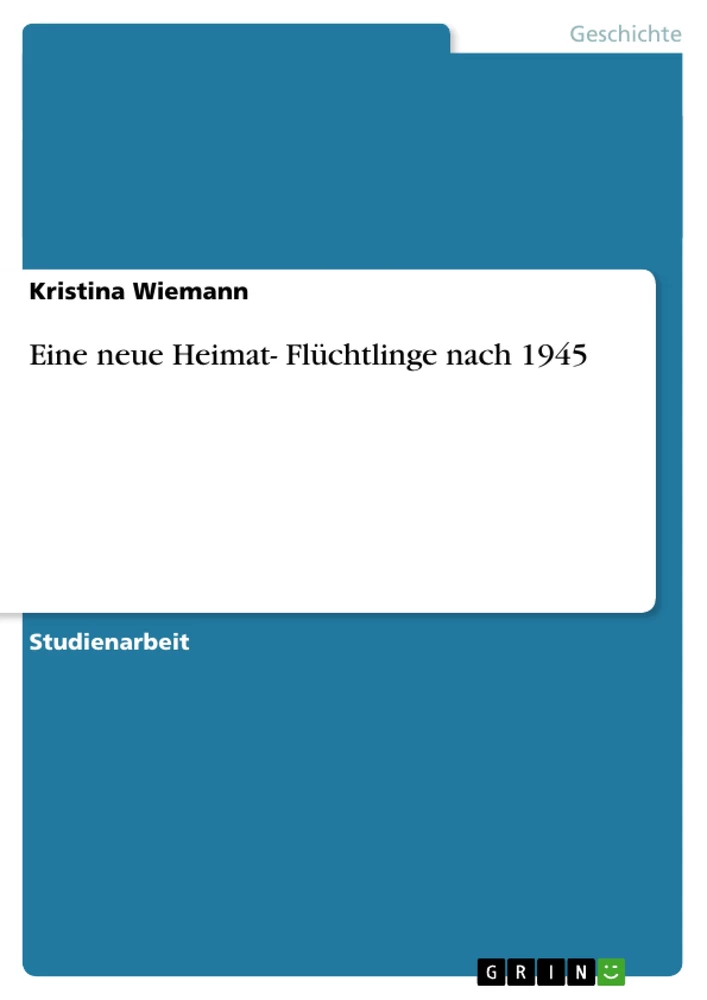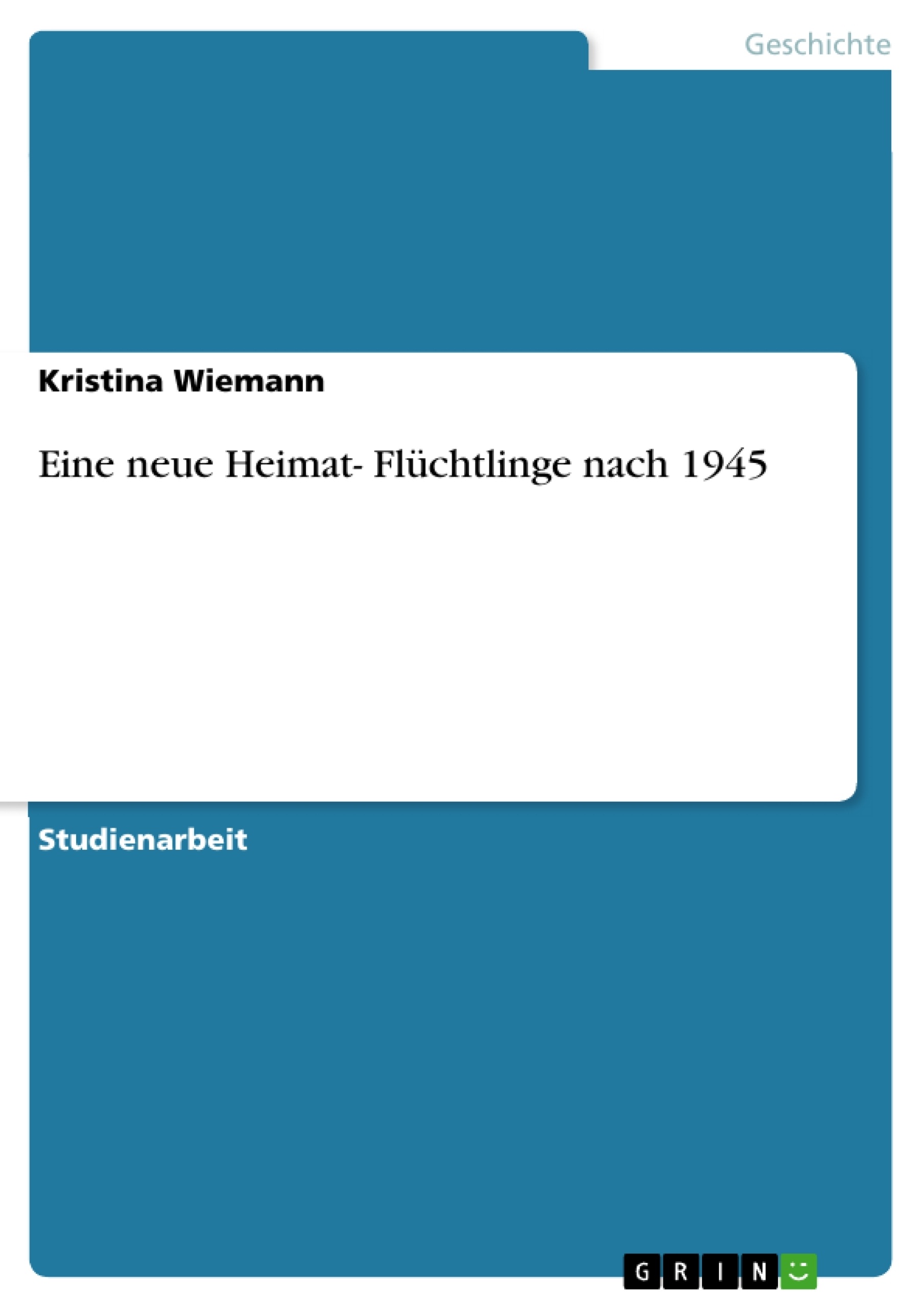Wie eine Stadt am Scheideweg ihre Identität neu erfand: Tauchen Sie ein in die bewegende Geschichte Delmenhorsts nach dem Zweiten Weltkrieg, einer Zeit des Umbruchs, der Besatzung und der beispiellosen Herausforderung durch den Zustrom von Tausenden Flüchtlingen und Vertriebenen. Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet die politischen und administrativen Weichenstellungen der britischen Militärregierung, die den Grundstein für eine demokratische Neuausrichtung legten, und enthüllt gleichzeitig die Schwierigkeiten und Erfolge bei der Integration der Neuankömmlinge in eine Stadt, die selbst von den Kriegswirren gezeichnet war. Erfahren Sie, wie Delmenhorst mit Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und sozialen Spannungen kämpfte, während sie gleichzeitig versuchte, ihre Wirtschaft wiederzubeleben und eine gemeinsame Zukunft für alteingesessene Bürger und Neuankömmlinge zu schaffen. Von den ersten Notunterkünften in Barackenlagern bis hin zum sozialen Wohnungsbau und dem Aufstieg neuer Industriezweige – dieses Buch zeichnet ein lebendiges Bild einer Gemeinschaft, die sich den Herausforderungen der Nachkriegszeit stellte und dabei ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bewies. Entdecken Sie die Schlüsselstrategien, die zur Integration beitrugen, von der Gründung von Flüchtlingsausschüssen bis hin zur Förderung von Mischehen und der aktiven Beteiligung der Neubürger am Wiederaufbau der Stadt. Eine fesselnde Chronik über die Transformation einer norddeutschen Stadt, die zeigt, wie aus Not eine Chance für Neuanfang und Zusammenhalt entstehen konnte. Dieses Buch ist nicht nur eine historische Abhandlung, sondern auch eine inspirierende Lektion über die Kraft der Menschlichkeit und die Fähigkeit, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Es ist eine essentielle Lektüre für alle, die sich für deutsche Geschichte, Migrationsforschung und die Bewältigung von gesellschaftlichen Umbrüchen interessieren. Erleben Sie die unglaubliche Geschichte Delmenhorsts, ein leuchtendes Beispiel für Resilienz und Integration in einer Zeit des Wiederaufbaus. Die politische Neuorganisation, die Flüchtlingsintegration und der wirtschaftliche Aufschwung Delmenhorsts werden hier auf faszinierende Weise dargestellt. Die gesellschaftliche Ordnung, die sozialen Spannungen und die kommunale Verwaltung werden ebenso beleuchtet wie die Besatzungszeit, die Nachkriegszeit und die Vertriebenenproblematik. Ein absolutes Muss für jeden, der sich für die Geschichte Niedersachsens und die deutsche Nachkriegsgeschichte interessiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Die politische und administrative Neuorganisation Delmenhorsts 1945/
2.2 Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in der Besatzungszeit 1945-49
2.3 Auswege aus der Flüchtlingsproblematik/ Grundlagen für die Integration
3. Schlußbemerkung
4. Anhang
5. Bibliographische Angaben
1. Einleitung
In ihrer mehr als 600 Jahre alten Geschichte hat die niedersächsische Stadt Delmenhorst 450 Jahre lang nahezu unbeachtet und unbeeinflußt eine Gesellschaft aufgebaut, die von Landwirtschaft und Viehzucht dominiert war, die das vorhandene Handwerk durch örtliche Innungen organisierte und im allgemeinen einen Selbstversorgungsstatus erreicht hatte. Die übermächtige Konkurrenz des nahen Bremens verhinderte den Handel, so daß Delmenhorst nur durch Zuliefererhandwerke wie der Korkschneiderei und der Tabakverarbeitung von der Nähe zum Bremer Hafen profitieren konnte.1
Die Bevölkerungsstruktur war geprägt durch eine lange gewachsene Homogenität:2 Die Bevölkerungszahlen wuchsen langsam, aber stetig durch Geburtenüberschüsse an3, es fanden kaum Zu-bzw. Abwanderungen statt, sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten war viel Platz vorhanden.4
Als Delmenhorst ab etwa 1870 als Industriestadt „entdeckt“ wurde, wurde diese ländliche Idylle weitesgehend zerstört: Durch die gute Verkehrslage (1867 wurde die Banhstrecke Bremen-Delmenhorst-Oldenburg eingeweiht5 ), das vorhandene Baugelände und die vorteilhafte Nähe zur Hafenstadt Bremen, war es praktisch und günstig, in Delmenhorst zu produzieren.6
Innerhalb kürzester Zeit wurden die bisherigen Heimhandwerke Korkschneiderei und Zigarrenherstellung vollständig verdrängt. Statt dessen wurden ab 1870 großindustrielle Betriebe der Branchen Jute, Linoleum, Wolle und Kork aufgebaut.7
Der durch die Fabriken rasant ansteigende Bedarf an Arbeitskräften konnte zunächst noch aus der Region gedeckt werden, als dies jedoch nicht mehr ausreichte, vermittelten kommerzielle Agenten Arbeiter aus Böhmen, Sudetendeutschland, Tschechien, Oberschlesien, sowie aus Kroatien, der Ukraine und Galizien.8
Abgesehen davon, daß die gesellschaftliche Ordnung durch die hohe Zahl an ausländischen Arbeitern überfordert war (2/3 bis die Hälfte der Arbeiter waren aus dem Ausland vermittelt worden)9, entwickelten sich Versorgungsschwierigkeiten, Wohnungsnot und daraus resultierend um sich greifende Krankheiten und zunehmende Verrohung.
Zusätzlich änderte sich auch die politische Landschaft der Stadt rapide, da die große Zahl an Arbeitern der SPD einen immensen Stimmenzuwachs sicherte: War die SPD 1902 überhaupt das erste Mal im Magistrat vertreten, besaß sie ein Jahr später bereits die Hälfte der Mandate.10 Sie konnte sich mit ihrer arbeiterfreundlichen Politik jedoch nicht durchsetzten, da sie aufgrund der Koalition aller übrigen Parteien nie eine absolute Mehrheit besaß.
Die Industriellen konnten durch ihr soziales Engagement gegenüber ihren Belegschaften zwar die „soziale Frage“ ein Stück weit entschärfen, die Umwandlung Delmenhorsts von einer unabhängigen Ackerbürgerstadt in ein einseitig konzipiertes und importabhängiges Industriezentrum erwies sich jedoch in der Rohstoffblockade des 1. Weltkrieges als verheerend.
2/3 der Arbeiter waren entweder zum Kriegsdienst eingezogen oder entlassen worden, die Produktion ging nur noch schleppend voran.11
Hatte sich die Industrie durch Technisierung und die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte Mitte der 20er Jahre wieder auf Vorkriegsniveau erholt, traf sie die Weltwirtschaftskrise hart: 1931 waren 2/3 der Erwerbstätigen ohne Beschäftigung, die Stadt ruiniert durch Sozialzahlungen und fehlende Steuern, der Handel der geringen Kaufkraft wegen stillgelegt.12
Trotz des Wiederaufbaus des bedeutenden Industriebetriebes „Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei AG“ (NWK) und der Fusion der vorhandenen „Jute“- Fabrik mit der „Bremer Jute- Spinnerei und Weberei AG“ 1932 konnte ein bedeutender wirtschaftlicher Aufschwung erst mit der Errichtung militärischer Anlagen und der Rüstungsindustrie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten festgestellt werden:
Delmenhorst wurde ein führender Wehrmachtsstandort und war daher mit so vielen Beschäftigungsmöglichkeiten ausgestattet, daß die Arbeitslosigkeit 1938 gegen Null tendierte.13 Von 1933-39 traf ein Zustrom von Arbeitern und auch Soldaten (bei Ranghöheren zusätzlich deren Familien) die Stadt weitestgehend unerwartet14 - ein nahtloser und fließender Eingliederungsprozeß wurde durch die neuen Zuwanderungen und das Ersetzen ausländischer Arbeiter durch deutsche verhindert.Eine langfristige Assimilation konnte nicht stattfinden, soziale Spannungen entstanden.
Probleme ergaben sich auch dadurch, daß die Stadt der Rüstungsindustrien wegen nun ein Ziel der alliierten Bombenangriffe war. 1942/43 wurden 70% der Industriestandorte Delmenhorsts zerstörtdurch die Lage der Industriegebiete und durch die stadtuntypisch flache Bauweise jedoch wurden Wohngebiete weitestgehend verschont- es wurde nur die vergleichsweise kleine Zahl von 95 Wohnhäusern und 11 öffentlichen Gebäuden beschädigt15 und die Stadt war als Ziel für flächendeckende und so weit verheerendere Bombardements nach 1944, denen beispielsweise auch Bremen zum Opfer fiel, nicht mehr lohnenswert.16
Die relativ unzerstörten Wohngebiete waren bereits in den letzten Kriegsjahren Ziel vieler Flüchtlinge und Evakuierter aus den umliegenden Gebieten, speziell aus Bremen, das stärker zerstört wurde als Delmenhorst.17 Die Flüchtlinge fanden eine Stadt vor, die sich innerhalb kürzester Zeit von einem landwirtschaftlichen Gebiet in ein „Industriezentrum im Grünen“18 gewandelt hatte, das durch eine einseitige Industrie äußerst anfällig für Wirtschaftskrisen und dementsprechend labil war und die raschen Veränderungen sowie die damit verbundenen sozialen Spannungen noch nicht verarbeitet hatte.
Wie diese Stadt mit der militärischen Besetzung durch die Briten, mit der Aufnahme von insgesamt über 17 000 Flüchtlingen und Vertriebenen umging, soll Thema dieser Hausarbeit sein. Dabei spielt die Geschichte der Stadt eine große Rolle, da sie einige der Faktoren festlegte, die die Integration begünstigten und/oder bremsten und somit die Voraussetzungen schuf für die Eingliederung und den Wiederaufbau der Stadt.
2. Hauptteil
2.1. Die politische und administrative Neuorganisation Delmenhorsts 1945/46
Die im Februar 1945 von den „Big Three“ (USA, Großbritannien, UdSSR) beschlossene Aufteilung Deutschlands und Österreichs in Besatzungszonen der dann jedoch vier Siegermächte (Frankreich wurde in Jalta als Siegermacht zusätzlich anerkannt) teilte die Stadt Delmenhorst der britischen Militärregierung zu.19
Diese Regierung folgte im großen und ganzen der von den Amerikanern entwickelten und auf der Potsdamer Konferenz als allgemeinen Konsens beschlossenen Besatzungspolitik des „Demilitarisierens, Denazifizierens, Dezentralisierens, Demokratisierens und Dekartellisierens“.20
Nach der kampflosen Eroberung der Stadt Delmenhorst am 20. April 194521 beherrschte jedoch zuerst eine „Politik des Abwartens“ die alliierte Kommunalverwaltung, da eine vollständig funktionierende britische Administration wegen Mitarbeitermangels der Alliierten nicht möglich war. Die „Military Government Detachments“, die nach Länder-, Bezirks- und Kreisebenen unterteilt wurden und in Delmenhorst als ein „basic detachment“ mit einem Town Mayor an der Spitze und zwei unabhängigen Verwaltungs- und Polizeioffizieren vorhanden waren,22 hatten nur vage Handlungsanweisungen.
Trotz diverser Zwangsräumungen von Häusern zur Schaffung von Wohnraum für die britische Besatzungsmacht war nicht genug Platz vorhanden, um die eigentlich notwendige Zahl von Mitarbeitern unterzubringen.23
Aus diesem Dilemma heraus entwickelte sich das Verwaltungskonzept der Briten, selbst nur als kontrollierendes Organ aufzutreten, den Deutschen jedoch die Ausführung zu überlassen:
Der bereits am 12. Mai 1945 eingesetzte ehemalige Polizeioffizier und damalige Leiter des städtischen Ernährungsamtes Bürgermeister Gustav Brickwede hatte jedoch als „Sprachrohr der Briten“ noch keinerlei Vollmächte.24 Der von Brickwede als sein Stellvertreter vorgeschlagene Adolf Burgert (SPD) wurde von der Militärregierung als „Erster Beigeordneter“ akzeptiert. Abgelöst wurde Brickwede am 12. Juni 1945 von Walter Kleine, dem ehemaligen Stadtkämmerer aus Wilhelmshaven,der das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt bekleiden sollte Dieser wurde vom inzwischen eingesetzten oldenburgischen Ministerpräsidenten Theodor Tantzen- Heering ernannt, der formal das Recht besaß, einen neuen Oberbürgermeister zu ernennen, da Brickwede nicht offiziell dazu ernannt wurde. Gelöst werden konnte dieses Problem, indem Kleine das Amt des Oberbürgermeisters, Brickwede das des Bürgermeisters und Burgert das des Stadtrates übernahm. Da Kleine bereits am 17. 10. 1945 wieder pensioniert wurde, führten dann jedoch Brickwede und Burgert die Amtsgeschäfte wie vor dessen Ernennung weiter.
Am 15. Mai 1945 wurde der sogenannte „Vertrauensausschuß“ gebildet, dem jeweils ein Vertreter aus Industrie, Handel, Handwerk, der Beamten, der katholischen und der evangelischen Kirche sowie je zwei Vertreter aus Landwirtschaft und der Arbeiterschaft angehörten. Dieser Ausschuß sollte die Interessen der Wirtschaft, der Administration und der sozialen Seite Delmenhorsts gegenüber den Alliierten vertreten und somit die fehlende Volksvertretung ersetzten.25
Das Zulassen einer solchen Institution zeigt bereits die frühe Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses zwischen der britischen Besatzungsmacht und den Bürgern der Stadt und legte den Grundstein für das Einsetzen einer Stadtverwaltung im November 1945:
Die Militärregierung befahl den Stadt- und Kreiskommandanten, bis zum 20.Oktober 1945 die Kandidaten für die neuen Räte auszuwählen. Am 26.September forderte Lt. Col. Laverty die Mitglieder des Vertrauensausschusses auf, ihm Vorschläge zu unterbreiten, woraufhin er eine Liste mit 50 potentiellen Kandidaten erhielt. Diese wurden durch britische Sicherheitsorgane überprüft und so entstand ein 30 Personen umfassender Rat, der den Vertrauensausschuß ablöste.26 Zwar war dieser Rat noch nicht gewählt, doch waren die Ratsherren nach ihrer Partei- oder Religionszugehörigkeit bzw. nach ihrem Berufsstand ausgesucht worden, so daß eine weitgestreute Interessenvertretung gewahrt blieb.27
Diese 30 Mitglieder wählten nach demokratischen Regeln ihren Ratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter, wobei der Vorsitzende für mindestens eine Wahlperiode das Amt des Oberbürgermeisters bekleidete.
Die Briten folgten hierbei dem Prinzip der Demokratisierung (sie führten eine strikte Trennung von Legislative und Exekutive ein, was einschneidende Kompetenzbeschränkungen des Bürgermeisters, jedoch eine Machterweiterung des Rates zur Folge hatte)- Probleme ergaben sich jedoch bei der Umsetzung dieses Prinzips:
Während der Rat den SPD- Kandidaten Schmidt zum Oberbürgermeister und den Vertreter der evangelischen Kirche Dr. Onken zum Bürgermeister wählte, setzte der oldenburgische Ministerpräsident den Rechtsanwalt Lüpkes als Oberbürgermeister von Delmenhorst ein- einen Streit über diese Rechtsunsicherheit konnte der inzwischen als Nachfolger von Lt. Col. Laverty eingesetzte britische Stadtkommandant Lt. Col. Cameron nur noch dadurch vermeiden, indem er Lüpkes als Oberstadtdirektor anerkannte und dadurch die Amtsaufteilung für Schmidt und Onken bis zur Wahl 1946 nicht veränderte.
Eine weitere Schwierigkeit stellte die Entnazifizierung dar. Es war unmöglich, alle Beschäftigten der Verwaltung zu entlassen,28 da diese für die Organisation der Stadt unentbehrlich waren. Zudem wollten die Alliierten eher auf „more traditional elements“29 vertrauen und einen Zuwachs der Radikalisierung in die linke Richtung verhindern.
Delmenhorst als Industriestadt war mit seiner großen Zahl von Arbeitern bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten geprägt von einer zahlreichen KPD-und SPD- Wählerschaft30 und hatte selbst 1933 unterdurchschnittlich viele NSDAP- Wähler31, so daß die Briten einen Aufschwung der KPD befürchteten.
Da dies jedoch die Demokratisierung behindern würde, versuchten sie, dem durch Verbote kommunistischer Vereinigungen wie 1945 der „Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus, Delmenhorst“ vorzubeugen.32
Die nach der Zulassung der Alliierten am 06. August 1945 gebildeten Parteien setzten sich größtenteils aus Mitgliedern derselben in den 20er Jahren zusammen, die sich teilweise nur schleppend reorganisierten. Einzig die KPD hatte bereits vor Ende des Krieges Vorbereitungen zum Aufbau einer neuen kommunistischen Gesellschaftsform getroffen und war dementsprechend auf die neue Situation vorbereitet.33
Erleichtert betrachteten die Briten daher die Gründung einer völlig neuen Partei im Spätherbst 1945, der „Demokratischen Union Deutschlands“ (DUD), die ein entsprechend gemäßigtes Gegengewicht zur linksextremen KPD darstellte und sich vor allem durch die katholisch-christliche Orientierung der Sympathien des damaligen Stadtkommandanten Lt. Col. Laverty sicher sein konnte.34 Zusätzlich zur Ordnung der Verwaltung wurde auch die gesellschaftliche Ordnung wieder in deutsche Hand gegeben. In der zweiten Hälfte des Jahres 1945 begann sich das gesellschaftliche Leben der Stadt zu normalisieren- eine Zeitung der Besatzungsmacht informierte die Bürger über amtliche Geschehnisse,35 die Schulen wurden am 20. August wieder geöffnet, die Busverbindung Oldenburg - Delmenhorst- Bremen wurde wieder eingerichtet, das Postwesen, der Telefondienst und die Arbeit der Polizei wurden aufgenommen, Sportvereine und andere Verbände wurden der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.36
Zur Kommunalwahl am 13. Oktober 1946 stellte sich diese Partei jedoch unter dem Namen CDU- aus diesen Wahlen ging die SPD als stärkste Partei hervor37 und stellte den Oberbürgermeister von der Heyde. Bürgermeister wurde das CDU- Mitglied Siegfried, Oberstadtdirektor Lüpkes und Stadtdirektor Burgert38. Diese freien Wahlen begründeten die Umwandlung der Militärregierung in eine zivile, bei der der Stadtrat die absolute Regierungsgewalt erhielt, trotzdem sich die Briten eine Kontrolle durch die Präsenz eines „Kreis- Resident-Officers“ vorbehielten.
Dieser durch das Einsetzen einer zivilen Verwaltung und Regierung ausgedrückte „konstruktive Pragmatismus“39 war notwendig, da die Alliierten beschlossen hatten, daß das Flüchtlings- und Vertriebenenproblem ohne Ausnahme eine „rein deutsche Angelegenheit“ sei und sich die Militärregierung möglichst nicht an der Lösung dieses Problems beteiligte.40
2.2 Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in der Besatzungszeit 1945-52
Schon bevor die von den Alliierten organisierten Flüchtlings- und Vertriebenentransporte in die britische Besatzungszone stattfanden, hatte Delmenhorst 4000 Flüchtlinge aus der näheren Umgebung41, insbesondere aus dem stark zerbombten Bremen, aufgenommen. Zusätzlich befanden sich ca. 30 000 ausländische Zivilarbeiter aus dem gesamten Weser- Ems- Gebiet auf dem ehemaligen Flughafengelände in Adelheide , 5000 Displaced Persons , darunter viele Frauen und Kinder, leben in der Kaserne in der Wildeshauser Straße.42
Der Heimtransport dieser Menschen ging nur sehr schleppend voran, sie lebten in unmenschlichen Wohnverhältnissen und stellten durch Plünderungen der umliegenden Ortschaften ein zunehmendes Sicherheitsrisiko dar, so daß die Stadtväter die Rückkehr der DPs in Adelheide in ihre Heimat und die Räumung des Flughafens im August 1945 mit Erleichterung sahen.43
Die ehemaligen Fremdarbeiter der Kaserne in der Wildeshauser Straße hingegen mußten noch bis März 1946 in Delmenhorst bleiben.44
Bis zum Oktober 1945 hatte sich die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge auf schätzungsweise 8000 Menschen erhöht45, die größtenteils aus den Provinzen Ostpreußen und Pommern stammten. Anders als die Menschen der späteren Massentransporte konnten die täglich in kleinen Gruppen eintreffenden Personen meist recht individuell betreut werden.46
Durch Hinweise auf den bereits zu diesem Zeitpunkt knappen Wohnraum und die schlechte Ernährungslage hofften die Mitglieder des Vermittlungsausschusses, die Zahl der ihnen zugeteilten Flüchtlinge zu reduzieren.47
Innerhalb von fünf Jahren (zwischen 1945 und 1949) wurden 8 Millionen Ostflüchtlinge und Vertriebene fast ausschließlich in die britische und amerikanische Besatzungszone umgesiedelt. Das Abkommen zwischen den britischen und den polnischen Vertretern beim „Combined Repatriation Executive“ vom 14. Februar 1946 regelte für die britische Zone zwei Eisenbahntransporte mit je 1500 Personen pro Tag, die auf die Gemeinden in der Zone aufgeteilt werden sollten. Diesem Plan mit einem detaillierten Verteilungsschlüssel zufolge, sollten infolge der „Operation Schwalbe“ 12 000 Flüchtlinge und Vertriebene nach Delmenhorst geschickt werden.48 Die Organisation der Unterbringung und Verpflegung der Flüchtlinge oblag hierbei den Kommunalverwaltungen, die keinerlei Rechte besaßen, sich gegen die auferlegten Transporte zu wehren.
Für die Stadt Delmenhorst wurde ein Organisationsplan entwickelt, der die Erstversorgung ein wenig erleichtern und die Überforderung der Beteiligten möglichst in Grenzen halten sollte.49
Probleme ergaben sich dadurch, daß bereits am Ende des Krieges jeder vorhandene Wohnraum überbelegt war - zwar wurden die Holzbaracken der Fremdarbeiter nach deren Freiwerden für Wohnzwecke eingerichtet, Gasthaussäle, Turn- und Fabrikhallen entsprechend vorbereitet - der Platz in diesen war jedoch schon vor den Transporten der „Operation Schwalbe“ vollkommen ausgeschöpft.50
Viele der 1945 aufgenommenen Flüchtlinge konnten noch durch private Beziehungen bei Freunden oder Verwandten unterkommen, als sich jedoch am Ende des Jahres die Situation durch den steigenden Platzbedarf der Besatzungstruppen und die zunehmende Zahl an Heimkehrern verschärfte, mußte das städtische Wohnungsamt ab dem 1. Dezember 1945 systematisch die Stadt nach Wohnraum durchsuchen und die ersten Zwangsbelegungen vornehmen.51
Um die Vermittlung von Wohnraum zu erleichtern und die chaotischen Zustände etwas abzumildern, wurde im September 1945 eine „Flüchtlingsberatungsstelle“ eingerichtet. In dieser sollten die Daten der Flüchtlinge erfaßt, diese dann wirtschaftlich und sozial betreut werden. Sie bildete außerdem eine Auskunftsstelle, bot einen Suchdienst an und fungierte als Schlichter in kritischen Fällen. An sie konnten sich die Flüchtlinge auch bei akuter Not wenden, da die Beratungsstelle einige aus Spenden erhaltene Güter abgeben konnte.52
Zusätzlich entstanden ein „Fürsorgeausschuß“, der aus Ratsmitgliedern bestand und ein „Flüchtlingsausschuß“, eine Institution, an der die Flüchtlinge direkt beteiligt waren. Am 31. Januar 1946 wurden diese beiden Vereinigungen jedoch auf Befehl der Briten zum „Wohlfahrts-, Fürsorge-und Flüchtlingsausschuß“ zusammengeschlossen- die Alliierten befürchteten, daß sich die Minderheit der Flüchtlinge zu stark verselbständigte und somit eine zu große Lobby bildete.
Als dann im Februar der „Swallow Distribution Plan Nr 1, Period 27. February to 27. May 1946“ in Kraft trat,trafen am 19. März 1946 461 Familien (ca. 1500 Personen) aus der Grafschaft Glatz ein. Sie wurden gemäß des Organisationsplans in 19 Auffanglagern untergebracht, bevor sie in private Wohnungen vermittelt werden konnten.
Mit der steigenden Einwohnerzahl verschlechterte sich die Ernährungslage der Stadt: Aufgrund der schlechten Getreideernte 1945 und der noch nicht wieder intakten Wirtschaft mußten die Nahrungsmittelrationen drastisch gekürzt werden.
Damit war die Toleranzgrenze der Delmenhorster überschritten- neben formalen Einspruchschreiben folgten nun auch tätliche Übergriffe auf Flüchtlinge.
Schwerwiegendstes Problem war die immer größer werdende Wohnungsnot- die als Übergangslager gedachten Sammelstellen konnten nicht mehr vollständig geräumt werden, Zwangsbelegungen wurden durch neue Verordnungen noch rigoroser durchgeführt.53
Als am 24. Mai 1946 ein weiterer Transport mit 1484 Einwohnern (hauptsächlich Frauen und Kindern) aus dem schlesischen Liebau folgte, war der behördliche Aufwand nicht mehr zu bewältigen. Die Flüchtlingsberatungsstelle wurde am 1. Juni 1946 aufgelöst, ihre Arbeit übernahm künftig das sogenannte „Flüchtlingsamt“.
Doch auch dieses stand der Flut von Unterlagen, die im August 1946 auf das Amt zukamen, machtlos gegenüber:
Am 13. August erreichte ein Transport mit 1753 Menschen aus Schlesien (den Gemeinden Strehlen und Wansen) Delmenhorst, ihm folgten am 19. August 1686 Personen aus dem Kreis Hindenburg, am 24. 1798 Flüchtlinge aus der Gemeinde Waldenburg.54
Nach langen Verhandlungen und der Einsicht, daß keine andere Lösung machbar sei, war die britische Militärregierung endlich bereit, die Gebäude des stillgelegten Flughafens Adelheide teilweise zur Unterbringung der Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.
Dann jedoch, bereits einen Monat später, mußte das Gelände binnen einer 14-tägigen Frist geräumt werden, da der Flughafen als Internierungslager für politisch Belastete dienen sollte. Das „1C.I.C.“ erfüllte diesen Zweck bis zum 31. August 1948 und konnte erst danach die immer noch herrschende Wohnungsnot ein wenig beheben, indem das „Christliche Jugenddorf Adelheide“ dort untergebracht wurde. In ihm lebten Jugendliche, die elternlos geflüchtet waren oder vertrieben wurden.55
Nachdem die Stadt die Räumlichkeiten des Flughafengeländes 1946 nicht weiter nutzen konnte und ihr auch nur die Frist von 14 Tagen blieb, sämtliche Flüchtlinge und deren Inventar in Sammelunterkünften oder privaten Wohnungen unterzubringen, wurden 32 neue Massenlager geschaffen.
Weitere Transporte in den Jahren 1946, 1947 und 194856 sowie die Dunkelziffer der Flüchtlinge, die ihren Familien nachreisten oder ähnliches, ließen den Lebensstandard derart sinken, daß das Flüchtlingsamt ab 1946 Armenspeisungen anbieten ließ, damit die Menschen nicht an Unterernährung starben.
Die britische Militärregierung befahl einen „Staatskommissar für Flüchtlingsfragen“ nach Delmenhorst, wobei selbst dessen hartes Durchgreifen keine sonderliche Verbesserung der Situation mit sich brachte. Die Präsenz der Briten schuf auch (abgesehen von deren immensen Platzbedarf) erhebliche finanzielle Belastungen für die Stadt- zwar waren die englischen Einrichtungen Arbeitsplatz für viele Flüchtlinge und auch Einheimische,57 doch entstanden durch sie auch hohe Unterhaltungskosten.58
Dieses Geld fehlte bei der Beschaffung wichtiger Bedarfsgüter, zumal das Flüchtlingsamt die Kontingente des Wirtschaftsamtes in keinster Weise belasten durfte.59
Den Stadtbeamten blieb also nichts weiter übrig, als den Mißstand zu verwalten- eine Wende wurde jedoch erst nach erheblichen Verbesserungen der Wirtschafts- und Wohnraumlage sowie durch Finanzmittel von Bund und Ländern herbeigeführt .60
2.3. Auswege aus der Flüchtlingsproblematik / Grundlagen für die Integration
a) Der Soziale Wohnungsbau
Die Nachkriegsjahre waren geprägt durch zwei gegenläufige Entwicklungen: Während eine riesige Flut von Neubürgern in die Stadt strömte, stagnierte der Bausektor und der Wohnungsbestand Delmenhorsts blieb unverändert. Die flache Bauweise der Stadt (ein- bzw. zweigeschossige Einzelhäuser beherrschten das Stadtbild) erwies sich für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums als äußerst ungünstig.
1950/51 erklärte der Rat den Wohnungsbau zur wichtigsten Aufgabe des städtischen Wiederaufbaus nach dem Krieg. Mit dieser Aussage bekräftigten die Ratsherren ihren Entschluß, die Wohn- und Barackenlager (laut Rat die „Stätten konzentrierter Armut“) endgültig aufzulösen.61 Zwar wurden die Sammellager relativ schnell aufgelöst, die Baracken hingegen boten schon einen gewissen Komfort, den die Bewohner nicht aufgeben wollten: Immerhin besaßen sie in den Baracken einen eigenen Wohnbereich und mußten diesen nicht wie in vielen Privatwohnungen mit Fremden teilen. So erreichte die Zahl der Barackenbewohner 1950 mit 3000 Personen einen Höchststand. Nur sehr zögernd konnte diese Belegungsrate verringert werden, zumal immer noch Menschen als Flüchtlinge in die Stadt kamen.62
Die Barackenlager wurden außerdem meist von den sozial Schwachen bewohnt, die keine Möglichkeit hatten zu arbeiten und sich so auch die normalen Mieten nicht leisten konnten.
Nach der Währungsreform 1948 jedoch setzte eine rege Bautätigkeit ein, die durch das am 24. April 1950 in Kraft tretende Programm des Sozialen Wohnungsbaus weiter unterstützt werden konnte, doch beschränkte sich diese Tendenz auf kleinere Projekte.63
Auffällig ist jedoch, daß nur ein Bruchteil der entstandenen Wohnungen ohne ein städtisches Darlehen finanziert werden konnten.64
Zusätzlich zu der Förderung durch die Stadt konnte jeder Delmenhorster Mitglied in der bereits 148 gegründeten „Wohnungsbaugemeinschaft Delmenhorst e.V.“65 werden- diese hatte sich zum Ziel gesetzt „durch freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder im Wege der Gegenseitigkeitshilfe die Initiative im Wohnungsbau zu ergreifen“.66
1951: 1000 Menschen in allen Einrichtungen der Briten beschäftigt. Müsegades, Kurt:
Seit 1949 griff auch die „Gemeinnützige Siedlungsgemeinschaft Delmenhorst“67 (GSG) aktiv ins Geschehen ein: Von 1949 bis Ende 1951 veranlaßte diese Gemeinschaft den Bau von mehr als 400 Wohnungen.
Doch auch diese Maßnahmen führten nicht zu einer Verbesserung der Situation, sie bannten allenfalls eine weitere Eskalation der Wohnungsnot: 1953 lebten immer noch über 1500 Familien in Einzelräumen, das letzte Massenlager konnte erst am 15. September 1954 endgültig geräumt werden, die Barackensiedlungen wurden erst im Jahre 1962 aufgelöst.68
Bemerkenswert ist die Beteiligung der Neubürger am Wohnungsbau: Zwar kann nicht exakt nachvollzogen werden, welchen konkreten Anteil die Flüchtlinge und Vertriebenen hatten, doch wurden ca. zwei Drittel sämtlicher Neubauwohnungen durch sie finanziert. Diese Zahl ergibt sich aus der Menge an Wohnungen, die Fördermittel speziell für Neubürger erhielten und somit garantiert von diesen bezogen wurden.69
Zusätzlich beteiligten sich auch die Vertriebenenverbände an der Förderung des Wohnungsbaus für Flüchtlinge: Die Ortsverbände des ZvD und des BvD unterstützten hauptsächlich den Bau von Siedlungshäusern, zu denen häufig auch ein kleiner Garten gehörte, um die Gleichstellung der Neubürger zu fördern.70 Die Sudetendeutsche Landsmannschaft baute sogar für ihre Mitglieder eine kleine Wohnsiedlung.71
Auch die katholische Arbeitnehmerbewegung betätigte sich erfolgreich auf dem Bausektor- seit 1955 errichteten ihre Mitglieder in Gemeinschaftsarbeit Familienhäuser. Diese kamen aufgrund des hohen Flüchtlingsanteils in dieser Organisation hauptsächlich den Neubürgern zugute. Die Einführung des Lastenausgleichs am 1. September 1952 verstärkte die Bautätigkeit der Neubürger weiter-72 diese Entwicklung zeigt nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit der Flüchtlinge und Vertriebenen, sondern beweist auch die Integration in die Delmenhorster Gesellschaft und den Willen zur dauerhaften Bleibe in der Stadt.
b) Der wirtschaftliche Aufschwung
Neben der Wohnungsnot stellte sich in den Jahren 1948/49 das Problem der Arbeitslosigkeit73, die besonders die Neubürger betraf. Konnten die alteingesessenen Delmenhorster nach dem Krieg oft in ihre alten Stellen zurückkehren, mußten die Vertriebenen von Null anfangen und besaßen nicht wie die Einheimischen den Rückhalt einer Familie in wirtschaftlicher Not.
Dieser Zustand verhinderte eine soziale und ökonomische Integration der Zugezogenen und belastete gleichzeitig den Haushalt der Stadt durch die Sozialzahlungen so stark, daß auch an den so wichtigen Wiederaufbau nicht gedacht werden konnte.
Zwar beschäftigte die britische Besatzungsmacht viele Delmenhorster in Einrichtungen wie dem „Central Stores Depot“ (1947), in Kasernen und der Verwaltung,74 doch wurden die englischen Truppen in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Zug um Zug verringert. 1958 waren fast alle Deutschen Arbeitskräfte entlassen, auch wenn die letzten Truppen die Stadt erst 1963 verließen.75 Als weitere Lösung der Beschäftigungsmisere bot sich der rasche Aufbau der Delmenhorster Industrien Wolle, Jute und Linoleum an. Diese Branchen bildeten immerhin zwei Drittel der städtischen Wirtschaft und konnten durch ihre Arbeitsplatzintensität das Beschäftigungsproblem, durch ihre Gewerbesteuern die Schwierigkeiten des Etats lösen.
Die NWK und die Jute konnten bereits 1945 ihre Produktion wieder aufnehmen, boten anfangs zahlreiche Arbeitsplätze und konnten ihre Produktion bis Mitte der 50er Jahre kontinuierlich steigern. Es ergaben sich jedoch Probleme, da diese Industrien den Schwankungen des Wollmarktes ausgesetzt waren und mehrmals nur durch riskante Preiskalkulationen einen Bankrott verhindern konnten. An dieser Stelle wurde deutlich, wie wichtig die unternehmerischen Initiativen der Neubürger für die Stadt Delmenhorst wurden: Da die rohstoffverarbeitende Industrie nicht den gewünschten Erfolg brachte, bauten ostdeutsche Unternehmer eine florierende Bekleidungsindustrie auf, die den Bedarf der Nachkriegsgesellschaft zu decken versuchte. In diesen Betrieben arbeiteten viele der Neubürger- ihr Anteil an Berufen in Industrie und Handwerk stieg bis 1948 um mehr als 70 Prozent. Zu beachten ist hierbei jedoch, daß viele der Heimatvertriebenen keinen Arbeitsplatz bekamen, der ihrem vor dem Krieg ausgeübten Job ähnlich war- sie mußten meistens mit unqualifizierten und unterbezahlten Stellungen Vorlieb nehmen.
Für die Frauen boten sich in dieser Zeit noch am ehesten Arbeitsplätze- sie kamen häufig in der Textilbranche unter, was einen enormen Rückgang der Frauenarbeitslosigkeit mit sich brachte. Für höher qualifizierte Arbeitskräfte der Verwaltung oder auch der Metallindustrie waren in Delmenhorst jedoch kaum Arbeitsplätze vorhanden-diese Tatsache führte dazu, daß Delmenhorst zwar als „Wohnstadt“ genutzt wurde, die qualifizierten Neubürger jedoch oft in die umliegenden Städte (speziell Bremen) pendelten, da sie dort ein besseres Angebot an Arbeitsplätzen vorfanden.76
Die Verlagerung von einer einseitig ausgerichteten Industrie in den Zweigen Wolle, Jute, Linoleum auf ein breiter gefächertes Angebot von Industrien konnte endlich dazu führen, daß 1960 die Vollbeschäftigung erreicht wurde, daß aufgrund eines Arbeitskräftemangels sogar Gastarbeiter herangezogen wurden.
3. Schlußbemerkung
Eine Integration ist dann abgeschlossen, wenn zwischen den ursprünglichen Bewohnern und den Neubürgern keine sozialen Unterschiede mehr feststellbar sind.
Diese recht grobe Definition enthält das Ausmaß dauerhafter Beziehungen zwischen Einheimischen und Neubürgern, deren Teilnahme an bestehenden sozialen Organisationen, den Grad der erfolgreichen Rollenerfüllung in der neuen Gesellschaft und den Grad des abweichenden Verhaltens.
Aufgrund dieser Differenzierung läßt sich feststellen, daß in Delmenhorst nach dem Zweiten Weltkrieg eine solche Integration stattgefunden hat:
Bereits im Jahr 1950 waren 16,3 Prozent der Eheschließungen Mischehen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, diese Zahl steigerte sich bis auf 37,3 Prozent im Jahre 1960.77 In den Jahren 1948 bis 1952 waren 22 Flüchtlinge und Vertriebene in den städtischen Ausschüssen aktiv- dabei gehörten sie aufgrund des Koalitionsverbotes keiner speziellen Vertriebenenpartei an, sondern kandidierten für die bereits vorhandenen Fraktionen.78
Mit Aufhebung des Koalitionsverbotes konnte der BHE 1952 das erste Mal zur Wahl antreten und auch gleich seinen größten Erfolg verzeichnen. Doch mit zunehmender Integration verlor der BHE für die Flüchtlinge an Bedeutung und konnte diesen Erfolg nie wiederholen- da sich die Programmatik der Partei nur unwesentlich änderte, ihre Wählerschaft jedoch einem integrativem Prozeß ausgesetzt war, erfüllte sie bald nicht mehr die gestellten Ansprüche. Die Wähler vollzogen einen konsequenten Wechsel zu den etablierten Parteien.79
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung kam die finanzielle Unabhängigkeit der Flüchtlinge- Vollbeschäftigung sicherte jedem die Lebensgrundlage, die eigene Wohnung oder das eigene Haus steigerte zusätzlich das Selbstbewußtsein und ermutigte, in Delmenhorst auf Dauer zu bleiben. Mit der Entscheidung, die neue Heimat Nordwestdeutschland zu akzeptieren, ist auch eine Verantwortung gegenüber der Stadt verknüpft- die Flüchtlinge haben nun das gleiche Ziel wie die einheimische Bevölkerung: Delmenhorst als lebenswerte Stadt für die nächsten Generationen zu erhalten bzw. auszubauen, sie durch vielfältige Wirtschaftszweige für die Zukunft zu rüsten und die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.
Die aktive Beteiligung am Neuaufbau der Stadt und die Eingliederung der Neubürger in die Delmenhorster Gesellschaft verdeutlicht, daß ein Großteil der Flüchtlinge und Vertriebenen diese Stadt als ihre neue Heimat anerkannten.
4. Anhang
Dokument 1
Ablauf der Vorgänge bei Ankunft eines Flüchtlingszuges
(Quelle: Stadtarchiv Delmenhorst 50 62 20.In: Baha, 212)
„Nach Ankunft des Zuges werden die Insassen von einem Wagen oder etwa 50 Personen zum Aussteigen aufgefordert und von der Polizei zur Wirtschaft Pleil geführt, wo sie von dort vorhandenen Ärzten untersucht werden. Es stehen dort zwei Räume für eine getrennte Untersuchung von Männern und Frauen zur Verfügung. Nach erfolgter Untersuchung gehen die Leute zum Ostgleis zurück.
Nach Ankunft des Zuges werden die Gepäckstücke von den Gepäckhelfern aus dem Gepäckwagen ausgeladen und mit der Aufschrift nach oben in Reihen mit entsprechenden Zwischenräumen aufgestellt. Die von der Untersuchung zurückkommenden Flüchtlinge suchen ihre Gepäckstücke heraus und holen das in den Personenwagen mitgeführte Handgepäck selber dazu. Dann ruft der Organisationsleiter durch Lautsprecher die Sammelunterkünfte aus in der Reihenfolge, wie sie belegt werden sollen. Der Büroleiter händigt den Flüchtlingen die Quartierkarten aus, die für jede Sammelunterkunft eine andere Farbe aufweisen. Der LKW bzw. Omnibus ist durch ein Plakat gekennzeichnet, das in gleicher Farbe wie die Quartierkarte die Aufschrift der Sammelunterkunft trägt.
Mit den Flüchtlingen fährt der Büroleiter, die beiden Helferinnen vom DRK, ein Sanitäter vom DRK und ein Polizeibeamter in die Sammelunterkunft. Den für die Sammelunterkünfte eingeteilten Helferinnen, Sanitätern und Polizeibeamten müssen vorher die Sammelunterkünfte, für die sie eingeteilt sind, bekannt sein.
Bei Eingang der Meldung über die Ankunft eines Flüchtlingszuges sind bereits von den Industriewerken gestellte Arbeitskräfte mit einem Omnibus zu den Sammelunterkünften gefahren, die dort die Unterkünfte belegungsfertig hergerichtet haben. Für jede Unterkunft ist ein Lagerführer eingesetzt, der für die rechtzeitige Fertigstellung der Lager verantwortlich ist. In den Sammelunterkünften erfaßt der Büroleiter die Personalien der Flüchtlinge auf vorgedruckte Formulare, und zwar vierfach mit Durchschreibeverfahren. Je ein Exemplar erhält das Meldeamt, das Wohnungsamt, die Militärregierung und der Bezirksvorsteher. Bald nach Ankunft der Flüchtlinge in den Sammelunterkünften wird die Kaltverpflegung eintreffen.
Die DRK- Helferinnen nehmen sich besonders der alten Leute und der Mütter mit Kindern an, geben das Essen aus und stellen die Nachtwache. Die Büroleiter sind als Beauftragte der Stadtverwaltung für den geordneten Ablauf aller Vorgänge verantwortlich. Um die Büroleiter, die sämtlich dem Personal der Stadtverwaltung entnommen sind, nicht zu lange von ihrer dienstlichen Tätigkeit abzuhalten, übernimmt nach Ausscheiden des Büroleiters entweder der Lagerführer, wenn er gleichzeitig Saalbesitzer ist und im Hause wohnt, oder ein geeigneter bezahlter Lagerführer, den evtl. auch der Sanitäter darstellen kann, die Verantwortung, und zwar bis zur endgültigen Räumung der Sammelunterkunft.
Am Tage nach der Ankunft beginnt die Desinfektion der Flüchtlinge mit ihren sämtlichen Gepäck nach besonderem Plan, der nach Rücksprache mit dem Desinfektor der „Senk & Krüger“ aufgestellt wurde. Die Insassen der Sammelunterkünfte werden mittels LKW geschlossen zur Desinfektionsanstalt befördert; die Verantwortung dafür, daß sich jeder Flüchtling der Sammelunterkunft mit Gepäck der Desinfektion unterzieht, trägt der Büroleiter, der entweder selbst mitfährt oder, je nach Größe der Unterkunft, eine DRK- Schwester mit der Begleitung beauftragen kann. Erst nach erfolgter Desinfektion darf die Einweisung in Familien von den Bezirksvorstehern vorgenommen werden.
Die Bezirksvorsteher erhalten Bescheid, zu welchem Zeitpunkt die Einweisung beginnen kann. Die Bezirksvorsteher setzen sich bereits am Ankunftstag in den Sammelunterkünften mit den Büroleitern in Verbindung und stellen die Einweisungsliste auf, die die Namen der Flüchtlinge und der Quartiergeber enthält. Es soll in einigen Bezirken versucht werden, die Quartiergeber schriftlich zur Abholung der ihnen zugewiesenen Flüchtlinge aufzufordern. Wo das nicht durchführbar erscheint, müssen die Bezirksvorsteher soviel Vertrauensleute zur Verfügung halten, die ausreichen, um die Flüchtlinge zu den Quartiergebern zu begleiten und etwa dort sich ergebene Schwierigkeiten an Ort und Stelle abstellen.
Die Flüchtlinge bleiben in den Sammelunterkünften drei Tage in der Gemeinschaftsverpflegung bis zur Einweisung und polizeilichen Anmeldung. Erst nach der polizeilichen Anmeldung händigt das Ernährungsamt den Flüchtlingen (wie jedem anderen Zugezogenen) die Lebensmittelkarten aus.“
Dokument 2
Meldung des Amtlichen Anzeigers Delmenhorst vom 16. März 1946
(Quelle: 50 Jahre Nachkriegszeit. Sonderbeilage zum DK vom 6.5.1995)
„ Jeder verfügbare Wohnraum muß zur Aufnahme der eintreffenden Flüchtlinge bereitgestellt werden. Die Bezirksvorsteher bzw. ihre Vertreter haben die Berechtigung, die Wohnungen so zu belegen, daß für jede Person an Wohn-und Schlafraum zusammen 7 m² zur Verfügung bleiben. Küchen werden nicht mitgerechnet. Wenn keine besondere Kochgelegenheit vorhanden ist, geschieht die Küchenbenutzung gemeinsam.
Jeder Wohnungsinhaber, der einen Flüchtling mit Zuweisungsschein des Wohnungsamtes abweist, wird zur Verantwortung gezogen und bestraft. Die für die Flüchtlinge bestimmten Wohnräume sind mit dem nötigen Inventar auszustatten...“
Tabelle 1
Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Delmenhorst in den Jahren 1850-1950
(Quellen: Grundig,E., Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-1952, in: Baha,216)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
a= Bis 1910 wurde ein „Stadtbezirk“ und ein „Ländlicher Bezirk“ getrennt aufgeführt.
Tabelle 2
Personalbestand der Stadtverwaltung Delmenhorst
(Quelle: Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1952-1955, VB 1956-1960, in:Baha,242)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3
Die Wahlergebnisse der Delmenhorster Kommunalwahlen von 1946 bis 1968 (in Prozent)
(Quelle: Stadtarchiv Delmenhorst 073)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4
Arbeitslosenstatistik des Arbeitsamtes Delmenhorst
(Quelle: Grundig, E)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Am 31. Mai 1939 wurde die Statistik wegen Bedeutungslosigkeit eingestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
F = keine Angaben
Tabelle 5
Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung im Vergleich zu den Besatzungskosten
(Quelle: Baha, 54)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6
Gesamtübersicht über die Aufwendungen nach dem Soforthilfegesetz und dem Lastenausgleichsgesetz
(Quelle: Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-1970.In: Baha, 244)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Literaturverzeichnis
Baha, Norbert: Wiederaufbau und Integration. Die Stadt Delmenhorst nach 1945. Eine Fallstudie zur Problematik von Stadentwicklung und Vertriebeneneingliederung. Delmenhorst: Rieck, 1983
Glaser, Herrmann: Deutsche Kultur. Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. Wien: Carl Hauser, 1997
Grundig, Edgar: Geschichte der Stadt Delmenhorst. 4 Bd., MS 1953/1960
Lehmann, Hans Georg: Deutschland- Chronik 1945 bis 1995. Bonn: Bouvier 1996
Migration und Flucht. Aufgaben und Strategien für Deutschland, Europa und die internationale Gemeinschaft. Hg. v. Steffen Angenendt, München: Oldenbourg, 1997
Ravens, Jürgen Peter: Delmenhorst von der Gründung der Burg bis zur Gegenwart.Delmenhorst:Rieck 1972
Pressearchiv
Baha, Norbert: Wer eroberte 1945 die Stadt Delmenhorst? In: Von Hus un Heimat 2/88, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Baha, Norbert: Delmenhorst 1945-1950: Zuwanderung als Belastung. In: Von Hus un Heimat 3/88, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Baha, Norbert: Neue Machthaber in Delmenhorst: Die britische Militärregierung 1945/46. In: Von Hus un Heimat 10/88, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Baha, Norbert: Erste Amtshandlung der britischen Militärregierung in Delmenhorst 1945.In: Von Hus un Heimat 1/89, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Baha, Norbert: In Delmenhorst wurde im Herbst 1945 ein Stadtrat wiedereingeführt. In: Von Hus un Heimat 10/91, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Glöckner, Paul: Delmenhorst entging 1945 der Vernichtung.In: Von Hus un Heimat 7/81, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Müsegades, Kurt: Der ehemalige Militärflugplatz von Delmenhorst-Adelheide nach 1945. In: Von Hus un Heimat 7/81, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Müsegades, Kurt: Delmenhorst nach Ende des Zweiten Weltkrieges. In: Von Hus un Heimat 11/84, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Müsegades, Kurt: Als Pole 1945 im Sammellager Adelheide. In: Von Hus un Heimat 2/85, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
Müsegades, Kurt: Delmenhorster Kleinanzeigen 1945 nach der Stunde Null. In: Von Hus un Heimat 6/86, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt
150 Jahre Delmenhorster Kreisblatt. Sonderbeilage des DK vom 6.1. 1982
50 Jahre Nachkriegszeit in Delmenhorst, Ganderkesee und Bookholzberg. Sonderbeilage des DK vom 6.5. 1995
[...]
1 Ravens, 31
2 Ravens, 36
3 Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-1952, vgl. Tabelle 1 (Anhang)
4 Die Korkschneiderei wie auch das Zigarrenhandwerk fand bis ca. 1855 ausschließlich in Heimarbeit statt- ab 1855 gab es vermutlich zwei korkverarbeitende Fabriken mit insgesamt 16 Arbeitern in Delmenhorst, Ravens, 32
5 150 Jahre Delmenhorster Kreisblatt, 57
6 Da sich Delmenhorst bereits seit den 50er Jahren i m Zollverein befand, Bremen jedoch erst 1888 Mitglied dieses Vereins wurde, war es für die Fabrikanten günstiger, in Delmenhorst zu produzieren und so die Zölle zu sparen, Ravens, 32
7 Grundig,Bd.4, 940-999, vgl. Ravens, 32
8 Baha, 22
9 Grundig,Bd. 4, 1145
10 Baha, 23
11 Baha, 24
12 Ravens, 46
13 Grundig, Stat.Hjb. 1947 ff., in: Baha, 221, vgl. Tabelle 4 (Anhang)
14 Grundig, Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-50, vgl. Tabelle 1 (Anhang)
15 Es wurden schätzungsweise 40 000 Bomben über Delmenhorst abgeworfen, wobei ein Großteil jedoch in den Grünanlagen oder die umliegenden Wiesen und Weiden detonierten 50 Jahre Nachkriegszeit
16 50 Jahre Nachkriegszeit, vgl. Baha, 30
17 Im Laufe des Krieges erhöhte sich die Einwohnerzahl der Stadt von 38147 auf 41784 Menschen,was einen Zuwachs von 3637 bedeutet. Dieser Zuwachs teilt sich auf in 597 Geburten und 3040 Zugezogene.
18 Offizieller Werbeslogan der Stadt
19 Glaser, 32
20 Lehmann, 20
21 Die 51. schottische Highland Division konnte die Stadt ohne nennenswerte Widerstände erobern, was die Stadt nach Aussage eines höheren britischen Offiziers vor einem flächendeckenden Bombardement bewahrte-dieses war für den 20. April um 16 Uhr geplant.Paul Glöckner in:Von Hus un Heimat, Juli 1981
22 Stadkommandanten: 4.45-11.45: Lt.Col. T.F. Laverty, 11.45-2.46: Lt. Col. A.L. Cameron, 2.46-9.46: Lt. Col. Dier, 9.46-11.46: Major Birkett. Polizeioffizier: ab 21.4.45: Lt. Brown. Verwaltungsoffiziere: 21.4.45-25.4.45: Major F. Ward, danach Major Summers.
23 Baha, 35
24 ebd.,36
25 Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-51, 59
26 J. Schmidt, G. Onken, A. Ahrens, F. Bahrs, E. Appenroth, O. Balzer, B. Behlmer, J,.Brinkmann, H. Dannhoff, E. Fahrenkamp, E. Frericks, A. Graf, T. Hinrichs, T. Holzenkämper, W. von der Heyde, A. Hoyng, J. Hogrebe, W. Huntemann, D. Helmers, L. Kaufmann, H. Möhlenhoff, F. Schütze, K-H. Schröder, W. Schroers, B. Siegfried, J. Timmermann, J. Weyhausen, P. Woehl. Norbert Baha in: Von Hus un Heimat, Oktober 1991
27 vgl. Dokument 1 (Anhang), Baha, in Von Hus un Heimat ,Oktober 1991
28 s. Tabelle Nr. 2 (Anhang)
29 Baha, 38
30 Grundig, vgl. Tabelle Nr. 1 (Anhang)
31 ebd.,vgl. Tabelle Nr. 1 (Anhang) ,vgl. P.W. Glöckner, in: Von Hus un Heimat“ September 1997,67
32 s. Krause, 25 ff in: Baha, 38
33 Baha, 39
34 Brickwede, Interview vom 16.12.1981, in: Baha, 39
35 am 01.06.45 erschien die erste Ausgabe der „Amtlichen Delmenhorster Mitteilungen“, in denen im August 1946 auch die ersten privaten Kleinanzeigen erschienen. Sie bestand bis zum Februar 1947.K. Müsegades,in: Von Hus un Heimat, Juni 1986
36 Baha in: Von Hus un Heimat, April 1991
37 Stadtarchiv Delmenhorst 073, in: Baha, 253, vgl. Tabelle Nr. 3 (Anhang)
38 Ravens, 49
39 Baha,42
40 Lehmann, 63
41 diese Zahl beinhaltet Ausgebombte, Evakuierte, Flüchtlinge und Fremdarbeiter
42 Baha, 35.vgl. K. Müsegades in: Von Hus un Heimat, November 1984
43 K. Müsegades, in: Von Hus un Heimat, Juli 1981, vgl. A. Klabes, in: Von Hus un Heimat Februsr 1985
44 K. Müsegades, in: Von Hus un Heimat, November 1984
45 bei diesen Werten handelt es sich um Schätzungen, da das städtische Meldeamt seine Arbeit 1945 für einige Monate unterbrechen mußte, Baha, 269
46 Sitzungsprotokolle des Vetrauenssauschusses, 28.11.1945, in: Baha, 269
47 Sitzungsprotokolle des Vertrauensausschusses, 24.10.1945, in: Baha, 268
48 “Swallow Distribution“ war der Deckname der Transporte in die Britische Zone, Lehmann, 53
49 vgl. Dokument 1 (Anhang)
50 in DEL existierten 1945 8692 teilw. zerstörte Wohnungen, in denen zu diesem Zeitpunkt bereits über 40 000 Menschen lebten.150 Jahre DK, 69
51 Seit dem 21.06.1943 galt die „Wohnraumversorgungsverordnung“, die es der Verwaltung erlaubte, auch nach dem Krieg „dirigistische Maßnahmen“ zu ergreifen, Verwaltungsberichte der Stadt Delmenhorst 1945-1951, 231 f.
52 bis 1951 beschafften die Dienststellen über 8000 Strohsäcke, 4000 Bettgestelle, 4000 Sitzmöbel und über 4000 Schränke.Ravens, 48 Weiterhin zahllose Gegenstände (Küchengeschirr, Bekleidung, Bettzeug) und Geld: Bei einem Weihnachtsappell 1945 kam die Summe von 107 000 RM zugunsten der Flüchtlinge zusammen.
53 vgl. Dokument 1 (Anhang)
54 1946 fanden in Delmenhorst 13845 Zuzüge statt - bei einer Zahl von 6098 Fortzügen ergab sich eine Neubürgerquote von 7747. Baha,Norbert: Delmenhorst 1945-50. Zuwanderung als Belastung.In: Von Hus un Heimat 2/88
55 Müsegades, Kurt: Der ehemalige Militärflughafen Delmenhorst-Adelheide nach 1945.In: Von Hus un Heimat 7/81
56 26.11.46: 231 Personen, 5.12.46: 292, 8.1.47: 325,alle aus dem Großraum Breslau.8.3.47: 247 aus der SBZ. Baha, 48. Im Zeitraum vom August 1947 bis zum 31. 12. 1951 wurden mehr als 2400 Neuankömmlinge registriert - der Anteil der Neubürger steigerte sich auf über 30 %. Baha, 49
57 1949/50: 450 Beschäftigte in der Caspari- Kaserne
58 vgl. Tabelle 5 (Anhang)
59 Baha, 54
60 Die niedersächsische Landesregierung erließ am 11.06.47 das „Gesetz über die Flüchtlingsbetreuung“. Da das Land N´sachsen jedoch recht finanzschwach war, traten keine besonderen Verbesserungen ein. Die Notverordnungen der Bundesrepublik konnten erst ab 1950 wirksa eingreifen. Baha, 50
61 Baha, Norbert: Ära der Delmenhorster Flüchtlingslager bis 1962.In: Von Hus un Heimat 6/89
62 ebd.
63 Baha, 122
64 ab 1948 wurden nur 9 von 638 Wohnungen ohne die Unterstützung der Stadt fertiggestellt. Baha, Norbert:In Delmenhorst Sozialer Wohnungsbau 1950/1951“.In: Von Hus un Heimat 5/89
65 Die Gesellschaft zählte 1949 bereits 1493 Mitglieder und finanzierte in Zusammenarbeit mit der Stadt 38 Neubauwohnungen. Baha, 121
66 Baha, 120
67 Diese Gesellschaft existierte bereits seit 1936: Ihr Vorstand bestand aus Ratsmitgliedern und städtischen Beamten.
68 Baha, Norbert: Ära der Delmenhorster Flüchtlingslager bis 1962. In: Von Hus un Heimat 6/89
69 Baha, 126
70 ebd.
71 Festschrift 25 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Delmenhorst 1974,7. In: Baha, 126
72 vgl. Tabelle 6 (Anhang)
73 Allein in den Sommermonaten 1948 wurden in DEL 2000 Berufstätige gekündigt, die Neubürger stellten zeitweise 35 % der Arbeitslosen dar.Baha, 83
74 1950 erreichte die Zahl der Beschäftigten die Rekordzahl von 2400 Personen, von denen knapp 40% Flüchtlinge waren. Baha, 100
75 ebd.
76 1956 stellten folgende Berufsgruppen die Pendler Delmenhorsts nach Bremen: 45,9% Metallbranche, 19,2&% Bauberufe, 11,4 % Handel-,Geld-und Versicherungswesen, Dienstleistungs-und Verkehrswesen jeweils 11,3%.DK vom 9.10. 1956.
77 Standesamt Delmenhorst.In: Baha, 230
78 Baha, 255
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit über Delmenhorst nach dem Zweiten Weltkrieg?
Diese Hausarbeit untersucht, wie die Stadt Delmenhorst mit der militärischen Besetzung durch die Briten und der Aufnahme von über 17.000 Flüchtlingen und Vertriebenen umging. Dabei wird die Geschichte der Stadt analysiert, um die Faktoren zu identifizieren, die die Integration begünstigten oder behinderten und somit die Voraussetzungen für die Eingliederung und den Wiederaufbau der Stadt schufen.
Wie erfolgte die politische und administrative Neuorganisation Delmenhorsts nach 1945?
Delmenhorst wurde der britischen Militärregierung zugeteilt. Die britische Regierung verfolgte im Wesentlichen die auf der Potsdamer Konferenz beschlossene Besatzungspolitik (Demilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung, Demokratisierung und Dekartellisierung). Zunächst herrschte eine "Politik des Abwartens", doch später überließen die Briten den Deutschen die Ausführung der Verwaltung, während sie selbst die Kontrolle ausübten. Ein "Vertrauensausschuss" wurde gebildet, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Kommunalwahlen wurden abgehalten, und es erfolgte eine Umwandlung zur zivilen Verwaltung.
Wie gestaltete sich die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in der Besatzungszeit?
Delmenhorst nahm zahlreiche Flüchtlinge, insbesondere aus Bremen und den Ostgebieten, auf. Es gab Herausforderungen wie Wohnungsnot, Ernährungsschwierigkeiten und organisatorische Probleme. Die Stadt richtete eine Flüchtlingsberatungsstelle ein, um die Situation zu bewältigen. Die "Operation Schwalbe" führte zu weiteren Flüchtlingstransporten. Die Behörden waren überfordert, und es kam zu Spannungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen.
Welche Auswege wurden aus der Flüchtlingsproblematik gesucht, und welche Grundlagen wurden für die Integration geschaffen?
Der soziale Wohnungsbau wurde als wichtige Aufgabe des städtischen Wiederaufbaus betrachtet. Die Wohnungsbaugemeinschaft Delmenhorst e.V. und die Gemeinnützige Siedlungsgemeinschaft Delmenhorst (GSG) wurden aktiv. Neubürger beteiligten sich am Wohnungsbau, und Vertriebenenverbände unterstützten den Bau von Siedlungshäusern. Der wirtschaftliche Aufschwung trug zur Lösung der Arbeitslosigkeit bei, die besonders Neubürger betraf. Ostdeutsche Unternehmer bauten eine Bekleidungsindustrie auf. Die Verlagerung von einer einseitigen Industrie auf ein breiter gefächertes Angebot von Industrien führte zu Vollbeschäftigung.
Wie lässt sich das Fazit der Integration der Flüchtlinge in Delmenhorst ziehen?
Die Integration der Flüchtlinge in Delmenhorst nach dem Zweiten Weltkrieg kann als erfolgreich angesehen werden. Soziale Unterschiede zwischen Einheimischen und Neubürgern wurden abgebaut. Eheschließungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen nahmen zu. Flüchtlinge waren in städtischen Ausschüssen aktiv. Der wirtschaftliche Aufschwung sicherte die finanzielle Unabhängigkeit der Flüchtlinge. Die aktive Beteiligung am Neuaufbau der Stadt und die Eingliederung der Neubürger in die Delmenhorster Gesellschaft verdeutlichen, dass ein Großteil der Flüchtlinge und Vertriebenen diese Stadt als ihre neue Heimat anerkannten.
Welche Art von Dokumenten sind im Anhang vorhanden?
Der Anhang enthält ein Dokument zum Ablauf der Vorgänge bei Ankunft eines Flüchtlingszuges, eine Meldung des Amtlichen Anzeigers Delmenhorst vom 16. März 1946 bezüglich der Bereitstellung von Wohnraum, eine Tabelle zur Bevölkerungsentwicklung Delmenhorsts von 1850 bis 1950, eine Tabelle zum Personalbestand der Stadtverwaltung, eine Tabelle mit Wahlergebnissen der Kommunalwahlen, Abkürzungen, eine Arbeitslosenstatistik und eine Übersicht über die Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung.
- Quote paper
- Kristina Wiemann (Author), 1998, Eine neue Heimat- Flüchtlinge nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96745