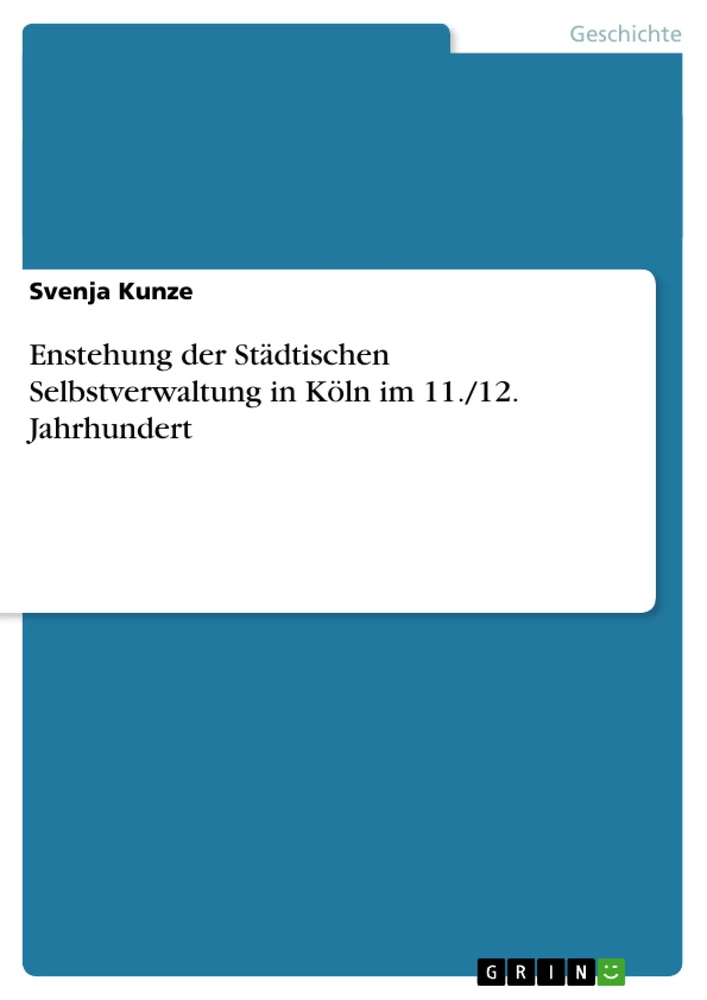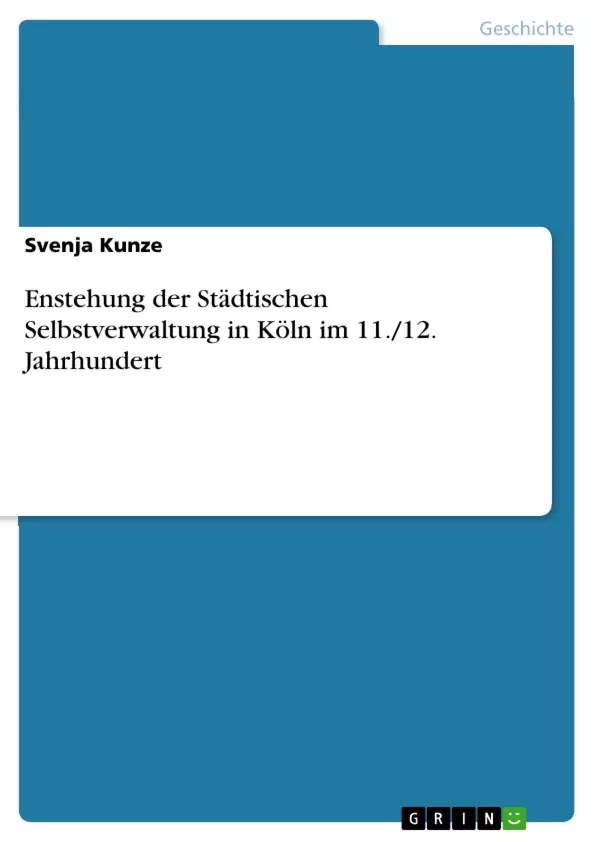Köln im Mittelalter: Eine Stadt im Aufbruch – tauchen Sie ein in eine Epoche des Wandels und der städtischen Emanzipation! Dieses Buch enthüllt, wie sich Köln vom karolingischen Randgebiet zu einem pulsierenden Zentrum des ottonischen Reiches entwickelte, ein Aufstieg, der untrennbar mit dem Wirken visionärer Erzbischöfe verbunden ist. Verfolgen Sie die entscheidenden Stadterweiterungen, die den wachsenden Wohlstand und die zunehmende Bevölkerung widerspiegeln, während sich das wirtschaftliche Leben entlang des Rheins entfaltet. Doch hinter der glänzenden Fassade brodelt es: Erleben Sie den Aufstand von 1074, ein dramatisches Zeugnis des erwachenden Selbstbewusstseins der Kölner Bürger gegenüber ihrer Stadtherrschaft. Entdecken Sie, wie die Ereignisse des Investiturstreits die Stadtgemeinde formen und ihr Handeln als politisch und militärisch selbstständige Einheit festigen. Die Urkunde Heinrichs IV. markiert einen Wendepunkt, der die Bürger direkt an den König bindet und über den Erzbischof hinwegsetzt – ein kühner Schritt zur kommunalen Autonomie. Die "coniuratio pro libertate", ein geheimnisvoller Schwur von 1112, gibt bis heute Anlass zu Spekulationen über das Ausmaß der bürgerlichen Selbstverwaltung. Das Stadtsiegel, ein Symbol bürgerlicher Identität, zeugt von der wachsenden Organisation und den Kompetenzen der Bürgerschaft. Begleiten Sie die Kölner in ihrem Aufstand gegen Heinrich V., ein Akt des Widerstands, der ihre Unabhängigkeit vom Erzbischof demonstriert. Dieses Buch analysiert die Organe und Organisation der Stadtgemeinde, von der Gesamtgerichtsgemeinde bis zum einflussreichen Schöffenkolleg, und zeigt, wie diese Institutionen die Grundlage für die spätere kommunale Verfassung bilden. Erfahren Sie, wie gemeinsame Interessen und Aufgaben die Bürgerschaft zusammenschweißen und Elemente städtischer Selbstverwaltung entstehen lassen, die die Stadtherrschaft sukzessive einschränken. Eine fesselnde Reise in die Vergangenheit, die die Wurzeln der Kölner Identität und die Entstehung einer selbstbewussten Stadtgemeinde lebendig werden lässt. Schlüsselwörter: Köln, Mittelalter, Stadtgeschichte, Erzbischof, Bürgertum, Selbstverwaltung, Investiturstreit, Stadterweiterung, Aufstand, Heinrich IV., Heinrich V., Stadtsiegel, Schöffenkolleg, Gemeindeentwicklung, Verfassungsgeschichte, Sozialgeschichte, Rechtsgeschichte, rheinische Geschichte, kommunale Emanzipation, Gerichtsgemeinde, Kaufmannsgilde, Reichspolitik, Militärgeschichte, Stadtplanung, Handel, Wirtschaft, Bevölkerungswachstum, politische Autonomie.
1. Entwicklung der Stadt Köln bis zum 11. Jahrhundert allgemeine Entwicklung
Karolingerzeit:
mit der Erweiterung des Frankenreiches in den Sachsenkriegen rückt Köln von der Peripherie des Reiches weiter in dessen (geographisches) Zentrum; im Rahmen der kirchlichen Neuor- ganisation wird Köln zum Erzbistum erhoben. Aachen bleibt aber unangefochtenes Zentrum des Frankenreiches. Was Köln betrifft, kann man, auch aufgrund der geringen Bevölkerungs- dichte, selbst in der späten Karolingerzeit kaum von einem urbanen Leben sprechen, ggf. vor- handene Ansätze dazu sind dem Normannsturm von 881 zum Opfer gefallen. In spätkarolin- gischer und frühottonischer Zeit entwickelt sich der Dombereich zum neuen Zentrum Kölns, mit zentralen kirchlichen und geistigen Funktionen auch für das gesamte Bistum.
Ottonenzeit:
Unter Heinrich I. kristallisiert sich das Rheinland mit den drei Bischofsstädten Köln, Mainz und Trier als (politische) Kernlandschaft des Deutschen Reiches heraus; wirtschaftlich ist die Lage an den wichtigen Handels- und Verkehrswegen Rhein und Rheintal förderlich für den Aufschwung Kölns Aufstieg zum rheinischen Oberzentrum beginnt mit Erzbischof Bruno I. (953-965), der als Bruder Ottos I. und Herzogs von Lothringen auch in der Reichspolitik eine hohe Stellung einnimmt (vgl. ottonisch-salisches Reichskirchensystem). Die Herauslösung des städtischen Gerichtsbezirks aus dem Kölngau ist eine wichtige Voraussetzung für die um- fassende weltliche Stadtherrschaft der Erzbischöfe, die mit Bruno I. beginnt.
Aufstieg Kölns durch Kirchengründung, Bautätigkeit etc.
- wirtschaftlich: Mitte des 10. Jahrhunderts (948) wird die Stadt erstmals über die alten Römermauern erweitert, als die Kaufmannssiedlung am Rheinufer ummauert wird.
- Politisch: 965 zeugt die Tatsache, daß die gesamte königliche Familie Pfingsten in
Köln verbringt, und der anschließende Reichstag in Köln von der gewachsenen Bedeutung der Stadt.
Die Nachfolger Brunos setzen dessen Politik fort (enge Verbindung mit sächsischem Königs haus; Ausbau der Stadt nach polit./ wirtschaftlichen Erfordernissen etc.) und festigen die Stel- lung der Kölner Erzbischöfe als Stadtherrn (Hochgerichtsbarkeit, Bannabgeben und Zölle, Marktaufsicht, ab 1027 Münzregal), aber auch ihre Position in der Reichspolitik. Das zieht positive wirtschaftliche Folgen für die Stadt nach sich: (Fern-)Handel, Bautätigkeit, Dienstleistungen etc. bringen sichtbaren Wohlstand in die Stadt und sorgen für eine großen Bevölkerungszuwachs.
Stadterweiterungen/ Besiedlung:
Alte Römerstadt: 98, 6 ha; die römische Befestigungsanlage ist im 11. Jhdt. zwar noch exi-stent, die Stadt hat aber spätestens seit dem Normannensturm 881 den antiken Charakter end- gültig verloren. Das weltliche Siedlungszentrum befindet sich seit der Karolingerzeit zwi- schen der alten römischen Heerstasse ("Hohe Straße") und der rheinseitigen Römermauer, der Westen des alten Areals ist dünn besiedelt und wird noch bis ins 11. Jhdt. landwirtschaft- lich genutzt.
Der Handel konzentriert sich am Rheinufer, es bildet sich eine Händlervorstadt heraus mit den beiden Märkten Alter- und Heumarkt; die 948 in die Stadtbefestigung einbezogen wird; der Siedlungsschwerpunkt verlagert sich damit noch weiter nach Osten (Hohe Strasse - Rhein).
In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts wird an der westlichen Stadtmauer der Neumarkt angelegt (zur Gegensteuerung im Rahmen bischöflicher Stadtplanung?, weil es im Osten zu eng für die wachsende Wirtschaft wird?). Er dient wohl v.a. dem Landhandel. Trotz dieser Maßnahme bleibt der westliche Teil lange unterentwickelt' bzw. hinkt der dynamischen Ent- wicklung im Osten nach.
Mitte des 11. Jahrhunderts wird versucht, durch Aufschüttungen noch mehr Land am dichtbevölkerten Rheinufer zu gewinnen. Förderung der Aufsiedlung durch freizügiges Liegen- schaftsrecht, das Siedler anlocken soll.
2. Ausgangslage für die Entwicklung städtischer Selbstverwaltung - Erzbischof und Stadtgemeinde in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts
2.1 Die Stadtherrschaft
Die Fülle aller geistlichen und weltlichen Gewalt besaßen als Stadtherrschaft die Erzbischöfe.
Der Bischof als Stadtherr:
Die weltliche Herrschaft erhalten die Bischöfe als Regalien vom König; de iure unterliegen sie also seinem Urteil und seiner Aufsicht. De facto aber weitgehende Unabhängigkeit des Bischofs; enorme Machtfülle durch die Vereinigung von geistlicher und weltlicher Macht und entsprechendes Selbstverständnis als Stadtherr (-> Persönlichkeit des Bischofs/ Interessenla- gen als Einflussfaktoren auf die tatsächliche Ausübung dieser Machtfülle). Der Erzbischof hält finanziell nutzbare Rechte (Zoll-, Markt-, Münzregal; Judenschutz) und ist Träger der Herrschaftsgewalt in der Stadt (Friedenswahrung, Sorge für Recht und Gerech- tigkeit im Gerechtigkeit im Gerichtsbezirk Stadt). Die Umsetzung dieser Rechte und Aufga- ben erfordert eine Organisation/ Verwaltung mit entsprechenden Ämtern.
Verfassung und Verwaltung:
Gerichtsverfassung: Der Bischof ist oberster Richter. Allerdings wird die Hohe Gerichtsbarkeit faktisch ausgeübt durch den Burggrafen als Hochrichter (Amt 1932 erstmals bezeugt), der als ursprünglicher Stadtkommandant dem König unterstellt ist, und dem Stadtvogt als Niederrichter (1047 bezeugt), der dem Erzbischof direkt unterstellt ist. Die Schöffen werden vom Erzbischof .Verwaltung: Ministerialen als bischöfliche Dienstmannschaft, bilden zunächst eigene Gruppe, aber zunehmende Verflechtung mit den reichen Kaufleuten; Zöllner, Münzer etc. als angesehene Ämter mit z.T. großer Nähe zum EB. Spätestens seit Beginn des 12. Jhdts., vermutlich aber schon seit der Mitte des 11. Jhdts. werden viele Ämter durch den Bischof mit Bürgern besetzt, wichtig ist hierbei v.a. das Schöffenamt.
Gesamtgerichtsgemeinde - Parochien (i.d.R. Pfarrsprengel, Priester etc. als Teil der Bischöflichen "Verwaltung")
2.2 Die Bürger (oder besser: Stadtbewohner)
Bevölkerung
Stadterweiterungen als Indiz für ein rasches Bevölkerungswachstum, v.a. durch Zuzug. Für den Beginn des 12. Jahrhunderts wird die Bevölkerungszahl auf 12 000 geschätzt, daraus lassen sich die Verhältnisse für das späte 11. Jhdt. ableiten.
Wirtschaftliche und soziale Verhältnisse
Im 11. Jhdt. geht die Entwicklung zum Exportgewerbe (Leder, Waffen, Wolltuche, Schmuck), der Handel nimmt zu. Handwerk und Handel verflechten sich zunehmend (-> Arbeitsteilung). Zentrum des wirtschaftlichen Lebens sind der Heumarkt mit den angrenzende Gassen und das
Hafenviertel am Rhein. Zunehmender Wohlstand und wirtschaftliches Potential bei einer entstehenden ‚Bürgerschicht'.
Insgesamt sehr heterogenes Sozialgefüge, abgrenzen lässt sich eine bürgerliche Führungsschicht, eine ‚Mittelschicht' und die Unterschichten. Sonderrolle der Juden.
- Das "Meliorat"/ die Primores: v.a. reiche Kaufleute, deren Vermögen aus Handelsge winnen stammt (,Geldaristkratie'); neben wirtschaftlicher auch politische Führungs schicht (stellen Schöffen und stehen z.T. als Ministerialen im Dienste des EB. Organi sation in der Kaufmannsgilde, die Ende des 11. Jhdts. Etwa 200-300 Mitglieder gehabt haben dürfte.
- Handwerker und Kleinhändler als Mittelschicht
- Unterschicht i.d.R. ohne Bürgerrechte; in sich stark differenziert (vom Bettler bis zum Gesellen/ Dienstboten)
Nicht-kommunale Gemeinden/ Zusammenschlüsse
Die Gerichtsgemeinde als einzigste ‚Institution', die die gesamte Bürgerschaft überwölbt. Das Hochgericht tagt 3mal jährlich zum ‚Wizzichding'. Die Pfarrgemeinde als "Lebenswelt", eigentlicher Bezugspunkt des Individuums. I.d.R. angelehnt an die Pfarreinteilung sind die Sondergemeinden mit niederen gerichtlichen Aufgaben.Die Kaufmannsgilde als Zusammenschluß/ v.a. wirtschaftliche "Interessenvertretung" der Kaufleute, genossenschaftliche Organisation; eng verknüpft mit der Gemeinde der Kaufmannskirche St. Martin (Kirchenbau durch reiche Kaufleute vor 1080!, der Gemeinde obliegt der Unterhalt der Kirche, aber auch die Wahl des Pfarrers). Eine Zunft ist für Köln erstmals 1149 belegt.
Gemeinden stehen aber zunächst nicht im Zusammenhang mit bürgerlichen Selbstverwal-tungsbestrebungen, aber gg. Ansatzpunkt für die spätere Entwicklung. Sie führen die Bürgerschaft oder Teile davon regelmäßig zusammen, regen ggf. zur Mitbestimmung an und übernehmen gemeinschaftliche Aufgaben.
3. Einblicke in die Gemeindeentwicklung
Quellenlage: mäßig. aus einzelnen Quelle über bestimmte Ereignisse müssen Rückschlüsse auf Entwicklungsstand der städtischen Selbstverwaltung gezogen werden. Einblicke in die Gemeindeentwicklung sind eher "Momentaufnahmen". Großer Interpretationsspielraum, daher sehr verschiedene Auslegungen/ Schwerpunktsetzung durch die Forschung.
3.1 Der Aufstand von 1074 und seine Konsequenzen
Der Aufstand in den Quellen
Hauptquelle sind die Annalen Lamperts von Hersfeld. Ungewöhnlich ausführliche Beschrei- bung der Ereignisse; allerdings ist Lampert Position und Wahrnehmungsweise zu beachten.
-> Ablauf
spontane Revolte - organisierte Erhebung?
Lampert deutet in den Annalen an, die Kölner hätten nach Wormser Vorbild gehandelt; inso- fern unterstellt er ihnen eine gewissermaßen geplante Handlung: die Absicht (Planung?) zum Aufruhr gegen den Bischof ist da, es fehlt nur noch ein Anlaß...und da kommt die Beschlag- nahme gerade recht. (-> Perspektive Lamperts beachten! Mittel der Geschichtsschreibung) Wie war das Verhältnis der Bürger/ der primores zum Stadtherrn vor 1074? Gab es schon Konflikte?
Oder gar: Gegensatz Bürger- Stadtherr als soziale Frage der Zeit?
Möglich: Machtsanspruch des Bischofs (Anno im besonderen, selbst Lampert beschreibt ihn als jähzornig) vs. Interessen der Kaufleute/Kaufmannsrecht (Rechtsstellung der Kaufleute als freie Königsmuntlinge!)
- Kaufmannssohn verweist auf die Unberechenbarkeit und Strenge des EB, der oft Wi derrechtliches anordnet, um das Volk auf seine Seite zu ziehen, greift er dabei auf Erfahrungen zurück?
- Hat EB mit Problemen gerechnet? -> Fluchtweg
Der selbst Aufstand scheint eher spontan entstanden zu sein, als Reaktion des betroffenen Kaufmanns und seiner Gildegenossen gegen die Beschlagnahme des Schiffes durch den EB, und den Bruch des Kaufmannsrechts oder wenigstens der Tradition dadurch. Kaufmannssohn sammelt hastig seine Untergebenen und Freunde, um zum Schiff zu ziehen; wiegelt Volk zum Umsturz auf...
Auf jeden Fall sind keine klaren Ziele der Aufständischen bezüglich der städt. Herrschaftsordnung zu erkennen; Aufbegehren nicht gegen das ‚System', sondern gegen die Person Annos bzw. seine als ungerecht empfundenen Maßnahmen. Kaufmannsgilde als Träger des Aufstandes; spontan gebildeter Aufstand zur Wahrung eigener Interessen, keine gesamtbürgerliche Initiative/ Organisation sichtbar. Aufstand scheitert schnell: Hinweis auf Fehlen einer Vorbereitung/Organisation und einer breiten kommunalen Basis.
Rückschlüsse auf das Verhältnis Stadtherr - Bürger/ Konsequenzen für Herrschaftsgefüge?
Obwohl der Aufstand scheitert und sich die Bürger dem EB fügen müssen, zeigt sich doch ein gewachsenes Selbstbewusstsein der ‚primores' gegenüber der Stadtherrschaft. Man nimmt Entscheidungen des EB nicht mehr ohne Weiteres hin und ist offenbar bereit, seine Rechte notfalls mit Gewalt und zu verteidigen. Dagegen sind keine Ansätze der Bürger zu erkennen, sich zu organisieren und Bereiche der Stadtherrschaft in die eigene Hand zu nehmen: reine Abwehrhaltung.
Der EB muss erkennen, dass er gegen die primores nicht regieren kann, dazu ist v.a. ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt zu groß (-> er nimmt sie nach seiner Rückkehr wieder in die Stadt auf und verpflichtet sie auf die Verteidigung der Stadt!)
Erschütterung des Herrschaftsgefüges? Geht wohl zu weit, denn Verselbständigung der Bürger ist nicht von Dauer, aber:
- Stadtherrschaft zeigt strukturelle Schwächen, es zeigt sich eine gewisse Verschiebung der Macht zu Ungunsten des EB.
- Bürger übernehmen mit der Stadtverteidigung einen gemeinsamen Auftrag, dessen Ausführung (Festungsbau, milit. Aufgebot etc.) eine gewisse Organisation erfordert -> Ansatzpunkt für Gemeindebildung?
"Die Selbstbehauptung der Bürger trotz Kapitulation, Demütigung und unzureichender Hilfe des Königs deutet an, dass die städtische Gesellschaft zu einer selbständigen Macht gewachsen war." (Stehkämper)Ggf. erster Schritt auf dem Wege zur kommunalen Emanzipation? Für die folgenden 32 Jahre (immerhin eine Generation!) fehlen Quellen, insofern sind ist die weitere Entwicklung unklar. Inwiefern gab es noch ‚Fortschritte'? Stagnation oder kontinuierliche Entwicklumg?
Hinweis: Vereinbarung mit Huy und Lüttich über Zollsätze 1103: die 12 namentlich genann- ten Schöffen betätigen auf Veranlassung des EB die Zollsätze, die Kaufleute in Köln zu ent- richten haben --- wachsender Aufgabenbereich der Schöffen, nicht mehr ausschließlich in der Gerichtsbarkeit tätig, sondern auch in Aufgaben der städt. Verwaltung/ Repräsentation (inwiefern wird das Schöffenamt als 'Behörde' im Sinne der Bürger genutzt/ ausgestaltet?)
Den nächsten Einblick bietet erst wieder ...
3.2 Die Erhebung für Heinrich IV (1106)
Das Verhältnis der Kölner Bürger zu Heinrich IV.
- Aufständische suchen 1074 Hilfe bei Heinrich IV., Heinrich kommt aber nicht
- dennoch: hohes Ansehen Heinrichs in Köln (seine Friedenspolitik ist Handel förderlich)
- enge Verbundenheit Heinrichs mit der Stadt, u.a. besucht er noch 10 die Stadt, feiert dort Weihnachten und Ostern und 1089 seine Hochzeit
- Positionen im Investiturstreit?
Bei der Auseinandersetzung Heinrich IV. Mit seinem Sohn Heinrich V. stellen sich die Kölner unaufgefordert auf die Seite des Vaters und erkennen ihn trotz seines (erzwungenen?) Thronverzichts weiter als rechtmäßigen Herrscher an. Der Kölner EB dagegen wendet sich Heinrich V. zu und lädt 1106 zum Osterfest nach Köln ein.
Die Ereignisse
Heinrich IV ist auf der Flucht, als er von der Parteinahme der Kölner für ihn hört, kehrt er Mitte April 1106 (16.?) in die Stadt zurück, die er im Februar hatte verlassen müssen. Die Kölner vertreiben (auf Heinrichs Geheiß) den EB aus der Stadt. Sie schwören den Treueeid auf Heinrich I. erhalten von ihm die Erlaubnis/ den Auftrag zur Erweiterung der Stadtmauer und damit zur Einbeziehung der Vororte Niederich und Oversburg und des Gebietes um St. Aposteln westlich des Neumarktes (Erweiterung um 80h auf insgesamt 203ha) -> Urkunde, an die Burger der Stadt Köln gereichtet!
Bereits drei Monate später hält die Befestigung einer Belagerung durch Heinrich V. stand, den die Kölner schließlich mit der Sperrung der Rheinschiffahrt zum Aufgeben zwingen.
Die Stadterweiterung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Stadtgemeinde Die Kölner Bürgerschaft tritt hier als politisch und militärisch selbständig handelnde Einheit auf!!
- Bündnis gegen die Interessen des Bischofs
- durch die Ausstellung einer Urkunde vom König wird sie quasi als eigenständiger Rechtspartner anerkannt, setzt sich über den Stadtherrn hinweg, verpflichtet sich dem König und leitet ihre Rechte direkt vom König ab
- die Urkunde spricht von 'cives' und meint damit vermutlich alle Kölner Burger/ die Kölner Bürgerschaft als Ganzes
- Mauererweiterung ohne Einwilligung des Stadtherrn, vermutlich sogar gegen seinen Willen
- Aufgabe der Mauererweiterung erfordert hohes Maß an Organisation der Bürgerschaft:
Koordination und Finanzierung des Baus und der Instandhaltung/Bewachung;
==> Institutionalisierungsgrad? Koordination geht vermutlich von den 'primores' und dem Schöffenkollegium aus
- faktisch geht auch Wehrhoheit auf die Bürgerschaft über; damit auch ein Teil der Steuerhoheit auf die Bürgerschaft über ('belli stipendia'/ Kriegssteuern und deren Ein- treibung und Verwaltung)
- Stadtplanung und -Gestaltung in bürgerlicher Hand?
==> Effizienz der bürgerlichen Organisation!
"Bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts hatte sich eine selbstbewußte, unter eigener Führung stehende Stadtgemeinde herausgebildet, die sowohl militärisch als auch politisch selbständig zu handeln vermochte" (Schulz). Der erste legale Schritt zur Emanzipation geschieht Kraft königlicher Autorität, das erste politisch bedeutsame Recht ist also staatlichen Ursprungs! Wesentliche Anerkennung und Bestätigung der Gemeindebildung durch Heinrich IV.! Mit dem Befestigungsrecht hängt neben der Wehr- und Steuerhoheit auch ein 'selbständige Außenpolitik' zusammen: Bündnis der Kölner Bürger mit den Lüttichern zur Unterstützung Heinrich IV. Gegen seinen Sohn
Nach dem Tod Heinrich IV im August 'erkaufen' sich die Kölner schließlich die Gunst Heinrich V. mit 5000 Mark: Kapital wird zum politischen Faktor -> Einflußmöglichkeiten der reichen Kaufleute! Stadtgemeinde wird auch von Heinrich V. als Rechtspartner anerkannt, die Rechte bleiben ihr erhalten
3.3 Die "coniuratio pro libertate" und ihre Interpretation
Nur eine Nennung in einer 'Randnotiz' der Kölner Königschronik, dort datiert auf 1112: "Coniuratio Coloniae facta est pro libertate".
(inzwischen wird die 'coniuratio' eher auf 1114 datiert)
Bedeutung und Quellenlage unklar, daher sehr verschiedene Interpretationen und Einordnungen durch die Forschung:
- In der Älteren Literatur wird die coniuratio oft als "planmäßiger Gründungsakt der kommunalen Gemeinde" interpretiert, einem Schwurverband also, der sich gegen den EB gerichtet der bürgerlichen Selbstverwaltung verschrieben hat (neuere Litera- tur:Planitz).
- neuere Interpretationen eher: Beitritt der Stadt Köln zu einem niederrheinischen Bündnis gegen Heinrich V. 1114 oder Erneuerung des Eides von 1106 unter Einbeziehung des EB
==> aber auch hier tritt die Stadtgemeinde als selbständiger Akteur auf, ggf. sogar auf Ebene der Reichspolitik!
(Wirkung der Eidgenössischen Bewegung auf die Kölner?)
"Die Kölner Stadtgemeinde ist nicht als freie Einung entstanden, sondern in einem langen Prozeß (aus der Gerichtsgemeinde) gewachsen" (Steinbach) Unwahrscheinlich auch, daß die coniuratio eine kommuale Einrichtung/Organisation war, dafür existieren weder Anhaltspunkte in den Quellen, noch hat sie Spuren in der Stadtverfassung hinterlassen.
3.4 Das Stadtsiegel
Datierung ungewiß, auf jeden Fall unter EB Friedrich I. (1110-1131), vermutlich um 1115 wird von der Stadt Köln geführt, und vermutlich von den Schöffen verwaltet. Zwar kein sicheres Indiz für die vollständige Emanzipation der Stadtgemeinde von der stadtherrlichen Gewalt, aber seine Existenz setzt doch eine organisierte Gemeinschaft voraus, in deren Namen das Siegel geführt wird
==> Grad der Verfestigung und Organisation der Bürgerschaft und ihrer Kompetenzen sind aber weiter unklar!
Das Stadtsiegel wird offenbar vom Stadtherrn verliehen und unter seinem Einfluß gestaltet (Bild/ Umschrift)!
- Stadtherr akzeptiert damit schon existenten Zustand bzw. Entwicklung, nämlich die Verselbständigung der Stadtgemeinde
- Förderung der kommunalen Idee durch den EB? Vielleicht weil er weiß, daß er ohne die Einbeziehung der Bürgerschaft nicht regieren kann?
- Symbol dafür, daß der EB keine Kompetenzen abgibt, sonder nur an die Gemeinde 'delegiert', betont Stellung der bürgerlichen Institutionen als Teil SEINER Stadtverwaltung (offensive Maßnahme zur Betonung der stadtherrlichen Position) ==> dieses 'Einvernehmen' Hinweis evolutionärer Charakter der Entwicklung!?
3.5 Der Aufstand gegen Heinrich V (1114-1119)
Die Ereignisse
1114: Heinrich V. zieht gegen die Frisen, um sie zur Zahlung der jährlichen Abgaben zu zwinegn, es erhebt sich eine Verschwörung der rheinischen Fürsten gegen Heinrich, an dessen Spitze sich der Kölner EB Friedrich stellt. Die Stadt Köln zählt vermutlich zu den Mitverschworenen, auf jeden Fall ist sie so weit in die Angelegenheit verwickelt, daß Heinrich seinen Angriff zuerst gegen sie richtet. Plan diesmal: nicht Belagerung, sondern Eroberung von Deutz am gegenüberliegenden Rheinufer und von dort aus Sperrung des Schiffsverkehrs. Reaktion der Kölner: schicken Truppen, v.a. Bogenschützen (neue Technik - > (Handels-) Beziehungen nach England?) und vertreiben so die kaiserliche Truppe.
==> Organisierte und effektive Verteidigung, durch die Bürger unabhängig vom Stadtherrn.
1119: Heinrich geht mit Friedrich Friedensverhandlungen ein, doch es kommt zu keinem Er- gebnis. Dennoch zieht Heinrich nach Köln und die Burger empfangen ihn - in Abwesenheit des Bischofs und mit Sicherheit gegen dessen Willen - ehrenvoll. Die Bürgerschaft ist gespal- ten, aber offenbar existiert eine bürgerliche Zentralgewalt, die die Entscheidung trifft und durchsetzt. Nach seiner Rückkehr belegt der EB auch die ganze Stadt mit dem Interdikt, die gesamte Gemeinde wird also zur Rechenschaft gezogen (nicht mehr nur, wie 1074, ein Teil) ==> Gemeinde als Körperschaft!
Interpretation:
Warum die Kölner das Bündnis verlassen und sich Heinrich V. zuwenden, ist unklar; die Vorgänge lassen jedoch darauf schließen, daß die Kölner zur Wahrung ihrer Interessen eine aktive Politik betreiben und in ihren Entscheidungen vom EB unabhängig sind.„Der Erzbi- schof wie Kaiser Heinrich V. hatten nun mehrfach erfahren, müssen, daß ihre Oberherrlich- keit nicht ausreichte, um über die Stadt Köln zu gebieten. Nur der konnte sagen, er besitze die Stadt, den die Burger es sagen lassen. Zwischen 1106 und 1119 hatte sich erwiesen, daß die Burger allein über die Macht, die ihre Stadt nun einmal aufbrachte, verfügten." (Stehkämper)
4. Organe und Organisation der Stadtgemeinde
4.1 Ansatzpunkte für ihre Entwicklung
- Gesamtgerichtsgemeinde
- Sondergemeinden
- die Kaufleute und ihre Gilde
- die Oberschicht, d.h. Verbindung aus reicher Kaufmannschaft und bischöflichen Beamten
- Schöffenkolleg
4.2 Die Ereignisse als Katalysator
Ist die Entwicklung eine Folge der Ereignisse oder spiegeln die Ereignisse eine Entwicklung wider? Die Ereignisse als Katalysator: bestehende Entwicklung wird bestärkt!
4.3 Ausprägung städtischer Selbstverwaltung zu Beginn des 12. Jhdts.
Es sind keine besonderen Institutionen der Selbstverwaltung festzustellen, offensichtlich werden die Aufgaben von bereits bestehenden oder sich in anderen Zusammenhängen formierenden Institutionen übernommen.das Schöffenkolleg übernimmt neben gerichtlichen auch administrative Aufgaben der Einfluß der sich formierenden Oberschicht als politische Führungsschicht (die Richerzeche mit eindeutigem politischem Führungsanspruch formiert sich ab der Mitte des 12. Jhdts. daraus.
Bedeutung der Sondergemeinden? z.T. eigenen Bürgermeister, Schöffen etc.
Eine voll ausgebildete Kommune mit den entsprechenden Institutionen bildet sich erst in den folgenden Jahrzehnten (Stadtrat)
5. Fazit
- Gemeindebildung als Prozess, als evolutionäre Entwicklung: Bedeutung gemeinsamer Interessen und Aufgaben für das Zusammenwachsen der Bürgerschaft, kein formeller Akt der Gemeindegründung.
- Elemente städtischer Selbstverwaltung treten zunächst neben die Stadtherrschaft und schränken diese in ihrer Absolutheit sukzessive ein, ohne sie aber grundsätzlich in Frage zu stellen.
- Am Anfang des 12. Jahrhunderts existiert eine selbständig agierende Bürgerschaft,ihre Selbstverwaltung ist allerdings wenig institutionalisiert bzw. vollzieht sich über Strukturen der ‚alten' Ordnung.
VI. Bibliographie
a) Quellen:
Lamperti Monachi Hersfeldiensis/ Lampert von Hersfeld: Annales/ An- nalen. Neu übers.von Adolf Schmidt, erl. von Dietrich Fritz. Darmstadt 1957 (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiher vom Stein-Gedächtnisausgabe, hrsg. von Rudolf Buchner, Bd. XIII)
Annales Hildesheimenses (Hildesheimer Annalen). Ed.G. Waitz, MGH SSrG Bd.8, Hannover 1878.
Vita Heinrici IV Imperatoris (Vita Heinrichs IV.). Ed. W. Wattenbach, MGH SSrG Bd.12, Hannover 1856.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
b) Sekundärliteratur
Beyerle, Konrad: Die Entstehung der Stadtgemeinde Köln. Kritische
Bemerkungen zur älteren Kölner Verfassungsgeschichte. In: ZRGG, GA 31, 1910, S. 1-67.
Dilcher, Gerhard: Bürgerrecht und Stadtverfassung im europäischen Mittel- alter. Köln/ Weimar/ Wien 1996.
Ennen, Edith: Die europäische Stadt des Mittelalters. 4. Aufl., Göttingen 1987.
dies.: Erzbischof und Stadtgemeinde in Köln bis zur Schlacht von Worringen (1288). In: Petri, Franz (Hrsg.): Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Köln/ Wien 1976 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städteforschung in Münster, Reihe A, Bd. 1), S. 27-46.
dies.: Kölner Wirtschaft im Früh- und Hochmittelalter. In: Kellenbenz, Hermann (Hrsg.): Zwei Jahrtausende Kölner Wirtschaft. Bd.1: Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Köln 1975, S. 87-199.
dies.: Europäische Züge der mittelalterlichen Kölner Stadtgeschichte. In:
Stehkämper, Hugo (Hrsg.): Köln, das Reich und Europa. Abhandlungen über weiträumige Verflechtungen der Stadt Köln in Politik, Recht und Wirtscahft im Mittelalter. Köln 1991 (= Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Heft 60), S. 1-48.
Erkens, Franz-Reiner: Sozialstruktur und Verfassungsentwicklung in der Stadt Köln während des 11. und frühen 12. Jahrhunderts. In: Jarnut, Jörg/ Peter Johannek (Hrsg.): Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert. Köln/ Weimar/ Wien 1998 (= Städteforschung, Rei- he A, Bd. 43), S. 169-192.
Jakobs, Hermann: Verfassungstopographische Studien zur Kölner Stadtge- schichte des 10. bis 12. Jahrhunderts. In: Stehkämper, Hugo (Hrsg.): Köln, das Reich und Europa, S. 49-123.
ders.: Stadtgemeinde und Bürgertum um 1100. In: Diestelkamp, Bernhard (Hrsg.): Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen. Köln/ Wien 1982 (= Städteforschung, Reihe A, Bd.11), S. 14-54.
Koebner, Richard: Die Anfänge des Gemeinwesens der Stadt Köln. Zur Entstehung und ältesten Geschichte des deutschen Städtewesens. Bonn 1922.
Lau, Friedrich: Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396. Nachdruck der Ausgabe von 1989, Amsterdam 1969.
Lewald, Ursula: Köln im Investiturstreit. In: Fleckenstein, Josef (Hrsg.): Investiturstreit und Reichsverfassung. Sigmaringen 1973 (= Vortäge und Forschungen, Bd. 17), S. 373-393.
Pirenne, Henri: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter. 7. Aufl., Tübingen/ Basel 1994.
Planitz, Hans: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. Wien/ Köln/ Graz 1973.
Schulz, Knut: „Denn sie lieben die Freiheit so sehr...“ Kommunale Auf- stände des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter. 2. Aufl., Darm- stadt 1995.
Schulze, Hans K.: Hegemoniales Kaisertum, Ottonen und Salier. 2. Aufl., Berlin 1994 (= Siedler Deutsche Geschichte, Bd. 3).
Stehkämper, Hugo: Die Stadt Köln in der Salierzeit. In: Weinfurter, Ste- fan (Hrsg.): Die Salier und das Reich. Bd. 3: Gesellschaftlicher und i- deengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier. Sigmaringen 1991, S. 75-152.
Ders.: Zur Entstehung der Kölner Stadtgemeinde. Wann und wie könnte sie im Mittelalter zustandegekommen sein? In: Schmitz, Wolfgang (Hrsg.): Jahrbuch 65 des kölnischen Geschichtsvereins.e.V.. Köln 1994, S. 1-12.
Steinbach, Franz: Zur Sozialgeschichte von Köln im Mittelalter. In: Rep- gen, Konrad/ Stephan Skalweit (Hrsg.): Spiegel der Geschichte. Festaus- gabe für Max Braubach zum 10. April 1964. Münster 1964, S. 171-197.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über die Entwicklung der Stadt Köln bis zum 12. Jahrhundert?
Dieses Dokument bietet eine detaillierte Analyse der Entwicklung der Stadt Köln bis zum 12. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf die Entstehung städtischer Selbstverwaltung. Es behandelt die Karolinger- und Ottonenzeit, die Rolle der Erzbischöfe, Stadterweiterungen, soziale Strukturen, Aufstände (insbesondere den von 1074 und 1106), die "coniuratio pro libertate", das Stadtsiegel, sowie Organe und Organisationen der Stadtgemeinde.
Wie entwickelte sich Köln in der Karolinger- und Ottonenzeit?
In der Karolingerzeit rückte Köln durch die Expansion des Frankenreiches ins Zentrum. In der Ottonenzeit stieg Köln unter Erzbischof Bruno I. zum rheinischen Oberzentrum auf, profitierend von seiner Lage an wichtigen Handelswegen und der Unterstützung durch das ottonisch-salische Reichskirchensystem. Die Herauslösung des städtischen Gerichtsbezirks war eine wichtige Voraussetzung für die Stadtherrschaft der Erzbischöfe.
Welche Rolle spielten die Erzbischöfe in der Entwicklung Kölns?
Die Erzbischöfe besaßen als Stadtherren geistliche und weltliche Gewalt. Sie erhielten Regalien vom König, übten die Hochgerichtsbarkeit aus (faktisch durch Burggrafen und Stadtvogt) und hatten finanzielle Rechte wie Zoll-, Markt- und Münzregal. Sie besetzten Ämter mit Ministerialen und zunehmend mit Bürgern, insbesondere das Schöffenamt.
Wie sah die soziale Struktur Kölns im 11. Jahrhundert aus?
Die soziale Struktur war heterogen. Es gab eine bürgerliche Führungsschicht (reiche Kaufleute, organisiert in der Kaufmannsgilde), eine Mittelschicht (Handwerker und Kleinhändler) und Unterschichten (ohne Bürgerrechte). Juden nahmen eine Sonderrolle ein.
Was war der Aufstand von 1074 und welche Konsequenzen hatte er?
Der Aufstand von 1074 war eine Revolte gegen Erzbischof Anno, ausgelöst durch die Beschlagnahme eines Schiffes. Obwohl der Aufstand scheiterte, zeigte er ein gewachsenes Selbstbewusstsein der Bürger gegenüber der Stadtherrschaft. Der Erzbischof erkannte die wirtschaftliche Bedeutung der Bürger und nahm sie wieder in die Stadt auf, wobei er sie zur Verteidigung der Stadt verpflichtete.
Was geschah im Jahr 1106 in Köln und welche Bedeutung hatte das für die Stadtgemeinde?
Im Jahr 1106 stellten sich die Kölner Bürger auf die Seite Heinrichs IV. gegen seinen Sohn Heinrich V. Sie vertrieben den Erzbischof und erhielten von Heinrich IV. die Erlaubnis zur Erweiterung der Stadtmauer. Dies stärkte die Position der Bürgerschaft als politisch und militärisch selbständig handelnde Einheit.
Was ist die "coniuratio pro libertate" und wie wird sie interpretiert?
Die "coniuratio pro libertate" wird in der Kölner Königschronik für das Jahr 1112 erwähnt. Ihre Bedeutung ist unklar und wird unterschiedlich interpretiert: als Gründungsakt der kommunalen Gemeinde, als Beitritt zu einem niederrheinischen Bündnis oder als Erneuerung des Eides von 1106.
Welche Bedeutung hatte das Stadtsiegel für die Entwicklung der Stadtgemeinde?
Das Stadtsiegel, eingeführt unter Erzbischof Friedrich I. (um 1115), war zwar kein sicheres Indiz für die vollständige Emanzipation der Stadtgemeinde, setzte aber eine organisierte Gemeinschaft voraus, in deren Namen das Siegel geführt wurde.
Welche Organe und Organisationen trugen zur Entwicklung der Stadtgemeinde bei?
Zur Entwicklung trugen die Gesamtgerichtsgemeinde, Sondergemeinden, die Kaufleute und ihre Gilde, die Oberschicht (reiche Kaufmannschaft und bischöfliche Beamte) und das Schöffenkolleg bei.
Wie sah die städtische Selbstverwaltung zu Beginn des 12. Jahrhunderts aus?
Zu Beginn des 12. Jahrhunderts existierte eine selbständig agierende Bürgerschaft, deren Selbstverwaltung aber wenig institutionalisiert war und sich über Strukturen der ‚alten' Ordnung vollzog. Das Schöffenkolleg übernahm neben gerichtlichen auch administrative Aufgaben, und die Oberschicht formierte sich als politische Führungsschicht.
Welche Quellen und Sekundärliteratur werden in dem Dokument verwendet?
Das Dokument greift auf verschiedene Quellen zurück, darunter die Annalen Lamperts von Hersfeld, die Annales Hildesheimenses und die Vita Heinrici IV Imperatoris. Es werden auch zahlreiche Werke der Sekundärliteratur zitiert, die sich mit der Kölner Stadtgeschichte und dem Städtewesen im Mittelalter befassen.
- Quote paper
- Svenja Kunze (Author), 2000, Enstehung der Städtischen Selbstverwaltung in Köln im 11./12. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96705