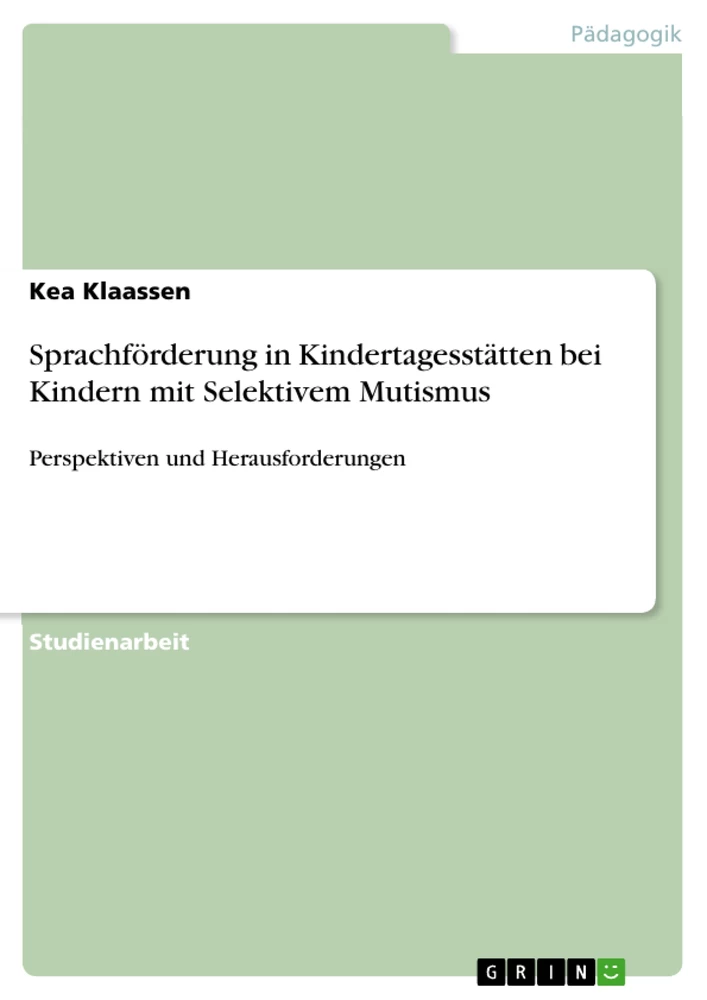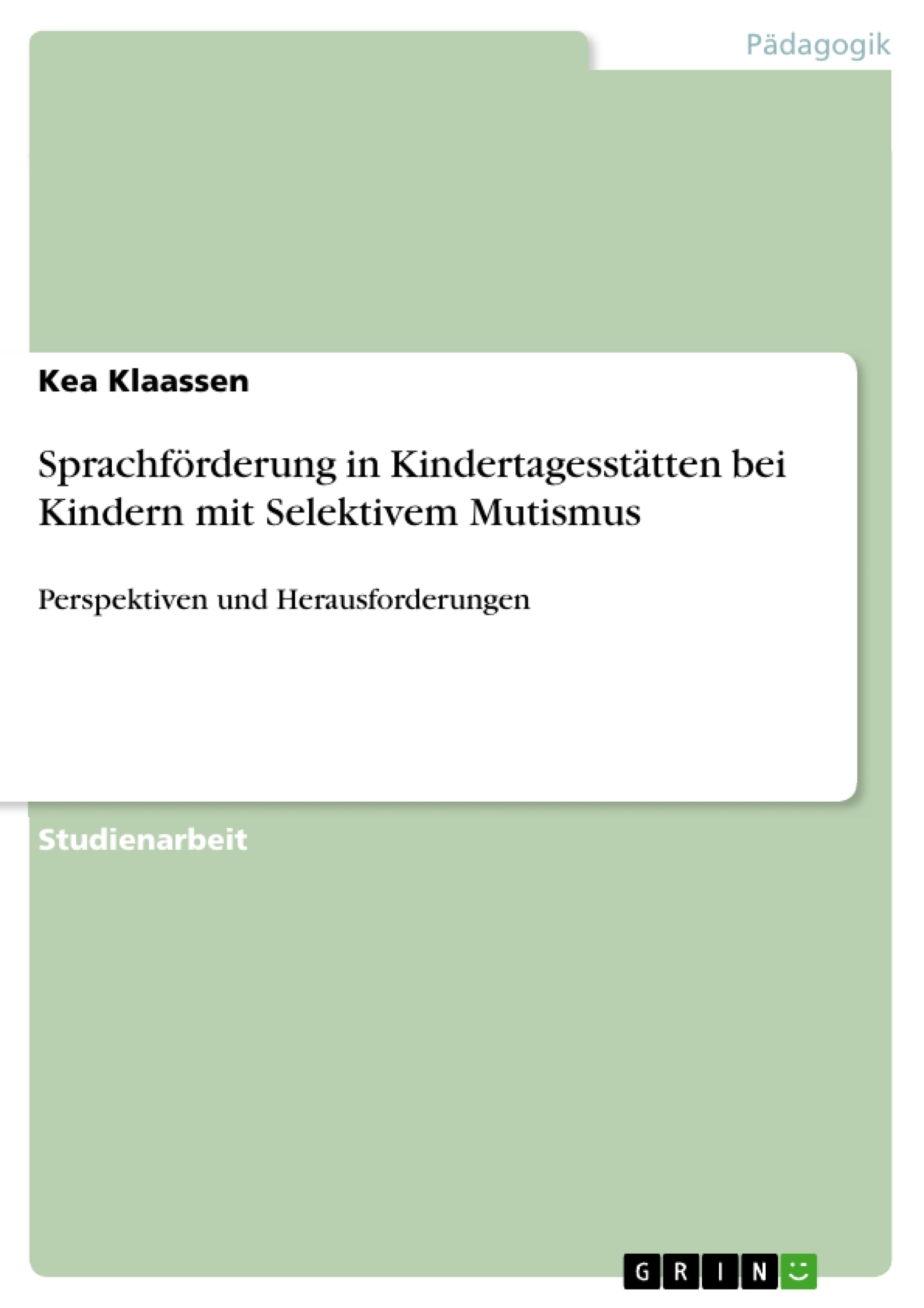In der Arbeit soll mithilfe der Anwendung der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller auf ein Fallbeispiel aus der Praxis und folgende Fragen eingegangen werden: Welche Perspektiven und Herausforderungen bringt das Störungsbild Selektiver Mutismus bei Kindern in Bezug auf Sprachförderung in Kindertagesstätten mit sich? Ist eine Sprachförderung überhaupt möglich und wenn ja worauf muss die Fachkraft achten in der Zusammenarbeit mit dem Kind?
Anhand der Stärken und Schwächen des Mädchens sollen mögliche Perspektiven und Herausforderungen einer Sprachförderung bei Kindern mit selektivem Mutismus herausgearbeitet werden. Um einen Überblick über das benannte Störungsbild zu erhalten, werden in Kapitel 2 zunächst wichtige Informationen zum Selektiven Mutismus thematisiert. Dazu wird dieser in Kapitel 2.1 definiert und die verschiedenen Formen des Mutismus beschrieben. In Kapitel 2.2 folgt eine Darstellung der Symptomatik und möglicher Ursachen und in Kapitel 2.3 wird die Diagnose des Selektiven Mutismus erläutert. Mögliche Therapiemaßnahmen werden in Kapitel 2.4 vor Augen geführt.
Im nächsten Kapitel (Kapitel 3) soll der Begriff Sprachförderung bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren im Mittelpunkt stehen, da dieser für den Verlauf der Hausarbeit von Bedeutung ist. Dazu wird in Kapitel 3.1 eine Übersicht zu Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen gegeben. Nachfolgend wird in Kapitel 3.2 die Beobachtung und Dokumentation als Grundlage zur Sprachförderung erläutert. Das Fallbeispiel wird in Kapitel 4 aufgegriffen. Hier werden zunächst in Kapitel 4.1 allgemeine Informationen über das Mädchen Laura, welches unter selektivem Mutismus leidet, aufgezeigt und anschließend werden die Anwendung und die Ergebnisse der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller erklärt. Im Fazit in Kapitel 5 wird abschließend auf die oben benannte Fragestellung dieser Arbeit eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selektiver Mutismus
- Definition und Formen
- Symptomatik und mögliche Ursachen
- Diagnose
- Therapiemaßnahmen
- Sprachförderung bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren
- Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
- Beobachtung und Dokumentation als Grundlage zur Sprachförderung
- Fallbeispiel „Laura“
- Allgemeine Informationen über das Mädchen Laura
- Anwendung und Ergebnisse der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Störungsbild des Selektiven Mutismus bei Kindern im Kindergartenalter und seinen Auswirkungen auf Sprachförderung. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die dieses Störungsbild für die pädagogische Praxis mit sich bringt, und untersucht, ob und unter welchen Bedingungen Sprachförderung bei Kindern mit selektivem Mutismus möglich ist. Die Arbeit stützt sich dabei auf ein Fallbeispiel aus der Praxis.
- Definition und Formen des Selektiven Mutismus
- Symptome, mögliche Ursachen und Diagnose des Selektiven Mutismus
- Bedeutung von Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
- Herausforderungen und Perspektiven der Sprachförderung bei Kindern mit selektivem Mutismus
- Anwendung der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller im Fallbeispiel „Laura“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet das Störungsbild des Selektiven Mutismus. Es werden Definition, Formen und Symptomatik des Störungsbildes, sowie mögliche Ursachen und die Diagnostik erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Therapiemaßnahmen vorgestellt.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der Sprachförderung im Kindergartenalter betrachtet. Es werden die verschiedenen Aspekte der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, sowie die Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation als Grundlage für die Sprachförderung behandelt.
Kapitel drei stellt das Fallbeispiel „Laura“ vor. Es werden allgemeine Informationen über das Mädchen Laura, das unter selektivem Mutismus leidet, sowie die Ergebnisse der Anwendung der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller präsentiert.
Schlüsselwörter
Selektiver Mutismus, Sprachförderung, Kindertageseinrichtungen, Entwicklungstabelle nach Kuno Beller, Fallbeispiel, Beobachtung, Dokumentation, Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, Sprachentwicklung, Sprachbildung.
- Arbeit zitieren
- Kea Klaassen (Autor:in), 2020, Sprachförderung in Kindertagesstätten bei Kindern mit Selektivem Mutismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/963260