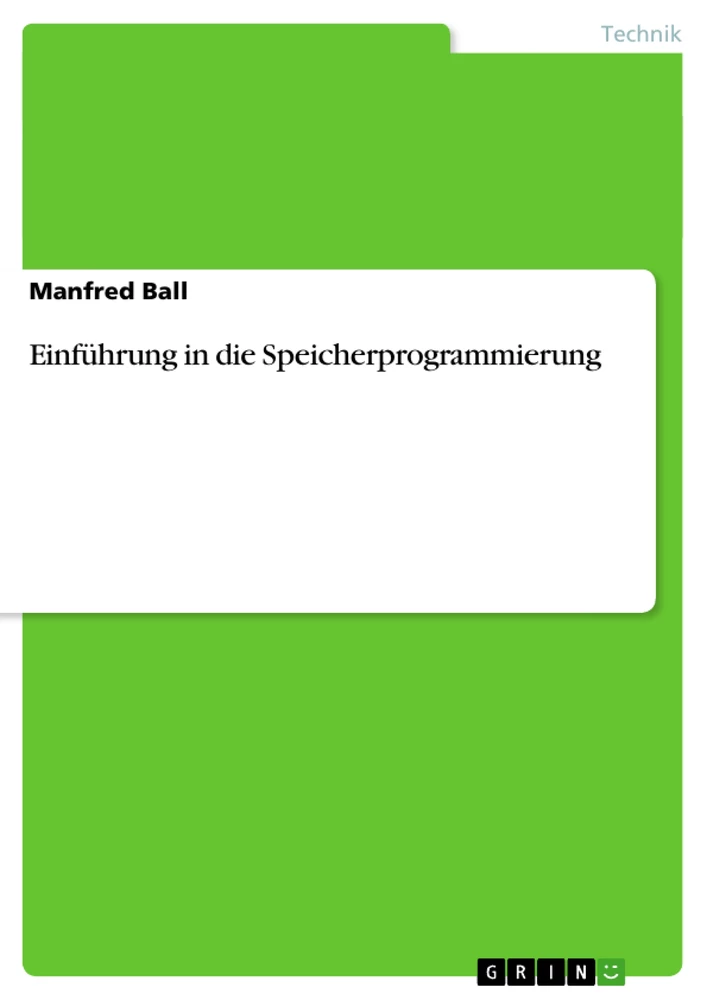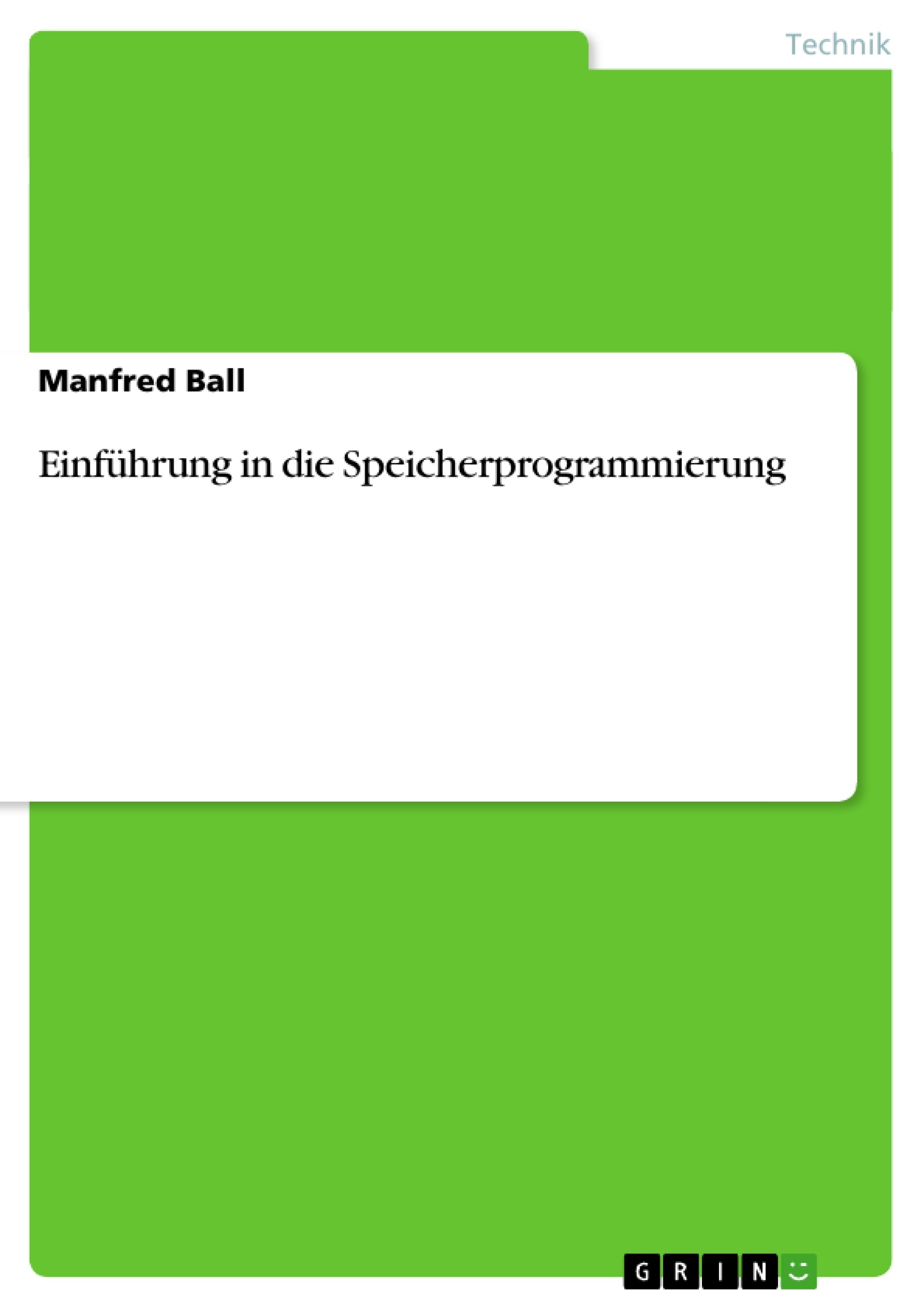Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Maschinen nicht nur Befehle ausführen, sondern intelligent auf ihre Umgebung reagieren und sich dynamisch an veränderte Bedingungen anpassen können. Diese Vision wird durch die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Realität. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der SPS-Technik, ein unverzichtbares Werkzeug für die Automatisierungstechnik und industrielle Steuerung. Dieses Buch bietet eine leicht verständliche Einführung in die Grundlagen der SPS, ideal für Einsteiger und all jene, die ihr Wissen in diesem Bereich erweitern möchten. Von den elementaren Prinzipien und dem Aufbau einer SPS über die verschiedenen Darstellungsarten von Programmen (Kontaktplan, Funktionsplan, Anwendungsliste) bis hin zu komplexen logischen Verknüpfungen und praktischen Programmbeispielen – hier finden Sie alles, was Sie für den erfolgreichen Einstieg in die SPS-Programmierung benötigen. Lernen Sie, wie Sie mit STEP 5 (Siemens AG-100 U) logische Schaltungen realisieren, UND-, ODER- und Negationsverknüpfungen erstellen und zusammensetzte Funktionen meistern. Entdecken Sie die Bedeutung von Merkern und Speichergliedern (Flipflops) für die Zwischenspeicherung und Verarbeitung von Informationen. Anhand eines detaillierten Programmbeispiels zur Steuerung eines Schiebetors in einer Werkhalle wird die praktische Anwendung der erlernten Konzepte veranschaulicht. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zum Verständnis und zur Beherrschung der SPS-Technologie, die in unzähligen Anwendungen von der einfachen Ampelsteuerung bis zur komplexen Robotik zum Einsatz kommt. Erschließen Sie sich die Welt der Automatisierung und gestalten Sie die Zukunft der Industrie mit! Keywords: SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung, Automatisierungstechnik, industrielle Steuerung, Programmierung, STEP 5, Siemens, Kontaktplan, Funktionsplan, Anwendungsliste, Logische Verknüpfungen, Merker, Speicherglieder, Flipflops, Schiebetorsteuerung, Automatisierung, Technik, Industrie 4.0, SPS-Programmierung, Steuerungstechnik, digitale Schaltungstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Ingenieurwesen, Ausbildung, Studium, Weiterbildung, Automatisierungslösungen, Prozesssteuerung, Fertigungsautomatisierung, Anwendungsbeispiele, praxisorientiert, leicht verständlich, Einsteiger, Fortgeschrittene, Automatisierungssysteme, SPS-Anlagen, digitale Steuerung, industrielle Prozesse, Automatisierungstechnik lernen, SPS-Kurs, Automatisierungstechnik Studium, SPS-Techniker, Automatisierungstechnik Ingenieur, speicherprogrammierbare Steuerungen, Automatisierungstechnik Kurse, SPS Grundlagen, SPS Programmierung lernen, SPS Beispiele, industrielle Automatisierung, Automatisierungstechnik Jobs, speicherprogrammierbare Steuerung Grundlagen, Automatisierungstechnik Weiterbildung.
Einige Worte zum Referat:
Das Referat habe ich irgendwann 1996 gehalten und sollte einen kurze Einführung in die SPS darstellen, also hauptsächlich ist es für Laien bestimmt. Das vorhandene Word-Dokument ist zwar etwas chaotisch, da ich zu jener Zeit noch keine Ahnung von Formatierung hatte, doch mit etwas Arbeit läßt es sich besser ausarbeiten. Ich habe versucht das Referat möglichst praxisorientiert zu gestalten, also mit Anwendungsbeispielen. Ab Seite 16 sind Folienvorlagen zu finden, d.h. hier könnt ihr mit den jeweiligen Ausdrücken Folien herstellen. Das Referat kam übrigens ganz gut an.
1. Einführung
Die Speicherprogrammierbare Steuerung, kurz SPS, soll die konventionelle, kontaktbehaftete Schütz- und Relaissteuerung ersetzen. Hierbei wird mit einer geringen Steuerspannung/strom (z.B. 24 Volt/7mA) ein Relais betätigt, welches wiederum eine hohen Leistungsspannung/ strom (z.B. 380 Volt) zu einem Aktor (z.B. Werkzeugmaschine) durchschaltet. Die logischen Bedingungen und Verknüpfungen werden bei der SPS durch ein Programm realisiert. Die konventionelle Verbindungsorientierte Steuerung (VPS) besteht aus einer festen Verdrahtung und logischen Bauelementen, die die jeweiligen Schütze- und Relaisschaltungen, nach bestimmten logischen oder zeitlichen Bedingungen an- oder ausschalten. Bei einer Ampelschaltung wird zum Beispiel jede 5 Minuten eine Lampe eingeschaltet und nach zwei Minuten ausgeschaltet. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig und wird durch zeitliche logische Verknüpfungen ermöglicht. Eine Werkzeugmaschine kann wiederum durch direkte logische Eingangsbedingungen, beispielsweise durch die Betätigung mehrerer Schalter, Taster oder Geber (Lichtschranke, Temperaturfühler), ein- und ausgeschaltet werden. Hier handelt es sich um rein logische Bedingungen.
Wird der Fertigungsablauf geändert, beispielsweise durch Herstellung eines anderen Produktes, so muß auch der Steuerungsablauf geändert werden. Bei der VPS erfolgt die Änderung manuell, d.h. die Verdrahtung muß gelöst, geändert und neu verdrahtet werden.
Dies ist verbunden mit hohen Kosten- und Zeitaufwand, somit findet die VPS heute meist nur noch Verwendung in Steuerungsabläufen, die nicht mehr verändert werden. Die SPS hat hier ihren großen Vorzug, da bei Änderungen der Steuerungsabläufe, nur das Programm der SPS geändert werden muß. Das Programm kann außerhalb der ,,laufenden"
SPS Anlage geschrieben und mit Hilfe von PC auch simuliert werden. Danach wird bei erfolgreiche Abnahme des Programms, das geprüfte Programm innerhalb von wenigen
Sekunden in die SPS Anlage eingespeist und ist sofort lauffähig. Weiterhin ist die SPS im Gegensatz zur VPS platzsparend und verschleißfrei, da sie ohne Verdrahtung (Widerstände) und somit nicht wärmearbeitend funktioniert.
2. Aufbau und Arbeitsweise einer SPS
2.1 Prinzipieller Aufbau einer SPS
Die SPS arbeitet mit einer Gleichspannung von 24 Volt und einen Strom 7 mA. Der logische Zustand an den Ein- und Ausgängen wird ebenfalls mit diesem Spannungspegel dargestellt. Hierbei beträgt +24 Volt der logischen 1 und 0 Volt der logischen 0. Das gesamte System ist modulmäßig aufgebaut, so daß die jeweilige Anwendung optimal angepaßt werden kann.
Jedes System hat in der Grundausstattung eine Zentraleinheit, auch Central Processing Unit (CPU) genannt. Diese Zentraleinheit findet man auch in normalen PC´s und stellt die eigentliche Verarbeitunsebene der SPS, da hier die Eingänge logisch verarbeitet werden und das Ergebnis der Ausgabeebene zugefügt wird. Diese Arbeitsweise ist die Grundlage einer jeden EDV-Anlage und wird als EVA-Prinzip bezeichnet, eben wegen Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.
2.2 Aufbau der Module der SPS
Die Eingabeebene wird durch einzelne Module zusammen gestellt. Jedes Modul hat 8 Eingänge, wobei jeder Eingang digital, also mit ,,0" oder ,,1" belegt werden kann. Es besteht auch die Möglichkeit einer analogen Eingabe, indem die 8 Eingänge mit 8 bit gleich zu setzen sind. Mit 8 bit lassen sich nun Zahlen im Binärcode bis zu 28 darstellen, also können Zahlen von 0 bis 256 verarbeitet werden. Mehrere Module nebeneinander vergrößern den Zahlenbereich ( 2 Module = 16 bit = 216 Möglichkeiten = Zahlen von 0 bis 65536). Das gleiche gilt natürlich auch für die Darstellung von analogen Werten in den Ausgabemodulen. Die Beschreibung eines Ein- oder Ausganges wird durch die Anfangsbuchstaben A (Ausgang) oder E (Eingang) und 2 nachfolgenden Zahlen, die durch einen Punkt getrennt sind, angegeben. Die erste Zahl gibt Auskunft über das Modul und die zweite welcher Ein- oder Ausgang betroffen ist.
Zwei Beispiele:
A 2.0 bedeutet Ausgang 0 am Ausgangsmodul 2 E 1.3 bedeutet Eingang 3 am Eingangsmodul 1
Allgemein:
Z x.y wobei Z = E oder A für Ein- oder Ausgang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Ausgangsmodule sind genauso aufgebaut wie die Eingangsmodule. Bei der SPS Anlage von Siemens (AG-100 U , älteres Modell !), können bis maximal 32 Baugruppenmodule betrieben werden, also 16 Eingabemodule und 16 Ausgabemodule oder auch 31 Eingabemodule und 1 Ausgabemodul, eben je nach Verwendung.
Um die erstellten Programme testen zu können, ist das System mit einer Simuliereinrichtung ausgestattet. Die Mikroschalter unter den Eingabemodulen bewirken lediglich, daß die zugehörigen Eingänge auf +24 (logisch 1) oder 0 V (logisch 0) geschaltet werden. Ebenfalls sind Buchsen neben den Eingängen vorhanden, an denen Modelle (z.B. Fischertechnik) angeschlossen werden können, um die Programm im Echtzeitbetrieb testen zu können. Ein- und Ausgänge dieser Art befinden sich natürlich auch in den Ausgabemodulen, wobei hier die eben genannten Modelle ( z.B. kleiner Elektromotor) angeschlossen werden.
2.3 Arbeitsweise der CPU einer SPS
PAE - Speicher Eingänge
1. Befehl
2. Befehl PAA wird geladen ...u.s.w
BE (Bausteinende)
PAA - Speicher Ausgänge
Jedes SPS Programm wird zeilenweise bzw. sequentiell abgearbeitet. Bevor die CPU anfängt jede Befehlszeile der Reihe nach abzuarbeiten, müssen sämtliche Eingangsgrößen, also die logischen Zustände an jedem Eingang, erfasst werden. Dies erfolgt vor der Abarbeitung des
Programms. Hierbei wird der Zustand eines jeden Eingangs festgestellt und anschließend im Prozeßabbild (PAE) der Eingänge gespeichert. Es wird also nicht während der
Programmbearbeitung der jeweilige Eingangszustand abgefragt, sondern immer der Zustand, der aus dem PAE bekannt ist, verarbeitet. Wird also während eines Programmzyklus, also der Zeitraum in dem die CPU das Programm einmal abarbeitet, ein Eingang verändert, so wird diese Änderung nicht berücksichtigt. Erst beim nachfolgenden Programmzyklus und der neu aktualisierten PAE wird die Änderung erkannt. Man muß allerdings daran denken, das die Abarbeitung eines Zyklus, je nach Programmgröße, in Millisekunden verläuft, so daß eine scheinbar direkte Antwort auf jede Änderung erfolgt. Nachdem das Programm abgearbeitet wurde, werden nun alle End- und Zwischenergebnisse der Bearbeitung im Prozeßabbild der Ausgänge (PAA) gespeichert und erst dann den jeweiligen Ausgängen zugeführt. Dies ist besonders zu erwähnen, da auch Ausgänge abgefragt und mit in logischen Verknüpfungen eingehen können. Die Abarbeitung erfolgt also in drei wesentlichen Schritten, wie in Bild 2.2 erkennbar.
3. Programmierung von SPS
3.1 Darstellungsarten von Programmen in der SPS
In der SPS gibt es drei verschiedene Darstellungsarten, um die Funktion, Ablauf und Struktur einer SPS Steuerung zu verdeutlichen.
Der Kontaktplan ergibt sich aus der herkömmlichen Steuerungstechnik und entspricht praktisch dem Schaltplan. Der Kontaktplan wird von recht nach links gezeichnet, anstatt wie beim herkömmlichen Schaltplan, von oben nach unten.
In Bild 3.1 wird eine UND-Vernüpfung aus E 0.0 und E 0.1 dargestellt, wobei E 0.0 ein Schließer und E 0.1 ein Öffner ist. Das Ergebnis wird dem Ausgang A 2.0 zugewiesen.
E 0.0 E 0.1 A 2.0
Bild 3.1: Der Kontaktplan einer UND-Verknüpfung
Während der Kontaktplan die Struktur eines Programms bildlich darstellt, wird mit dem Funktionsplandie Symbolik der Digitaltechnik verwendet, um die Funktion des Programms, durch eine bildliche Schaltung zu erklären. Es ist somit möglich, jedes Programm durch Elemente aus der Digitaltechnik (UND, ODER, FLIP-FLOP etc.), schaltungstechnisch zu realisieren und auf Platine zu fassen. Es wurde die gleiche UND-Vernüpfung (wie zuvor im Kontaktplan) zu Darstellung des Funktionsplan gewählt.
Bild 3.2: Funktionsplan einer UND-Verknüpfung
Zu guter letzt wird die eigentliche Programmiersprache der SPS, die bei der Firma Siemens als STEP 5 bezeichnet wird, zur Darstellung herangezogen. Sie wird gewöhnlich als Anwendungsliste (AWL) bezeichnet, da hier alle Anwendungen des Programms der Reihe nach aufgeführt wird. Für den Digitaltechniker oder den Elektrofachmann ist diese Art der Darstellung sehr gewöhnungsbedürftig, da sie wenig Aufschluß über Struktur und Funktion gibt. Sie ist aber für die SPS die einfachste Art der Programmierung und somit auch einfach der Anlage bzw. der CPU zu vermitteln, da sie den niedrigen Programmsprachen wie Assembler ähnelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Bild 3.3 ist die schon bekannte UND-Verknüpfung, die wir aus den vorangegangenen Kontakt- und Funktionsplan kennen, als AWL aufgeführt.
Bild 3.3: Anwendungsliste einer UND-Verknüpfung
3.2 Logische Verknüpfungen und Programmbeispiele der SPS
Jede beliebige Schaltung aus der Digitaltechnik kann also mit der Programmiersprache der SPS realisiert werden. Wie in allen Programmiersprachen verfügt z.B. Step 5 (SPS Siemens AG-100 U ) über einen logischen Befehlssatz. Dieser Befehlscode ist nach logischen Verbindungen strukturiert, wie man es aus der digitalen Schaltungstechnik her kennt und wie sie auch in höheren Programmiersprachen (Pascal, Fotran, Basic) u.s.w. verwendet werden. Um die Gemeinsamkeiten zwischen des Befehlssatz von Step 5 und anderen höheren Programmiersprachen darzustellen, habe ich neben einer logischen Grundverknüpfung von Step 5 quasi als Übersetzung in eine/die höhere Programmiersprache BASIC, den entsprechenden Basic-Code aufgeschrieben.
3.2.1 Die UND-Verknüpfung
AWL FUP BASIC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die UND-Verknüpfung wird bei höheren Programmiersprachen meist anders strukturiert, da oft nur geprüft wird, ob bestimmte Variablen die geeigneten Werte haben, um dann eine bestimmte Funktion ausführen zu können. Hier gibt es das Befehlswort ,,AND". Die Funktion AND ermöglicht beliebige Werte, also nicht nur ,,0" und ,,1" zu verknüpfen, z.B.: If x = 10 AND y = -4 Then ...
If vor$ = Willi AND nach$ = Bruns Then WIN else Print "Passwort falsch". u.s.w.
Die konstruierte Schleife für die UND-Verknüpfung im Basic-Code, entspricht logisch einer Reihenschaltung und verdeutlich daher die Funktion der UND-Verknüpfung am realsten. Das gleiche gilt für die nachfolgenden Programmierbeispielen im Basic-Code.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2.2 Die ODER-Verknüpfung
3.2.2 Die Negation
AWL FUP BASIC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Negation ist selbstverständlich für ODER-Verknüpfungen genauso möglich. Es gibt noch eine weitere Vielzahl an logischen Grundoperationen wie NOR, XOR u.s.w. Sie setzen sich aber im wesentlichen aus den Grundoperationen UND, ODER und NEGATION zusammen und sind für das Verstehen von Step 5 nicht unbedingt nötig.
Die Negation ist immer schwer vorstellbar. Das liegt vielleicht daran, daß die Nichtbetätigung eines Schalters ( also eigentlich nichts tun) irgendetwas auslöst oder zumindest daran beteiligt ist. Es gilt also grundsätzlich für einen negierten Schalter z.B. E 0.0
Stellung Zustand
EIN 0
AUS 1
3.2.3 Zusammengestzte Funktionen
Mit den vorangehend besprochenen logischen Grundfunktionen können nun eine Vielzahl von zusammengesetzten Funktionen komponiert werden. Bei der Darstellung in der AWL müssen aber bestimmte Regeln beachtet werden. Ist die zusammengesetzte Funktion eine UND-vor- ODER Funktion ( siehe Bild 3.4), d.h. zwei UND-Glieder werden mit ODER verknüpft, so kann die Struktur einfach in den AWL-Code übertragen werden. Das liegt daran, daß die
UND-Vernüpfung immer Vorrang vor der ODER-Verknüpfung hat. Bei der Eingabe in den
AWL-Code kann somit gar nichts falsch gemacht werden. Liegt eine ODER-vor-UND
Funktion vor( siehe Bild 3.5), so muß mit Hilfe von Klammern die ODER-Verknüpfung isoliert werden, um diese Funktion als eigenständige und selbständige Funktion zu definieren. Hierbei wird ein vorrangiges UND-Verknüpfen vermieden. Als Denkhilfe sollte der Vergleich zur Mathematik helfen, in der die einfache Rechenregel PUNKT-vor-STRICH gleich zu setzen ist mit UND-vor-ODER in der SPS. Sollte nun ODER vor UND berechnet bzw. verarbeitet werden, so muß dies durch Klammersetzung geschehen.
UND-vor-ODER Funktion
AWL FUP
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3.4: UND-vor-ODER Verknüpfung ODER-vor-UND Funktion
AWL FUP
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3.4: ODER-vor-UND Verknüpfung
3.3 Ein Programmbeispiel
In einer Werkhalle ist ein neues Schiebetor eingebaut worden. Die Bewegung des Tores nach links und rechts erfolgt durch Umschalten der Drehrichtung eines Elektromotors. Durch zwei Taster soll es möglich sein, das Tor nach links oder recht zu fahren. In der Torebene soll zusätzlich eine Lichtschranke als Sicherung eingebaut werden, um zu vermeiden, daß Per- sonen oder Gegenstände sich während der Bewegung des Tores im Torbereich aufhalten. Zusätzlich soll der Motor ein- und ausschaltbar sein und die Torendpunkte mit Tastern versehen werden, um bei Erreichen des Endpunktes, automatisch abzuschalten.
1.Schritt: Skizze
Torsteuerung Anschlagtaster (G2) Anschlagtaster (G1)
Dach
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Schritt: Belegung von Schaltern und Gebern Eingänge:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Schritt AWL mit Kommentar
AWL Kommentar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Weitere Funktionen in der SPS
4.1 Der Merker
Merker dienen zur Bildung von Zwischenergebnissen. Diese werden von der SPS zwischengespeichert und wirken nicht direkt auf die Ausgänge. Sie können umfangreiche Verknüpfungen wesentlich vereinfachen und dienen zur Übermittlung zwischen verschiedenen Bausteinen.
Merker werden behandelt wie Ausgänge, nur daß ihr Informationsgehalt nicht zur Ausgabe gelangt, sondern intern im Speicher abgelegt wird. Die SPS AG 100 U (Siemens) kann 128 *
8 Merker verwalten. Man kann sich die ansprechbaren Merker wie eine Tabelle vorstellen, die 0-127 Zeilen und 0-7 Spalten hat. Die Merker von 0-63 sind remanent, d.h. sie speichern ihren Inhalt auch bei Stromausfall oder Betätigung der STOP-Taste, also wenn die Anlage ausgeschaltet ist. Die Merker mit den Zeilen 64-127 sind nicht remanent d.h. sie verlieren ihren Inhalt bei Betätigung der STOP-Taste.
Bei der Torsteuerung kann man beispielsweise das Ergebnis von den Schaltern E 0.3 (Motor ein) und Lichtschranke E 0.4 in einem Merker zusammenfassen, da diese UND-Verknüpfung die Voraussetzung zur Betätigung des Elektromotors ist. Die AWL würde nun folgendermaßen aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Beispiel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Das Speicherglied
In der SPS gibt es auch die Möglichkeit einen Ausgang oder Merker zu setzen, d.h. den logischen Zustand auf ,,1" zu schalten. Dies geschieht mit Hilfe eines Speichergliedes (Flipflop) mit dem man die Operation ,,Setzen , sowie auch ,,Rücksetzen" (auf logisch Null) durchführen kann. Ein Ausgang X. Y bleibt nun solange gesetzt (logisch ,,1") bis er wieder zurückgesetzt (logisch ,,0") wird. Der S-Befehl( Setzen) sowie auch der R-Befehl (Rücksetzen) werden nur ausgeführt, wenn das Verknüpfungsergebnis (VKE) auf 1 ist. z.B.
AWL Kommentar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für das Setzen bzw. Rücksetzen reicht also nur ein kurzer Impuls (z.B. E0.0 kurz ein und wieder ausschalten), um die Ausgänge oder Merker zu setzen.
Sind beide Schalter für Setzen und Rücksetzen auf logisch ,,1", so wird der jeweilige Ausgang (oder Merker) gesetzt und infolge der sequentiellen Abarbeitung gleich wieder zurückgesetzt. Hierdurch wird die Operation ,,Rücksetzen" dominant. Durch Vertauschen der Reihenfolge von Setzen und Rücksetzen in der AWL, kann man auch das Setzen dominant machen, d.h. jene Operation die zum Schluß bzw. zuletzt in der AWL steht, ist auch dominant.
AWL FUP Stromlaufplan FLIP-FLOP
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 4.1: Das Speichergleid in der SPS
Folienanfang
1.1 Prinzipieller Aufbau einer SPS
Die SPS arbeitet mit einer Gleichspannung von 24 Volt und einen Strom 7 mA.
1.2 Aufbau der Module der SPS
Eine SPS besteht aus Eingabe- und Ausgabemodulen. Hieraus ergibt sich eine spezielle Schreibweise für alle Ein- und Ausgänge in den einzelnen Modulen der SPS.
Zwei Beispiele:
A 2.0 bedeutet Ausgang 0 am Ausgangsmodul 2 E
1.3 bedeutet Eingang 3 am Eingangsmodul 1
Allgemein:
Z x.y wobei Z = E oder A für Ein- oder Ausgang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1 Arbeitsweise der CPU einer SPS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3 Darstellungsarten von Programmen in der SPS
3.1 Der Kontaktplan
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Der Funktionsplan
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3 Die Anwendungsliste(AWL)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4 Logische Verknüpfungen und Programmbeispiele der SPS
4.1 Die UND-Vernüpfung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1 Die ODER-Verknüpfung AWL FUP BASIC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Die Negation
5. Zusammengesetzte Funktionen
5.1 Und-vor-Oder Verknüpfung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2 ODER-vor-UND Verknüpfung ODER-vor-UND Funktion AWL FUP
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Ein Programmbeispiel
In einer Werkhalle ist ein neues Schiebetor eingebaut worden. Die Bewegung des Tores nach links und rechts erfolgt durch Umschalten der Drehrichtung eines Elektromotors. Durch zwei Taster soll es möglich sein, das Tor nach links oder recht zu fahren. In der Torebene soll zusätzlich eine Lichtschranke als Sicherung eingebaut werden, um zu vermeiden, daß Per- sonen oder Gegenstände sich während der Bewegung des Tores im Torbereich aufhalten. Zusätzlich soll der Motor ein-und ausschaltbar sein und die Torendpunkte mit Tastern versehen werden, um bei Erreichen des Endpunktes, automatisch abzuschalten.
1.Schritt: Skizze
Torsteuerung Anschlagtaster (G2)
Anschlagtaster (G1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gebäude(hellgrau) Tor(grau) Lichtschranke L1
2. Schritt: Belegung von Schaltern und Gebern Eingänge:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausgänge:
Motor Links = A 2.1 Motor Rechts = A 2.2
3. Schritt AWL mit Kommentar AWL Kommetar
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein Referat über Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), das 1996 für Laien gehalten wurde. Es bietet eine Einführung in die SPS-Technologie, ihre Funktionsweise und Programmierung, wobei der Schwerpunkt auf praktischen Anwendungsbeispielen liegt.
Was ist eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)?
Eine SPS ist ein digitales elektronisches Gerät, das verwendet wird, um Automatisierungsprozesse in der Industrie zu steuern. Sie ersetzt herkömmliche Schütz- und Relaissteuerungen durch ein Programm, das logische Bedingungen und Verknüpfungen realisiert.
Wie funktioniert eine SPS?
Eine SPS arbeitet nach dem EVA-Prinzip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe). Sie erfasst Eingangsgrößen, verarbeitet diese gemäß einem Programm und gibt entsprechende Ausgangssignale aus.
Wie ist eine SPS aufgebaut?
Eine SPS besteht typischerweise aus einer Zentraleinheit (CPU), Eingabemodulen, Ausgabemodulen und einer Stromversorgung. Die Module sind modular aufgebaut, um sich optimal an die jeweilige Anwendung anpassen zu können.
Wie werden Ein- und Ausgänge in einer SPS adressiert?
Ein- und Ausgänge werden durch Buchstaben (E für Eingang, A für Ausgang) und zwei Zahlen, getrennt durch einen Punkt, adressiert. Die erste Zahl gibt das Modul an, die zweite den jeweiligen Ein- oder Ausgang (z.B. E 1.3 für Eingang 3 am Eingangsmodul 1).
Welche Programmiersprachen werden für SPS verwendet?
Für SPS gibt es verschiedene Darstellungsarten von Programmen, darunter der Kontaktplan (KOP), der Funktionsplan (FUP) und die Anweisungsliste (AWL) bzw. Anwendungsliste, wie sie bei Siemens als STEP 5 bezeichnet wird.
Was ist der Unterschied zwischen Kontaktplan (KOP), Funktionsplan (FUP) und Anweisungsliste (AWL)?
Der Kontaktplan (KOP) entspricht einem Schaltplan und stellt die Struktur des Programms bildlich dar. Der Funktionsplan (FUP) verwendet Symbole der Digitaltechnik, um die Funktion des Programms zu erklären. Die Anweisungsliste (AWL) ist die eigentliche Programmiersprache der SPS und listet alle Anwendungen des Programms der Reihe nach auf.
Welche logischen Verknüpfungen werden in der SPS-Programmierung verwendet?
In der SPS-Programmierung werden die logischen Grundverknüpfungen UND, ODER und NEGATION verwendet. Diese können zu komplexeren Funktionen kombiniert werden.
Was sind Merker in der SPS?
Merker dienen zur Bildung von Zwischenergebnissen und zur Übermittlung zwischen verschiedenen Bausteinen. Sie werden wie Ausgänge behandelt, ihr Informationsgehalt gelangt jedoch nicht zur direkten Ausgabe, sondern wird intern gespeichert.
Was ist ein Speicherglied (Flip-Flop) in der SPS?
Ein Speicherglied (Flip-Flop) ermöglicht das Setzen (S) und Rücksetzen (R) eines Ausgangs oder Merkers. Der Zustand bleibt so lange erhalten, bis er durch die entsprechende Operation geändert wird.
Was sind remanente Merker?
Remanente Merker speichern ihren Inhalt auch bei Stromausfall oder Betätigung der STOP-Taste, also wenn die Anlage ausgeschaltet ist. Nicht-remanente Merker verlieren ihren Inhalt in diesen Fällen.
Wie wird eine UND-vor-ODER-Funktion in AWL dargestellt?
Da die UND-Verknüpfung Vorrang vor der ODER-Verknüpfung hat, kann die Struktur einfach in den AWL-Code übertragen werden, ohne Klammern verwenden zu müssen.
Wie wird eine ODER-vor-UND-Funktion in AWL dargestellt?
Bei einer ODER-vor-UND-Funktion muss die ODER-Verknüpfung durch Klammern isoliert werden, um sie als eigenständige Funktion zu definieren und ein vorrangiges UND-Verknüpfen zu verhindern.
- Quote paper
- Manfred Ball (Author), 1996, Einführung in die Speicherprogrammierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96300