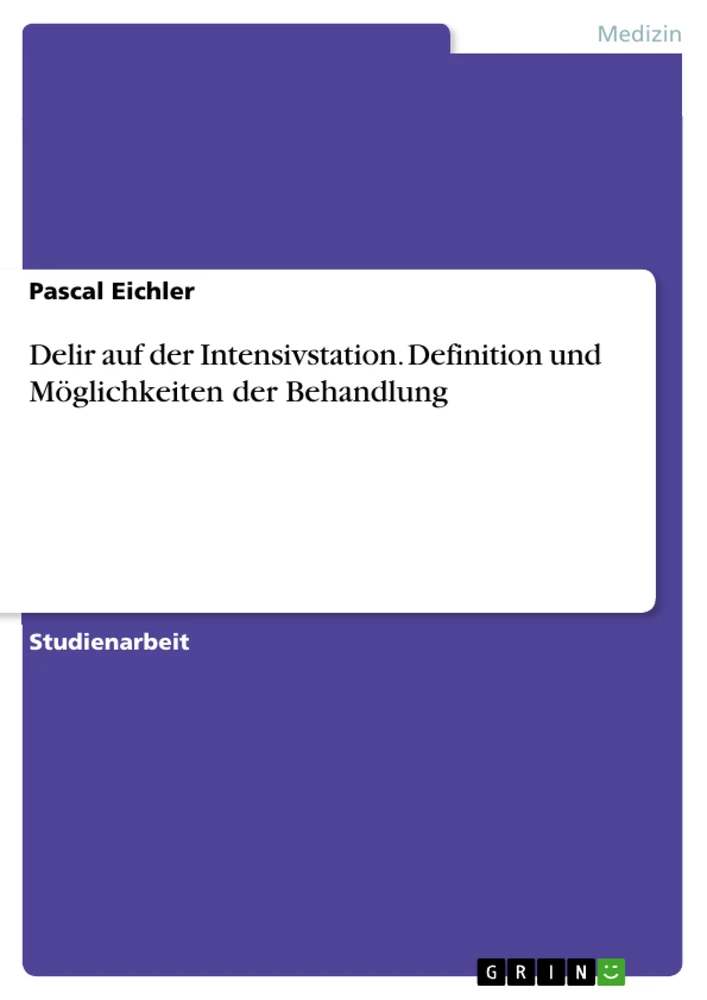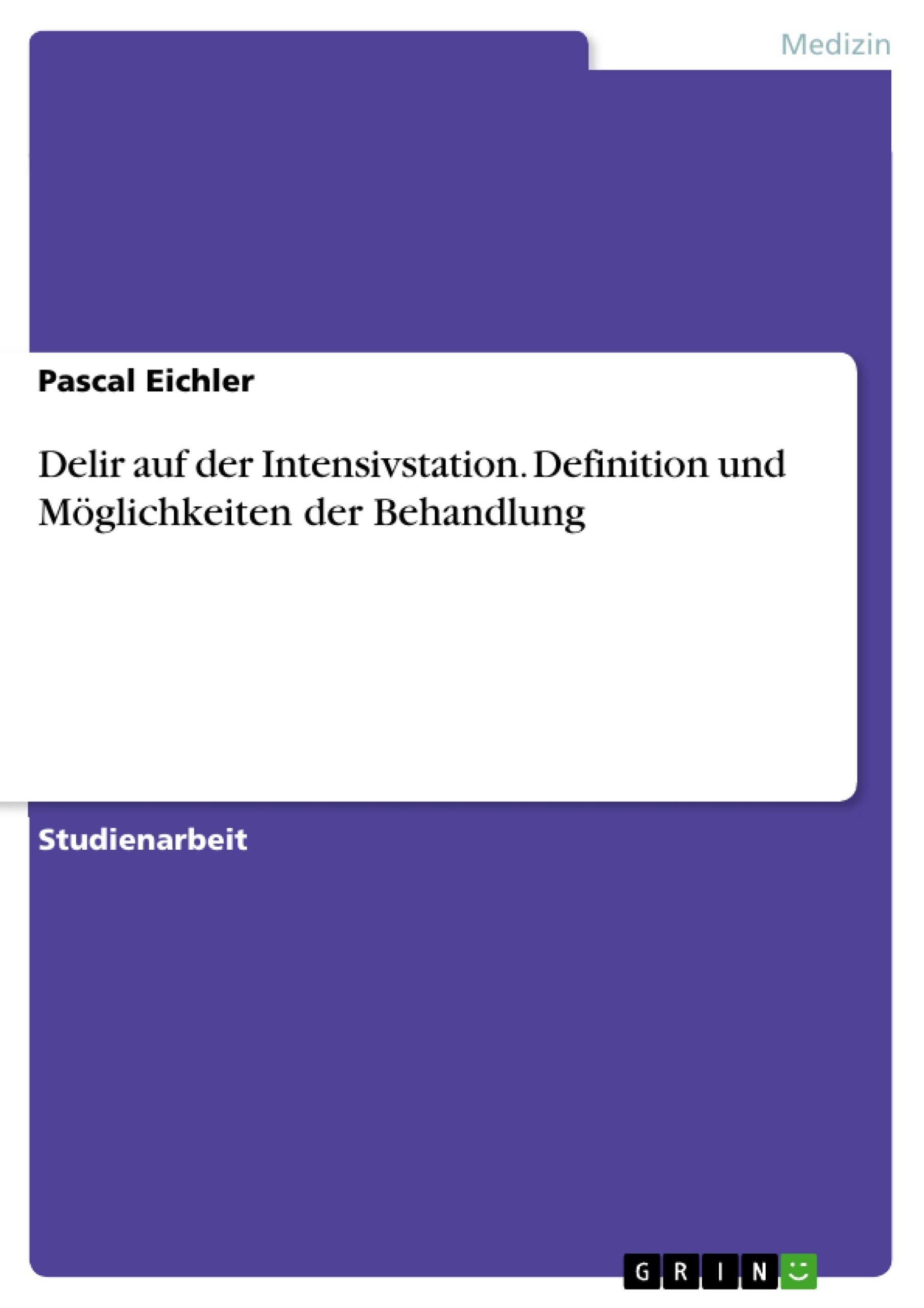Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, was ein Delir ist und wie es definiert wird? Insbesondere soll im Folgenden die Frage geklärt werden, welche Behandlungsmöglichkeiten es für delirante Patienten auf der Intensivstation geben kann.
Die Intensivstation eines Krankenhauses stellt eine Institution dar, in der aufgrund von diversen Situationen an Ruhe kaum zu denken ist. Lebenswichtige Überwachungsmaßnahmen, hochtechnologische Geräte und ein reges Arbeitstempo tragen dazu bei, dass ein konstant hoher Geräuschpegel herrscht. Zahlreiche pflegerische und ärztliche Tätigkeiten, sowie diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu jeder Uhrzeit, lassen Ruhephasen für Patienten zur Seltenheit werden. Rückzugsmöglichkeiten für Patienten sind aufgrund von notwendiger Monitorüberwachung und Infusionstherapie zudem kaum möglich. Der Patient muss sich also notgedrungen dem System der Intensivstation, beziehungsweise des Krankenhauses anpassen und ist somit während seines Aufenthaltes ständigen akustischen, medikamentösen und interaktionellen Reizen ausgesetzt.
Nicht ausschließlich, aber überwiegend durch die beschriebenen Umstände ist das Krankheitsbild des Delirs zunehmend zu beobachten, welches nicht nur von Patienten und Pflegepersonal, sondern auch von Angehörigen als stark belastendes Ereignis wahrgenommen wird. Während des Aufenthaltes sind bei Beteiligten Gefühle von Machtlosigkeit und Überforderung erkennbar. Noch vor einigen Jahren bezeichnete man dieses Krankheitsbild als sogenanntes Durchgangssyndrom. Beschrieben werden sollte damit ein Zustand, welcher von selbst kam und auf eben gleichem Wege auch folgenlos wieder ausheilte. Es wurde somit eine passagere Erkrankung suggeriert, ohne die dadurch erhöhte Letalität in Betracht zu ziehen. Heute weiß man, dass ein Delir wie ein Notfall gesehen werden muss. Untersuchungen bei Intensivpatienten haben gezeigt, dass die 1-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit mit jedem Delirtag um circa 10% sinkt.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung/ Erkenntnisinteresse/ Forschungsgegenstand
- Forschungsstand
- Geschichtlicher Hintergrund
- Definition
- Ursachen
- Symptome
- Diagnostik
- Behandlung
- Nichtmedikamentöse Behandlung
- Medikamentöse Behandlung
- Fazit
- Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Delir auf der Intensivstation und zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Ursachen, Symptome, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten des Delirs zu gewinnen. Die Arbeit soll dazu beitragen, die Problematik des Delirs im Kontext der Intensivmedizin aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für die optimale Versorgung deliranter Patienten zu entwickeln.
- Delir als akute, notfallmäßig zu behandelnde Krankheit
- Einflussfaktoren und Ursachen des Delirs auf der Intensivstation
- Diagnose und Klassifikation des Delirs
- Nichtmedikamentöse und medikamentöse Behandlungsoptionen
- Auswirkungen des Delirs auf Patienten, Angehörige und das Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellung/ Erkenntnisinteresse/ Forschungsgegenstand
Das Kapitel erläutert den Hintergrund und die Relevanz des Themas Delir auf der Intensivstation. Es werden die belastenden Umstände auf der Intensivstation aufgezeigt, die zum Auftreten eines Delirs beitragen können, wie z. B. der hohe Geräuschpegel, die ständige Überwachung und die häufigen Eingriffe. Der Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen des Delirs auf den Patienten und die Notwendigkeit, diese Krankheit frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
2. Forschungsstand
2.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das Kapitel beleuchtet den historischen Umgang mit dem Delir. Es werden die verschiedenen Begrifflichkeiten und Definitionen des Delirs aus der Vergangenheit betrachtet, von Georg Ernst Stahls „idiopathischen“ und „sympathetischen Delirien“ bis hin zur heutigen Definition in der ICD-10 und im DSM-5.
2.2. Definition
Das Kapitel erläutert die Definition des Delirs nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD) und der Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Es werden die charakteristischen Symptome des Delirs beschrieben und die Einteilung in verschiedene Subtypen dargestellt.
2.3. Ursachen
Das Kapitel behandelt die vielfältigen Ursachen des Delirs auf der Intensivstation. Es werden sowohl die Risikofaktoren bei Patienten, wie z. B. Alter, Vorerkrankungen und Medikamenteneinnahme, als auch die Umgebungsfaktoren, wie z. B. Lärm, unzureichende Beleuchtung und Schlafentzug, berücksichtigt.
2.4. Symptome
Das Kapitel fokussiert auf die typischen Symptome des Delirs. Es werden sowohl die kognitiven Störungen, wie z. B. Orientierungsstörungen, Gedächtnisprobleme und Verwirrtheit, als auch die psychomotorischen Symptome, wie z. B. Agitation, Unruhe und Schläfrigkeit, beschrieben.
2.5. Diagnostik
Das Kapitel befasst sich mit der Diagnose des Delirs. Es werden die verschiedenen diagnostischen Verfahren, wie z. B. die klinische Beurteilung, die neuropsychologische Testung und die bildgebenden Verfahren, vorgestellt.
2.6. Behandlung
2.6.1. Nichtmedikamentöse Behandlung
Das Kapitel erläutert die nichtmedikamentösen Behandlungsansätze für das Delir. Es werden verschiedene Maßnahmen, wie z. B. Orientierungstherapie, Stimulation des Bewusstseins, Vermeidung von Schlafentzug und Anpassung der Umgebung, vorgestellt.
2.6.2. Medikamentöse Behandlung
Das Kapitel behandelt die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten des Delirs. Es werden verschiedene Medikamentenklassen, wie z. B. Antipsychotika, Benzodiazepine und sedierende Medikamente, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Delir, Intensivstation, Bewusstseinsstörung, kognitive Störungen, Psychomotorik, Diagnostik, Behandlung, nichtmedikamentöse Therapie, medikamentöse Therapie, Risikofaktoren, Outcome
- Arbeit zitieren
- Pascal Eichler (Autor:in), 2019, Delir auf der Intensivstation. Definition und Möglichkeiten der Behandlung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/960211