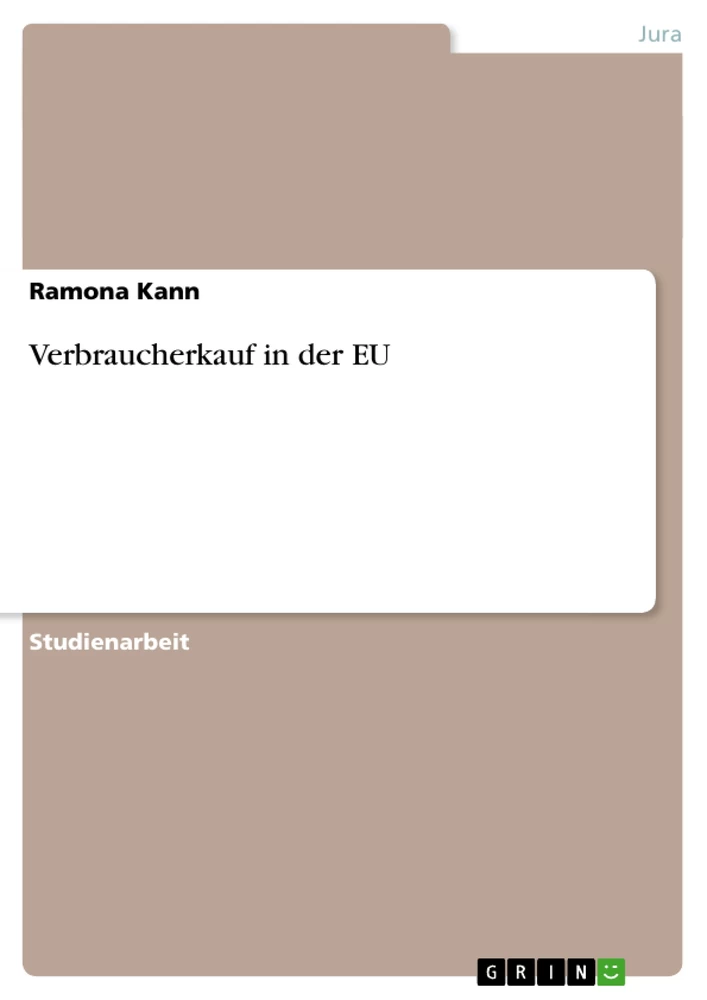INHALTSVERZEICHNIS
1. Entwicklung der Richtlinie
1.1 Sinn und Zweck der Richtlinie
1.1.1 Mindestschutz für Europäische Verbraucher
1.1.2 Rechtsvereinheitlichung innerhalb der Europäischen Union
1.1.2.1 Notwendigkeit einer Rechtsvereinheitlichung
1.1.2.2 Art der Rechtsvereinheitlichung
1.1.2.2.1 Völkerrechtliche Abkommen
1.1.2.2.2 Gemeinschaftsprivatrecht
1.1.2.2.3 Rechtsfortbildung
1.1.2.2.4 Entscheidung für eine Richtlinie
1.2 Vom Grünbuch bis heute - Über die Entstehung des Richtlinienentwurfes
1.2.1 Andere Verbraucherschutzrichtlinien der letzten Jahre
1.2.1.1 Richtlinie zum Verbraucherschutz bei Haustürgeschäften
1.2.1.2 Richtlinie über missbräuchliche Klauseln
1.2.1.3 Fernabsatzrichtlinie
1.2.1.4 Verbraucherkreditrichtlinie
1.2.1.5 Pauschalreiserichtlinie
1.2.1.6 Produkthaftungsrichtlinie
2. Der Inhalt der Richtlinie
2.1 Begriffe und Definitionen
2.1.1 Verbraucher
2.1.2 Verbrauchsgut
2.1.3 Verkäufer
2.2 Vertragsmäßigkeit
2.2.1 Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit
2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt
2.3 Rechtsfolgen
2.4 Rechte und Pflichten
2.4.1 Verkäuferpflichten
2.4.2 Verbraucherpflichten
2.5 Garantien
2.5.1 Begriff
2.5.2 Die gesetzliche Garantie
2.5.2.1 Umfang
2.5.2.2 Fristen
2.5.3 Die kommerzielle Garantie
2.6 Kundendienst
2.7 Zwingender Charakter
2.8 Einzelstaatsrecht / Mindestschutz
2.9 Vergleich mit mitgliedstaatlichem Recht
2.9.1 Was ändert sich für uns?
2.9.2 Was ändert sich in anderen Mitgliedstaaten?
3. Vor- und Nachteile der Richtlinie
3.1 Vorteile
3.2 Nachteile
3.3 Abwägung
4. Die Umsetzung der Richtlinie
4.1 Formelle Umsetzung
4.1.1 Erweiterung des BGB
4.1.2 Selbständiges Gesetz
4.2 Verknüpfung mit dem BGB
5. Abschliessende Zusammenfassung Lieraturliste
VORSCHLAG EINER RICHTLINIE ZUM VERBRAUCHERKAUF UND ZUR VERBRAUCHERGARANTIE IN DER EUROPÄISCHEN UNION
Am 18. Juni 1996 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie vor. Knapp zwei Jahre später, am 23. April 1998, entstand eine Neufassung dieses Entwurfes. Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem ersten Richtlinienentwurf. In den wesentlichsten Punkten wird jedoch auch auf die aktuelle Änderung eingegangen.
1. Entwicklung der Richtlinie
Seit 1974 das erste Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher entstand, gingen bei der Kommission wiederholt Ersuche der Gemeinschaftsorgane ein, Vorschläge zur Verbesserung des Funktionierens der Garantien und des Kundendienstes vorzulegen. Im Folgenden wird nun der Sinn und Zweck der Richtlinie sowie die schrittweise Entwicklung bis zum fertigen Richtlinienvorschlag dargelegt.
1.1 Sinn und Zweck der Richtlinie
Der vorliegende Vorschlag zielt darauf ab, den Verbrauchern in der gesamten Union einen einheitlichen Mindestschutz garantieren. Hervorzuheben ist hier zum einen der Aspekt der Angleichung, zum anderen der des generellen Schutzes.
1.1.1 Mindestschutz für Europäische Verbraucher
Die in den einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführten Studien machen deutlich, daß Probleme im Zusammenhang mit der Qualität der Güter und dem Funktionieren von Garantien der Hauptgrund für Verbraucherbeschwerden sind. Besonders häufig sind Probleme der Inanspruchnahme gesetzlicher und kommerzieller Garantien. In einer Umfrage aus dem Jahr 1993 gaben 52% der befragten Verbraucher Schwierigkeiten beim Umtausch oder der Reparatur von außerhalb des Landes gekauften Produkten als wichtigsten Vorbehalt gegen Einkäufe im Ausland an. In einigen Ländern war der Prozentsatz sogar noch höher. Als weitere Gründe folgen die Sprachbarriere, Schwierigkeiten zur Regelung von Streitfällen sowie die Ungewißheit im Zusammenhang mit den Geschäftsbedingungen, wobei gerade häufig die sprachlichen Vorbehalte eine größere Rolle zu spielen scheinen als Unstimmigkeiten im Kaufrecht. Um mehr Einkäufe in anderen Mitgliedstaaten tätigen zu können, muß der Verbraucher darauf vertrauen können, daß er in jedem Fall in den Genuß eines wirksamen Kundendienstes kommt und sich in jedem Fall von Mängeln am Verbrauchsgut zur Wehr setzen kann. Hierauf baut der Richtlinienvorschlag auf. Er möchte erreichen, daß dem Verbraucher in der gesamten EU ein gemeinsamer Mindeststandard an Rechten zukommt. Es steht den Mitgliedstaaten jedoch frei, strengere Regeln zum Verbraucherschutz zu erlassen bzw. beizubehalten. Damit verfügen sie über einen Ermessensschutz .
Inzwischen haben viele Mitgliedstaaten die Notwendigkeit erkannt, ihre Rechtsvorschriften zu aktualisieren, und zum Teil haben sie bereits damit begonnen. So ist nach dem Britischen Warengesetz der Verbraucher neuerdings gegen geringfügige Sachmängel und mangelnde Haltbarkeit geschützt.
In Griechenland ist ein neues allgemeines Verbraucherschutzgesetz mit wichtigen
Bestimmungen zum Kundendienst erlassen worden, nach welchem der Verkäufer verpflichtet ist, eine Bedienungsanleitung mitzuliefern, ferner den Käufer über die voraussichtliche
Lebensdauer der erworbenen Erzeugnisse zu informieren und innerhalb dieser Zeitspanne für Reparatur- und Wartungsdienste bereitzustehen.
In Finnland wurde eine solidarische Haftung von Hersteller und Verkäufer im Rahmen der gesetzlichen Garantie eingeführt.
In Deutschland, Österreich und Schweden sind gesetzliche Reformen zumindest in Vorbereitung: In Deutschland wurde von einer Sachverständigenkommission, die jahrelang an einem Entwurf für eine Neufassung des Schuldrechts arbeitete, längst festgestellt, daß unsere gegenwärtigen rechtlichen Bestimmungen überholt sind. Auch in Österreich und Schweden ist man derzeit mit der Erstellung neuer Gesetzesentwürfe beschäftigt. Die Schweden erachten ihre derzeitige Garantiefrist von zwei Jahren, wie sie in der Europäischen Union eingeführt werden soll, als unzureichend und planen, diese zu ersetzen.
Die Richtlinie verfolgt primär das Ziel, all diese unterschiedlichen nationalen
Rechtsvorschriften über die gesetzliche Garantie aneinander anzugleichen. Sie zielt dabei aber nicht auf eine umfassende eigene Regelung eines besonderen Kaufrechts für Verbraucher ab, sondern behandelt im Wesentlichen die Rechte des Käufers bei Sachmängeln. Der eng begrenzte sachliche und persönliche Anwendungsbereich des Richtlinienvorschlages verdeutlicht das Ziel des bloßen Minimalschutzes.
1.1.2 Rechtsvereinheitlichung innerhalb der Europäischen Union
1.1.2.1 Notwendigkeit einer Rechtsvereinheitlichung
Ein gemeinsamer Mindestschutz kann nur im Wege einer Angleichung der bestehenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur gesetzlichen Garantie geschehen, denn diese sind in allen Mitgliedstaaten die Grundlage der Verbraucherschutzrechte in Sachen Qualität und Konformität gekaufter Waren. Die einzelstaatlichen Regelungen stammen zum großen Teil aus einer Zeit, als die Produktions- und Vermarktungsbedingungen noch völlig anders waren als heute. Damals ging man von der völligen wirtschaftlichen Gleichheit zweier Vertragspartner aus, was jedoch in der heutigen Zeit von Massenfertigung und Massenvertrieb kaum noch den ökonomischen Gegebenheiten entspricht.
Eine Besserung will man erreichen, indem man die bestehenden einzelstaatlichen Regelungen an das für den internationalen Warenkauf zwischen Gewerbetreibenden geltende internationale Recht (Wiener Kaufrecht; CISG) anpaßt sowie gleichzeitig eine Angleichung des Privatrechts der einzelnen Mitgliedstaaten untereinander bewirkt.
Eine Angleichung wird jedoch vielerorts abgelehnt, da man befürchtet, die homogenen, nationalen Gesetze in ihrer Einheit zu zerstören und zu verkomplizieren. Andererseits kennen beispielsweise die skandinavischen Rechte keine Gesamtkodifikation des bürgerlichen Rechts, wie sie in Deutschland oder Frankreich existiert. Genausowenig gibt es eine vom Zivilrecht klar unterscheidbare Handelsgesetzgebung. Von ursprünglich 648 Artikeln des französischen Code de Commerce sind heute nur noch 140 anwendbar, alles andere regeln Spezialgesetzgebungen. In Italien und den Niederlanden faßt man bürgerliches Recht und Handelsrecht in einem Zivilgesetzeswerk zusammen. Das niederländische Gesetzbuch hat darin sogar noch die wesentlichen Teile des Verbraucherrechts integriert. Das Schweizer Recht kennt ebenfalls kein umfassendes Zivilgesetzbuch: Dort wird von dem vergleichbaren Gesetzeswerk lediglich das Personenstands-, Familien, Erb- und Eigentumsrecht umfaßt. Auch im hiesigen Privatrecht sind zahlreiche Unstimmigkeiten vorhanden, so ist zum Beispiel das für Vertragsbeziehungen überaus wichtige Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen au ß erhalb des BGB geregelt. Diese Beispiele zeigen, daß die Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten durchaus nicht derart homogen und in sich stimmig sind, wie man oft meint. Eine Angleichung könnte hier Abhilfe schaffen.
1.1.2.2 Art der Rechtsvereinheitlichung
Im Wege der Rechtsvereinheitlichung kann man auf verschiedene Möglichkeiten zurückgreifen.
1.1.2.2.1 Völkerrechtliche Abkommen
Eine häufige Form grenzüberschreitender Regelungen sind völkerrechtliche Abkommen. Sie bieten den Vorteil, daß kein Staat zur Ratifikation der Konvention gezwungen ist und daß sie im Ratifikationsfalle grundsätzlich kündbar sind. Allerdings besteht bei solchen Abkommen die Gefahr der Erstarrung, so daß aufgrund mangelnder Regelung von Nachverhandlungen zukünftige notwendige Abänderungen lange auf sich warten lassen können. Innerhalb der EU ist diese Gefahr zwar nicht allzu hoch, aber dennoch vorhanden.
1.1.2.2.2 Gemeinschaftsprivatrecht
Eine harmonisierende Vereinheitlichung könnte aber auch durch eine Richtlinie oder Verordnung gemäß Art. 189 EGV erfolgen. Durch einen solchen Gesetzgebungsakt geschaffene Verpflichtungen stellen unmittelbar verbindliches, vorrangiges Recht dar und können von den Mitgliedstaaten weder einseitig aufgekündigt werden, noch können diese Vorbehalte anbringen. Deshalb muß über die Ausgestaltung der jeweiligen Regelung ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. Läßt sich eine solche nicht herstellen, ist eine gemeinschaftsprivatrechtliche Lösung die wohl beste Grundlage für die umfassende und zeitgleiche Geltung sowie für Anpassungen an zukünftige Entwicklungen und andere Regelungen. Das Verbraucherkaufrecht würde durch eine solche Lösung auch in beitretenden Mitgliedstaaten unmittelbar gelten.
1.1.2.2.3 Rechtsfortbildung
Ein wichtiger Punkt in der Rechtsvereinheitlichung ist die Ausgestaltung der Rechtsfortbildung. Die Anwendung und Auslegung der europäischen Rechtsbegriffe sowie das Schließen der noch vorhandenen Lücken können entweder den nationalen Gerichten oder einem übergeordneten, supranationalen Gericht übertragen werden. Zwar schränkt letztere Möglichkeit die staatliche Souveränität ein, allerdings ist eine einheitliche Auslegung ohne die verbindliche Autorität eines gemeinsamen Gerichtes erfahrungsgemäß kaum möglich. Andernfalls würde sich durch eine unterschiedliche nationale Spruchpraxis ein geschaffenes Einheitsrecht auseinanderdividieren und so seine harmonisierende Wirkung wieder zunehmend verlieren. Ein supranationales Gericht ist in Form des EuGH bereits vorhanden. Alles in allem spricht die Ausgestaltung der Rechtsfortbildung für die Schaffung eines Gemeinschaftsprivatrechts.
1.1.2.2.4 Entscheidung für eine Richtlinie
Ein Völkerrechtliches Abkommen ist, wie man obenstehend nachvollziehen kann, aufgrund seiner mangelnden Flexibilität nicht zur Regelung des Kaufrechtes in Europa geeignet. Man benötigt statt dessen eine flexible Lösung, die gleichzeitig sowohl europaweit verbindlich ist als auch die Mitgliedstaaten nicht zu sehr in ihrer eigenen Handlungsfreiheit beschneidet. Daher hat man sich für die Rechtsschaffung in Form einer Richtlinie entschieden, welche einen Mindeststandard vorgibt.
1.2 Vom Grünbuch bis heute - Über die Entstehung des Richtlinienentwurfes
Schon vor 70 Jahren beschrieb ein Niederländischer Schriftsteller das Phänomen, daß bei einer mangelhafter Lieferung im Rahmen eines Kaufvertrages kein niederländischer Jurist wisse, welche Regelung anzuwenden sei - die „vices chachés“-Regelung, das Leistungsstörungsrecht oder die Irrtumsregelung. Zwar hat das neue Niederländische Gesetzbuch inzwischen Klarheit geschaffen, doch stellt sich das Problem gerade bei grenzüberschreitenden Transaktionen erneut. Der neue Richtlinienentwurf geht auf dieses Problem ein und kann mithelfen, dieses auf europäischer Ebene zu lösen.
Der Verbraucher als Subjekt besonderer Regeln wurde bereits in Richtlinien und internationalen Übereinkommen wie dem Römischen EWG-Übereinkommen über das Recht vertraglicher Schuldverhältnisse oder dem EuGVÜ hervorgehoben.
Zunächst erschien im Rahmen der neuen Regelungen Ende 1993 das Grünbuch über Verbrauchsgütergarantien und Kundendienst. Dieses hat zunächst wegen der verwendeten Terminologie zu einiger Verwirrung geführt. Beispielsweise wurde die Bezeichnung „Garantie“ nicht nur für die Herstellergarantie sondern auch für die gesetzliche Garantie gebraucht, wie sie im französischen Recht bekannt ist. Die Nordeuropäischen Juristen dagegen meinen mit „Garantie“ ausschließlich die Herstellergarantie. Die ersten, welche die Bedeutung der Garantie erkannt hatten, waren die Briten gewesen, die im Aufsatz „The Consumer Guarantee“ eine gesetzliche Regelung vorstellten. Die Europäische Kommission hat dann diese Ideen übernommen.
Der vorliegende Vorschlag ist außerdem eine Ergänzung zur Richtlinie 93/13/EWG über mißbräuchliche Vertragsklauseln, die für alle Verbraucher einen in der gesamten Union einheitlichen Mindestschutz im Hinblick auf die Vertragsklauseln sicherstellt, welche die Vertragsbeziehungen zu Gewerbetreibenden bestimmen. Bereits diese Richtlinie enthielt ursprünglich einige Bestimmungen zum Verbraucherkauf und der Garantie, welche man aber aufgrund ihrer hohen Bedeutung aus der Richtlinie herausnahm und gesondert behandelte. Daraufhin entstand das Grünbuch.
Mit dessen Ausgabe beabsichtigte die Kommission Reaktionen von Seiten der Betroffenen zu erhalten. In Brüssel wurden zwei Konferenzen veranstaltet, eine die sich mit dem Grünbuch zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie befaßte, die zweite behandelte den Zugang zum Verbraucherschutzrecht für Verbraucher. Auf dieser Konferenz plädierten die Verbraucherverbände geschlossen für, die Produzenten geschlossen gegen den Erlaß einer entsprechenden Richtlinie, die Minderkaufleute akzeptierten den Entwurf. Mit dieser Mehrheit konnte das Generaldirektorat XXIV, unterstützt von einer Expertenkommission, mit der Erarbeitung eines entsprechenden Entwurfes beginnen.
Eine Vorauflage des Richtlinienentwurfes enthielt einige Bestimmungen, die den Kundendienst betrafen. Dieser muß jedoch nicht von jedem Erwerbszweig angeboten werden, so daß man von einer Aufnahme der Bestimmungen in den aktuellen Richtlinientext absah.
Am 18. Juni wurde dann der erste Entwurf erlassen, welcher im darauffolgenden Jahr eingehend beraten wurde. Diese Beratung schloß man im März 1998 ab und erließ daraufhin die bereits erwähnte Neufassung des Richtlinienentwurfes vom April 1998. Diese muß nun in einem zweiten Durchgang beraten werden und könnte - wenn es keine Einwende geben sollte - Mitte des Jahres 1999 beschlossen werden. Sie wäre dann innerhalb von drei Jahren ab ihrer Verkündigung im Amtsblatt der EG umzusetzen.
1.2.1 Ande re Verbraucherschutzrichtlinien der letzten Jahre
Bereits im Vorfeld waren einige Regelungen entstanden, welche auf unterschiedlichen Gebieten den Schutz des Verbrauchers gewährleisten sollten. Alle Regeln definierten den Verbraucher als eine natürliche Person, die bei den von den Schutznormen erfaßten Verträgen zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Im folgenden werden die wichtigsten dieser Richtlinien kurz vorgestellt.
1.2.1.1 Richtlinie zum Verbraucherschutz bei Haustürgeschäften
Die Richtlinie für den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen wurde bereits 1985 erlassen. Gerade bei dieser Art von Geschäften besteht erhöht die Gefahr, daß der Verbraucher überrumpelt wird und ihm Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Daher sorgt die Haustürwiderrufs-Richtlinie in entsprechenden Fällen für ein Mindestmaß an Schutz. Im Kern geschieht dies durch die Einführung eines Rücktrittsrechtes für den Verbraucher innerhalb von sieben Tagen nach Vertragsschluß. Verbraucher ist hier der zweite Teil bei einem Verbrauchervertrag, wobei es sich beim ersten Teil um einen Gewerbetreibenden handeln muß. Das Rücktrittsrecht besteht bei Warenkaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen. Außerdem muß dem Verbraucher eine schriftliche, deutliche Belehrung übergeben werden. Inhaltlich ist uns diese Regelung durch das Haustürwiderrufsgesetz vertraut, welches aufgrund dieser Richtlinie entstand.
1.2.1.2 Richtlinie über missbräuchliche Klauseln
Die bereits oben erwähnte Richtlinie über mißbräuchliche Vertragsklauseln stellt sicher, daß der europäische Verbraucher überall in der Union denselben Schutz vor allgemeinen mißbräuchlichen Vertragsbedingungen genießt. Betroffen sind allerdings nur die Klauseln, welche die Modalitäten einer Transaktion bestimmen - über die Rechte des Verbrauchers im Fall einer unzulänglichen Vertragsausführung wird nichts ausgesagt. Die Richtlinie ist noch relativ jung, vom 05.04.1993. Sie enthält im wesentlichen eine Generalklausel über eine gerichtliche Inhaltskontrolle bestimmter Vertragsbedingungen, das Tranzparenzgebot, die Unklarheitenregel und das Teilnichtigkeitsprinzip, insgesamt ein Regelungskomplex, der uns durch unser AGBG bereits bekannt ist.
Bereits in dieser Richtlinie wurde der Unterscheidung Privatmann - Kaufmann die Unterscheidung Verbraucher - Gewerbetreibender hinzugefügt. Bei der Umsetzung kam so mit § 24a AGBG eine Differenzierung des persönlichen Anwendungsbereichs bestimmter Vorschriften zu den Unterscheidungen des § 25 AGBG hinzu. Einige weitere Änderungen wurden am AGBG vorgenommen, allerdings nur im europarechtlich notwendigen Rahmen.
1.2.1.3 Fernabsatzrichtlinie
Die Richtlinie über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz stärkt die Stellung des Verbrauchers im Binnenmarkt und kann durch Schutzstandards die Formen des Distanzvertriebes verbessern und attraktiver gestalten. Diese Formen - wie Versandhandel, Katalogverkauf etc. - werden heute durch die zunehmende Technifizierung um Teleshopping,
Internet- und E-mail-Vertrieb erweitert. Gerade Vertragsschlüsse via Internet werden aufgrund der Vielseitigkeit und Schnelligkeit dieses Mediums immer populärer und gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Die Richtlinie regelt also den Verbraucherschutz bei Fernabsatzverträgen. Mit „Fernabsatz“ ist aber nicht lediglich die Leistungsabwicklung gemeint, sondern auch der Vertragsabschluß selbst. Geregelt werden Verträge, die nicht von Angesicht zu Angesicht zwischen den Vertragspartnern geschlossen werden, damit wird an den Anwendungsbereich der Richtlinie zum Verbraucherschutz bei Haustürgeschäften angeknüpft. Im einzelnen besteht der Schutz des Verbrauchers darin, daß er rechtzeitig vor Abschluß eines Vertrages über bestimmte Essentialia des Vertrages unterrichtet sein muß. Außerdem muß für ihn unzweideutig erkennbar sein, daß es sich um einen kommerziellen Vertragsschluß handelt und die vor Vertragsschluß gegebenen Informationen müssen schriftlich bestätigt werden. Im Notfall steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu, welches den Kern der Richtlinie darstellt und wonach der Verbraucher innerhalb von mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung widerrufen kann.
1.2.1.4 Verbraucherkreditrichtlinie
Auf dieser Richtlinie basiert unser heutiges Verbraucherkreditgesetz. Bei der Umsetzung hat man darauf verzichtet, das veraltete Abzahlungsgesetz von 1894, welches in § 8 Kaufleute von seinem Anwendungsbereich ausschloß, zu übernehmen und zu ergänzen. Statt dessen hat man den persönlichen Anwendungsbereich in § 1 VerbrKrG am Begriffspaar Verbraucher / gewerblicher Kreditgeber bzw. -vermittler festgemacht. Das Schutzprinzip des Verbrauchers entspricht aber im Grundsatz dem der anderen Regelungen.
1.2.1.5 Pauschalreiserichtlinie
Die §§ 651a ff. BGB wurden an diese Richtlinie angepaßt. Die Pauschalreiserichtlinie geht sehr weit und fixiert für ganz Europa die Haftung des Veranstalters für die Gesamtheit einer Reise. Verbraucher ist hier der Reisende, für welchen die Richtlinie die entsprechenden Schutzmaßnahmen regelt.
1.2.1.6 Produkthaftungsrichtlinie
Die Produkthaftungsrichtlinie hat bisher im europäischen Schrifttum viel Zuspruch gefunden. Allerdings ist ihre praktische Bedeutung beschränkt geblieben. Auf ihr beruhen die nationalen Produkthaftungsgesetze, aufgrund derer auch die durch Sicherheitsmängel verursachten Schäden zu ersetzen sind. Unter Produkthaftung versteht man ein zivilrechtliches System für den Ersatz von Schäden, welche aus der Verwendung einer fehlerhaften Sache einem gewerblichen Abnehmer, einem Arbeitnehmer bei der Verwendung als Arbeitsgerät, einem privaten Verbraucher oder einem unbeteiligten Dritten durch Produktgefahren entstehen. Die Richtlinie verwendet zwar nicht den Begriff des Verbrauchers als solchen, stellt jedoch ebenfalls nur auf Schäden an Sachen ab, die gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt sind und vom Geschädigten hauptsächlich zu einem solchen verwendet werden. Auch hier wird damit zwischen dem besonders schutzwürdigen Verbraucher und dem Gewerbetreibenden unterschieden.
2. Der Inhalt der Richtlinie
2.1 Begriffe und Definitionen
Der Verbraucherkauf wird mit Hilfe des Kaufgegenstandes und der Kaufvertragsparteien abgegrenzt.
2.1.1 Verbraucher
Mit dem Begriff des Verbrauchers ist ein neuer Zentralbegriff entstanden, der auch innerhalb des juristischen Europas zunehmend an Bedeutung gewinnt, was man an dem Zuwachs von Gesetzen, die den Verbraucherschutz zum Inhalt haben und an den in vielen Ländern vorhandenen Regeln für den Verbraucherkaufvertrag gut erkennen kann.
Verbraucher können nach Art. 1 Abs. 2 a nur natürliche Personen sein, welche zu einem Zweck handeln, der nicht unmittelbar ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Handwerker beim Kauf eines Wagens für private Zwecke fällt hierunter, nicht aber, wenn der Wagen als Geschäftswagen genutzt wird. Der Richtlinienentwurf beschränkt sich somit auf den privaten Letztverbraucher.
In einem Vorentwurf galt auch die Person des Minderkaufmanns als Verbraucher. Es war jedoch nicht angemessen, in diesem Richtlinienentwurf ein anderes Verbraucherkonzept als in anderen Richtlinien zu benutzen, so daß man letztendlich einen herkömmlichen Verbraucherbegriff wählte.
2.1.2 Verbrauchsgut
Es muß ein Verbrauchsgut verkauft worden sein. Das ist nach Art. 1 Abs. 2 b jedes in der Regel für den Letztverbrauch oder zur Letztverwendung bestimmte Erzeugnis mit Ausnahme von Immobilien. Diese Definition beschränkt sich nicht auf neue, langlebige Güter und könnte damit insbesondere für den Gebrauchtwagenkauf passen - für den allerdings der bisher weithin übliche Gewährleistungsausschluß unmöglich gemacht werden soll.
Die Neufassung des Richtlinienentwurfes definiert das Verbrauchsgut noch genauer: hiernach gelten als Verbrauchsgüter bewegliche Sachen mit Ausnahme von Gütern, die aufgrund von Zwangsvollstreckung oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden, Wasser und Gas, wenn sie nicht in einem bestimmten Behältnis und in einer bestimmten Menge abgefüllt sind, und Strom.
2.1.3 Verkäufer
Verkäufer ist nach Art. 1 Abs. 2 c jede natürliche oder juristische Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Verbrauchsgüter verkauft. Nicht berufsmäßige Verkäufe werden nicht erfaßt, so daß ein Gewährleistungsausschluß dadurch gerettet werden kann, daß kein Händler eingeschaltet wird.
2.2 Vertragsmäßigkeit
Die Verbrauchsgüter müssen dem Kaufvertrag gemäß sein. Gemeint ist damit die Istbeschaffenheit der Kaufsache mit Ihrer Sollbeschaffenheit. In einem Vorentwurf zur Richtlinie durfte eine Sache „nicht fehlerhaft“ sein. Letztlich zog man aber den Anschluß an das Wiener Kaufrecht vor und änderte die Definition dahingehend ab, daß die Sache „konform“ sein müsse. Hierin ist damit nicht nur die Lieferung fehlerhafter Ware mit einbezogen, sondern auch die Lieferung falscher Artikel. Problematisch ist die Frage, welche Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit zu stellen sind.
2.2.1 Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit
Zunächst kommt eine Übereinstimmung mit den berechtigten Erwartungen des Verbrauchers in Betracht. In Verbraucherkreisen fand dieses Kriterium breite Zustimmung, allerdings ist das Abstellen auf „den Verbraucher“ statt auf den konkreten Käufer zu generell. Es müßte geklärt werden, welcher Verbrauchertyp maßgeblich sein soll. Außerdem ist der Begriff „berechtigte Erwartungen“ sehr unbestimmt. Gerade welche Erwartungen ein Käufer an den Händler stellen darf, ist regelungsbedürftig.
Kriterien, die Art. 2 Nr. des Richtlinienvorschlags nennt, sind jedoch:
- Die Übereinstimmung der Kaufsache mit Beschreibungen durch den Verkäufer sowie mit Proben oder Mustern.
- Eignung für alle Zwecke, für die derartige Erzeugnisse gewöhnlich gebraucht werden.
- Eignung für einen bestimmten Zweck, den der Käufer dem Verkäufer beim Vertragsschluß genannt hat, wenn nicht der Käufer den Erklärungen des Verkäufers mißtraut hat. Dies entspricht Art. 35 (1) und (2) (a) - (c) CISG, teilweise auch § 459 Abs. 1 Satz 1 BGB, welche einen gewöhnlichen oder besonderen vertraglich vorausgesetzten Gebrauch maßgebend sein lassen, wobei im letzteren Falle kein besonderes Vertrauen auf Käuferseite vorausgesetzt werden muß. Der aktuelle Vorschlag vertauscht dieses Kriterium mit dem vorhergehenden, so daß es sich schon in Abs. 2 b des Art. 2 findet.
- Die Sache muß angesichts ihrer Beschaffenheit, des gezahlten Preises und sie betreffender öffentlicher Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers oder dessen Vertreters in bezug auf Qualität, und Leistung zufriedenstellend sein. Die Fassung vom April 1998 formuliert an dieser Stelle derart, daß Vertragsmäßigkeit vorliegt, wenn die Güter Qualität und Leistungen aufweisen, die bei gleichen Gütern üblich sind, und die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, wenn die Beschaffenheit des Gutes und gegebenenfalls die insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett getätigten öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers oder des dessen Vertreters über die konkreten Eigenschaften des Gutes in Betracht gezogen werden.
Diese Kriterien sind nicht miteinander verknüpft, so daß bereits eine Abweichung eines
Kriteriums die Vertragsgemäßheit ausschließt. Allerdings wird - im Gegensatz zum Wiener Kaufrecht - nicht die Wesentlichkeit des Mangels gefordert.
Zweifelhaft war in der Erstfassung, ob auch für nicht vom Verkäufer stammende Werbeaussagen gehaftet werden kann. Ein Teil der Begründung zum Richtlinienvorschlag bezieht sich Art. 35 Abs. 2 UN-Kaufrecht, welcher diesen Fall nicht in Erwägung zieht. Auch das Deutsche Recht verfährt in Art. 13a UWG zurückhaltender, zumal es dort nur um einen Rücktritt und nicht um alle Rechtsmängelbehelfe geht. Andererseits können aber gemäß § 459 Abs. 1 S. 2 BGB auch hierzulande Werbeaussagen den Wert oder die Tauglichkeit einer Sache zum gewöhnlichen oder zum nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch bestimmen. Außerdem schränkt Art. 3 Abs. 3 des Vorschlags die Verkäuferhaftung für unrichtige fremde Werbung erheblich ein, so daß der Unterschied zwischen dem geltenden deutschen Recht und dem Vorschlag der EU in diesem Punkt nicht sehr wesentlich sein dürfte. Die Umformulierung in der neuen Richtlinie, nach welcher zur Qualitäts- und Leistungsbeurteilung die „insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett getätigten öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers oder dessen Vertreters über die konkreten Eigenschaften des Gutes“ in Betracht gezogen werden können, zeigt inzwischen deutlich, daß sich Art. 2 auch auf nicht vom Verkäufer stammende Werbeaussagen bezieht.
Ferner sind neuerdings zwei Absätze in diesen Artikel eingefügt worden. Nach Abs. 3 der Neufassung liegt keine Vertragswidrigkeit vor, wenn der Verbraucher zum Zeitpunkt des Vertragsabschluß den Mangel kannte oder kennen mußte. Dieser Aspekt findet in der früheren Fassung erst in Art. 3 seinen Platz, ebenso wie folgende, in der Neufassung vorgezogene Regel: Der Hersteller ist durch die öffentlichen Äußerungen des Herstellers nicht gebunden, wenn er nachweist, daß er die Äußerung nicht kannte oder kennen mu ß te.
Entstammt der Mangel nicht der Kaufsache selbst, sondern aus deren unsachgemäßer Montage, stellt diese Konstellation nur einen Sachmangel dar, wenn der Verkäufer die Montage selbst vorgenommen, zumindest aber zu verantworten hat. Wann dies der Fall ist, ergibt sich aus den nationalen Rechten. Offen bleibt lediglich, ob der Käufer in solchen Fällen nicht zuerst eine Nachbesserung der Montagleistung sollte verlangen müssen, ehe er Rechte hinsichtlich der Kaufsache geltend macht.
Nach der Neufassung muß die Montage allerdings Bestandteil des Kaufvertrags gewesen sein und vom Verkäufer unter dessen Verantwortung vorgenommen worden sein.
2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt
Die Vertragsmäßigkeit der Kaufsache wird gemäß Art. 3 Abs. 1 des Richtlinienvorschlags nach ihrer Beschaffenheit im Zeitpunkt der Übergabe (Neufassung: „bei Lieferung“) beurteilt. Die Beweislast, daß ein Mangel schon bei der Übergabe vorgelegen hat, liegt beim Käufer. Allerdings wird gemäß Art. 3 Abs. 3 bei Auftreten einer Vertragswidrigkeit binnen sechs Monaten das Bestehen derselben bei Lieferung vermutet. Diese Vermutung soll nicht gelten, wenn sie mit der Natur der Sache oder der Natur der Vertragswidrigkeit nicht zu vereinbaren ist . Das wäre zum Beispiel bei verdorbenen Tomaten (Natur der Sache) oder auch bei Bruchschäden (Natur der Vertragswidrigkeit) der Fall. Mithin liegt eine hinreichende Einschränkung vor .
Ist dagegen der Mangel bereits vorhanden, wenn das Produkt auf den Markt gebracht wird, dann und nur dann läßt man den Hersteller für den Mangel haften.
2.3 Rechtsfolgen
Fehlt die Vertragsgemäßheit, stehen dem Verkäufer mehrere Möglichkeiten zur Wahl:
Nachbesserung, Nachlieferung fehlerfreier Ware, Minderung des Kaufpreises und Auflösung des Vertrages. Fraglich ist, ob sich der nach der Ersatzbeschaffung stehende Zusatz „sofern eine solche möglich ist“ auch auf die Nachbesserung beziehen soll. Der Sache nach zumindest wäre dies unvermeidlich. Allerdings reicht aus, daß eine ausführbare Nachbesserung Dritten möglich ist, die dann vom Verkäufer zu beauftragen sind.
2.4 Rechte und Pflichten
2.4.1 Verkäuferpflichten
Die Hauptpflicht des Verkäufers besteht darin, für die Vertragsgemäßheit der Sache zu sorgen, wie bereits erörtert, und im Falle ihres Fehlens dafür zu haften.
Auffällig ist, daß Art. 3 in der Neufassung umbenannt wurde in „Rechte des Verbrauchers“ (ehemals: „Pflichten des Verkäufers“).
Der Verkäufer hat nämlich nicht nur Pflichten: Nach Art. 3 Abs. 5 (Neufassung Art 3a) des EU-Vorschlags kann der dem Käufer haftende Letztverkäufer auch seinen Verkäufer, den Hersteller oder eine andere Zwischenperson in Regreß nehmen, wenn diese die Vertragswidrigkeit verschuldet haben. Dies muß allerdings nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften geschehen. Nach § 477 BGB sind aber Ansprüche des Letztverkäufers gegen seinen eigenen Verkäufer regelmäßig verjährt, wenn der Letztverkäufer Gewährleistung verlangt. Hier müßte im deutschen Recht die Verjährungsfrage anders geregelt werden.
2.4.2 Verbraucherpflichten
Aber auch der Verbraucher hat Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung die Verwirkung seiner Ansprüche zur Folge hat. So möchte der Entwurf eine gewisse Ausgewogenheit zwischen den Verpflichtungen aller Beteiligten beibehalten. Um in den Genuß seiner Rechte zu gelangen, muß er dem Verbraucher einen Mangel binnen Monatsfrist, von dem Zeitpunkt an, zu dem er den Mangel festgestellt hat oder feststellen mußte, anzeigen. Hieraus kann man eine im normalen Rahmen bestehende Sorgfaltspflicht des Käufers ersehen, welche sich aber nicht unmittelbar aus dem Gesetzestext ergibt.
2.5 Garantien
Ein zentraler Begriff der neuen Richtlinie ist der der Garantie. Der Richtlinienvorschlag umfaßt zwei Teile, von denen der erste Teil (Hauptteil) die gesetzliche Garantie behandelt und der zweite Teil die kommerzielle Garantie betrifft.
2.5.1 Begriff
Zu unterscheiden ist hier zwischen der gesetzlichen und der kommerziellen Garantie. Die gesetzliche Garantie bildet das Gerüst, auf welchem die kommerziellen Garantien aufbauen. Diese dürfen daher in der Regel nicht von den gesetzlichen Garantien abweichen.
Der Begriff der gesetzlichen Garantie umfaßt das Recht der Sachmängelgewährleistung für Verbrauchsgüter, das sich unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen bei Mängeln an einer erworbenen Sache ergibt, und zwar als kollaterale Folge des Kaufvertrages. Wesentlich hieran ist, daß sie den Käufer und dessen Erwartungen schützen will und unabhängig von der Willensbekundung ihre rechtliche Wirkung kraft Gesetzes entfaltet.
Die kommerzielle Garantie dagegen bedarf der Willensbekundung des Garantiegebers, welcher freiwillig die Haftung für bestimmte Mängel, die an der verkauften Sache auftreten, zu übernehmen bereit ist. Sie kommt durch eine schriftliche Zugabe zustande, mit welcher sich der Garantiegeber verpflichtet, das Erzeugnis instand zu setzen oder zu ersetzen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Mangel daran auftreten sollte.
Mit dieser „gemischten Lösung“ will die Kommission einerseits einen rechtlichen Rahmen für kommerzielle Garantien in Konkretisierung des Tranzparenzprinzip schaffen, zum anderen will sie zugunsten des Herstellers Anreize schaffen, eine freiwillige europaweite Garantie anzubieten.
Wenn die Richtlinie die Bezeichnung „Garantie“ gebraucht, geht es um die gesetzliche Garantie. Allein Artikel 5 bezieht sich auf die kommerzielle Garantie.
2.5.2 Die gesetzliche Garantie
2.5.2.1 Umfang
Bezüglich der gesetzlichen Garantie soll die Richtlinie ausschließlich verbraucherschutzbezogene Aspekte im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Sache, die nicht vertragsgemäß ist, regeln. Sie will jedoch keine vollständige Harmonisierung des Kaufrechts. So betrifft der Vorschlag lediglich die Verpflichtung des Garantiegebers zur konkreten Lösung bei Problemen in Form von Rückerstattung des Kaufpreises oder Preisminderung, Umtausch oder Reparatur des betreffenden Erzeugnisses. Nicht berührt wird somit die Frage der Haftung für Mangel- oder Mangelfolgeschäden. Auch wenn diese Problematik über kurz oder lang gelöst werden muß, wollte man nicht vorzeitig durch Sprachverwirrung das Gelingen des ganzen Entwurfes in Gefahr bringen.
2.5.2.2 Fristen
Nach Art. 3 Abs. 1 des EU-Vorschlags soll der Verkäufer für jede Vertragswidrigkeit haften, die zum Zeitpunkt der Übergabe besteht und binnen zwei Jahren von diesem Zeitpunkt an offenbar wird. Auf der anderen Seite regelt Art. 4 Abs. 1, daß der Käufer dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit innerhalb eines Monats nach Feststellung des Mangels, bzw. eines Monats nachdem er den Mangel hätte feststellen müssen, anzeigen muß. Diese Doppelfrist wurde vom Rechtsausschuß des Bundesrates als „bedenklich“ gerügt. Eine solche Konstellation einer kenntnisunabhängigen langen Frist und einer bei Kenntnis beginnenden kurzen ist auch im deutschen Zivilrecht zu finden, etwa in §§ 124 und 852 BGB, wovon letztere Vorschrift auch in neuere Gesetze wie § 17 UmweltHG, § 11 HPflG, § 12 ProdHaftG übernommen wird. Im Vertragsrecht kann eine Doppelfrist allerdings zu Problemen führen: Sie würde den Schuldner bei einer Vertragsverletzung in eine bessere Situation bringen als bei einem ungestörten Erfüllungsanspruch, bei dem eine mit der Kenntnis beginnende kurze Frist nicht existiert. Außerdem ist der Zeitpunkt der Kenntniserlangung oft sehr schwer zu ermitteln. In Art. 4 Abs. 1 des Richtlinienvorschlags wird jedoch zusätzlich auf den Zeitpunkt abgestellt, zu dem der Käufer die Vertragswidrigkeit „hätte feststellen müssen“. Damit würde dem Verbraucher allerdings eine Pflicht zur Untersuchung auferlegt, und er wäre damit einem Kaufmann gleichgestellt. Das kann nicht im Sinne des Verbraucherschutzes sein. Gemeint ist danach wahrscheinlich das Evidentwerden des Mangels. So soll dem Verbraucher eine gewisse Sorgfaltspflicht auferlegt werden, die gekaufte Sache in Augenschein zu nehmen, es besteht jedoch nicht zwingend die Pflicht, die Sache genauestens zu prüfen und zu beurteilen. Stellt man auf die Beweislast des Verkäufers ab, bedeutet die Erwähnung des „Kennenmüssens“ eine Erleichterung: Aus der Evidenz eines Mangels läßt sich auf Kenntnis des Käufers schließen.
Auch die Neufassung der Regelung sieht eine Mindestfrist von zwei Jahren vor. Allerdings verlängert sie die kurze Frist von einem Monat auf zwei Monate. Diese kurze Frist anzuwenden bzw. in dieser Kürze anzuwenden steht jedoch letztlich im Ermessen der Mitgliedstaaten.
Eine Vervierfachung der absoluten Frist des § 477 BGB von sechs Monaten auf zwei Jahre, dürfte gerade in der Wirtschaft auf Widerstand stoßen. Allerdings hat auch die Schuldrechtskommission, die mit der Neuerung des Schuldrechts beauftragt war, hier eine Frist von drei Jahren vorgesehen, welche, wenn sie Gesetz würde, der Zweijahresfrist des EU- Vorschlags noch vorginge. Weiterhin ist nicht einzusehen, daß Ansprüche aus Vertragsverletzung wegen Lieferung mangelhafter Sachen schneller Verjähren sollen als andere Ansprüche aus Vertragsverletzung. Die sechsmonatige Frist des § 477 Abs. 1 S. 1 BGB wird überwiegend rechtspolitisch als verfehlt angesehen. Eine Frist von zwei Jahren ist damit durchaus legitim.
Die Ansprüche auf Vertragsauflösung oder Nachlieferung fehlerfreier Ware kann der Verbraucher gemäß Art. 3 Abs. 4 des Vorschlags nur innerhalb des ersten Jahres vom Fristbeginn an geltend machen. Danach ist er auf Nachbesserung oder Preisminderung beschränkt. Begründet wird dies damit, daß Vertragsauflösung und Ersatzleistung mit fortdauernder Vertragsdauer unzweckmäßiger würden. Bei beiden Rechtsbehelfen muß der Verkäufer die gebrauchte Sache zurücknehmen. Allerdings dürfte die Wertminderung oder Nutzungsentschädigung für zwei Jahre kaum schwerer zu berechnen sein, als für ein Jahr. Der Verkäufer wird hauptsächlich durch die Rücknahme einer gebrauchten Sache generell belastet. Die Gebrauchsdauer ist nebensächlich. Somit ist eine Abkürzung der Frist von zwei Jahren für einzelne Rechtsbehelfe nicht notwendig.
2.5.2 Die kommerzielle Garantie
Eine gesetzliche Regelung der kommerziellen Garantie ist nur in wenigen Gesetzgebungen zu finden. Das bekannteste Vorbild für eine gesetzliche Garantieregelung ist der amerikanische Magnuson-Moss Federal Warranty Act.
Der Bereich der kommerziellen Garantie soll nicht insgesamt durch Vorschriften geregelt werden. Aufgeführt sind lediglich einige Grundsätze in Bezug auf Transparenz der kommerziellen Garantien und ihr Verhältnis zu den gesetzlichen Garantien. Außerdem werden einige Bestimmungen zum Setzen eines Rechtsrahmens vorgegeben. Weitere Komponenten dienen der Wettbewerbserhaltung und werden gesetzlich nicht detailliert geregelt. So besteht zum Beispiel keine Verpflichtung zur Gewährung kommerzieller Garantien, wenn auch Rechtsvorschriften einzelner Mitgliedstaaten eine solche enthalten. Inhalt, Garantiezeit und Modalitäten für die Inanspruchnahme der Gewährleistung bleiben im Ermessen des Garantiegebers. Dienstleistungen außerhalb der Inanspruchnahme einer gesetzlichen oder kommerziellen Garantie bleiben aufgrund der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips vom Geltungsbereich der Richtlinie unberührt.
Kommerzielle Garantien nach Art. 5 des Richtlinienvorschlags sind solche des Verkäufers
oder des Herstellers. Auch den Importeur oder andere Glieder der Absatzkette darf man hier einreihen. An kommerzielle Garantien werden mehrere Anforderungen gestellt:
- Sie müssen die Lage des Begünstigten gegenüber seiner gesetzlich begründeten Rechtsposition verbessern.
- Sie müssen die Schriftform einhalten.
- Sie müssen vor dem Kauf unverbindlich einsehbar sein.
- Sie müssen in unmißverständlicher Form die wesentlichen, für ihre Inanspruchnahme notwendigen Elemente enthalten.
Allerdings wird kein Minimalstandard für Garantien festgelegt.
Auch bezüglich der Werbung sollen die angegebenen Bedingungen bindend sein. Werbung ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels mit dem Ziel, den Absatz von Waren zu fördern. Hierunter fällt auch das Bestreiten eines Garantieanspruchs bei Vertragsverhandlungen. Die Werbung wird jedoch nie die Schriftlichkeit oder Unmißverständlichkeit, wie sie gefordert werden, einhalten. Sinn macht das Einbeziehen der Werbung in den Garantiebegriff nur, wenn man auf die Werbung mit der Garantie abstellt. Der Garantiegeber haftet danach für die Richtigkeit seiner hinsichtlich der Garantie gemachten Werbeangaben. Die Werbung mit Garantien wird so den eigentlichen Garantien gleichgestellt. Tatsächlich werden bisher Garantien oft in weniger weitgehendem Umfang gewahrt, als für den Kunden aus der diesbezüglichen Werbung ersichtlich ist. Die Werbung hinsichtlich der Ware selbst wird bereits mit den die Kaufsache betreffenden öffentlichen Äußerungen von Art. 2 Abs. 2 d des Vorschlags erfaßt, wonach die Sache der Werbung entsprechen muß. Der Begriff der Mangelhaftigkeit kann sich damit sowohl auf die Sache als auch auf die Garantie beziehen. Letztere soll entsprechend der Werbung ausgelegt werden. Was jedoch gilt, wenn sich Werbung und Garantieurkunde widersprechen, regelt Art. 5 des Richtlinienvorschlages nicht. Wenn jedoch die (irreführende) Werbeangabe für den Kaufentschluß des Verbrauchers nicht kausal war, ist eine Haftung des Verkäufers auszuschließen. Dies gilt ebenso, wenn der Verkäufer die Angabe nicht kannte oder kennen mußte. Sobald er jedoch den Inhalt der Werbeaussage kennt, muß sich der Verkäufer die Werbeaussage eines Dritten zurechnen lassen, unabhängig davon, ob er erkennt, daß die beworbene Ware mit dem Inhalt der Werbung nicht übereinstimmt.
Auch nach der Vorstellung der Verfasser des Richtlinienentwurfes liegt dessen eigentliche Funktion in der Gleichstellung der Werbeangaben mit den eigenen (vertraglichen) Garantiebedingungen.
Art. 5 enthält allerdings auch keine geeignete Sanktion. Auch im deutschen Recht könnte höchstens gemäß §§ 125, 134 BGB eine nicht dem Art. 5 entsprechende Garantie nichtig sein. Mit einer Nichtigkeit der Garantie ist dem Käufer jedoch noch weniger gedient als mit einer irgendwie vorteilhaften. Dies berücksichtigt auch Art. 5 des Vorschlages, nach welchem die Gültigkeit einer Garantie in keiner Weise beeinträchtigt werden darf und der Verbraucher sich in jedem Fall auf sie berufen darf. Das Problem, wirksame Möglichkeiten zu Vermeidung unzureichender Garantien vorzusehen, wird allerdings auf die Mitgliedstaaten abgewälzt. Was hier dem Kunden allein Nutzen bringt, ist wohl eine Auslegung zu seinen Gunsten.
Insgesamt vergrößert sich die Gefahr, daß sich keine Garanten mehr finden, wenn man diese allzu hart anfaßt. Vielleicht sind deshalb die Änderungen im ’98er Entwurf der Richtlinie gerade in diesem Punkt so gewichtig. Die Schriftform muß jetzt nur noch auf Wunsch des Verbrauchers eingehalten werden, es reicht aber auch aus, wenn sie diesem auf andere Weise zugänglich ist. Ferner muß die Garantie darlegen, daß der Verbraucher bereits im Rahmen der einzelstaatlichen Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf Rechte hat, welche von der Garantie nicht berührt werden. Das ist notwendig, um einer Verwechslung von gesetzlichen Gewährleistungsrechten mit der Garantie vorzubeugen. Ein solcher Eindruck wird nämlich häufig beim Käufer erzeugt. Die Garantie muß weiterhin einfach und verständlich formuliert sein sowie alle für ihre Inanspruchnahme notwendigen Angaben enthalten, insbesondere die Dauer und den geographischen Geltungsbereich sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers. Die Mitgliedstaaten, in welchen das Gut in Verkehr gebracht wird, können bestimmen, daß die Garantien wenigstens in einer oder in mehreren Sprachen abzufassen ist, die der Staat unter den Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft auswählt.
Die Garantie muß den Garantiegeber gemäß den in der Haftungserklärung und in der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen binden. Im Falle eines Verstoßes wird die Gültigkeit nicht zu Lasten des Verbrauchers beeinträchtigt: Dieser kann weiterhin die Einhaltung der Garantie verlangen.
2.6 Kundendienst
Unter dem Begriff des Kundendienstes sind alle Serviceleistungen zu verstehen, die nach Erwerb des Verbrauchsgutes durch den Verkäufer oder Hersteller erbracht werden, soweit es sich nicht um Leistungen aufgrund oder im Rahmen der Gewährleistung oder einer Garantie handelt. Im Wesentlichen sind darunter diejenigen Reparaturleistungen zu verstehen, die nach Ablauf der Gewährleistungs- und Garantiefrist während der Haltbarkeitsdauer eines Verbrauchsgutes durchgeführt werden müssen. Zur Lösung dieser Problematik auf Gemeinschaftsebene stellen sich zunächst mehrere Möglichkeiten:
Die strengste Lösung wäre eine Verpflichtung aller Hersteller, die erforderlichen Ersatz- und Einzelteile über einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Im Gegensatz dazu könnten sich die Marktteilnehmer aber auch völlig freiwillig zur Einhaltung gewisser Mindestbestimmungen verpflichten. Die am besten erscheinende Lösung ist wie so oft ein Kompromiß: Danach ist auf dem Warenetikett der Zeitraum anzugeben, währenddessen die nötigen Ersatzteile vom Hersteller bereitgehalten werden. Diese Möglichkeit stellt die Markttransparenz sicher und läßt gleichzeitig dem Wettbewerb freien Lauf, ohne die Hersteller zur Einhaltung fester Fristen zu zwingen.
Der Verkäufer, für welchen eine derartige Pflicht unangemessen wäre, soll jedoch auf keinen Fall zur Bereithaltung von Ersatz und Einzelteilen verpflichtet sein. Dieser Bereich ist allein vom Hersteller abzudecken.
2.7 Zwingender Charakter
Vertragsklauseln oder mit dem Verkäufer vor dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit getroffene Vereinbarungen, welche die durch die Richtlinie gewährten Rechte unmittelbar oder mittelbar außer Kraft setzen, sind für den Verbraucher nicht bindend. Lediglich für den Kauf von Gebrauchtwagen darf man sich nach der Neufassung der Richtlinie auf eine weniger lange Haftfrist für den Verkäufer einigen, welche jedoch ein Jahr nicht unterschreiten darf. Die Mitgliedstaaten dürfen auf jeden Fall zur Gewährung eines höheren Verbraucherschutzniveaus strengere Bestimmungen auf diesem Gebiet erlassen oder aufrechterhalten.
2.8 Einzelstaatsrecht / Mindestschutz
Der nationale Gesetzgeber kann den EU-Vorschlag nur in ausdrücklich bezeichneten Grenzen einschränken zu Lasten des Käufers einschränken. Die einzige Möglichkeit hierzu bietet Art.
3 Abs. 4: „Bei geringfügigen Vertragswidrigkeiten soll bestimmt werden können, daß dem Käufer nicht alle regelmäßig gegebenen Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen“. Dies kann den Verkäufer vor belastenden Rechtsbehelfen wie Vertragsauflösung und Ersatzleistung schützen. Ganz ausschalten läßt sich die Gewährleistung jedoch auch bei Geringfügigkeit nicht.
Im Gegensatz dazu kann aber die Stellung des Käufers auf nationaler Ebene ohne weiteres verbessert werden. Auf diese Weise lassen sich einige Mängel des Richtlinienvorschlags beheben. So muß man zum Beispiel § 477 Abs. S. 1 BGB, nach welchem bei Arglist des Verkäufers keine verkürzte Frist gelten soll, auch auf die Fristen von Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 des EU-Vorschlags beziehen.
Der Richtlinienentwurf läßt offen, ob öffentlich-rechtliche Vorschriften für die vertragsgemäße Beschaffenheit maßgebend sein können und ob solche Bestimmungen des Verkäufer- oder des Käuferlandes beachtet werden müssen. Hierin enthalten ist die Problematik, ob ein Verbraucher bei grenzüberschreitenden Käufen darauf vertrauen kann, daß die Artikel, beispielsweise Lebensmittel oder Elektrogeräte, dem eigenen Reinheitsgebot, Sicherheitsnormen etc. entsprechen, oder ob die evtl. großzügigeren Standards des Verkäuferlandes gelten.
2.9 Vergleich mit mitgliedstaatlichem Recht
Die Mitgliedstaaten müssen im Fall einer Umsetzung der Richtlinie mit - je nach bisheriger einzelstaatlicher Regelung - mehr oder weniger Änderungen rechnen.
2.9.1 Was ändert sich für uns?
Durch die bei einem Sachmangel dem Verbraucher zur Auswahl stehende Möglichkeit der Nachbesserung wird das Arsenal der gesetzlichen Mängelrechte des BGB um diese erweitert. Da die Nachbesserung aber den Verkäufer und häufig auch den Käufer am wenigsten belastet, steht sie inzwischen aber auch als Alternative ohnehin in § 476a BGB.
Die stärksten Abweichungen vom Kaufrecht des BGB finden sich bei dem
Richtlinienvorschlag für die Dauer der Gewährleistung. Hier wird zum einen die Frist des § 477 BGB von sechs Monaten auf zwei Jahre vervierfacht. Auf der anderen Seite läßt man dem Verbraucher nur einen Monat nach Entdeckung bzw. Offensichtlichkeit des Fehlers Zeit, diesen beim Verkäufer anzuzeigen. Diese kurze Frist existiert im Kaufrecht nicht, sondern könnte allenfalls in § 377 HGB oder Art. 39 des UN-Kaufrechtes eine Parallele finden, also in Normen, die für Handelsleute, nicht aber für Verbraucher gelten sollen. Somit scheint die Frist unangemessen kurz. Zwar stellt die Verdoppelung dieser Frist auf zwei Monate in der Neufassung eine Besserung dar, aber die Frist ist nach wie vor verhältnismäßig kurz. Diese Frist aufzunehmen, wird allerdings den Mitgliedstaaten freigestellt („ k ö nnen vorsehen“), so daß die aktuelle Fassung des Entwurfes dieses Problem löst.
Eine Frist für das Auftreten des Mangels ist bis jetzt im deutschen Recht unbekannt, wird jedoch grundsätzlich durch die Gewährleistungsfrist mit abgedeckt, da niemand eine Klage wegen eines Mangels erheben wird, welcher vor Ablauf dieser Frist nicht aufgetreten ist. Nach dem ursprünglichen Vorschlag hätte man hier aber eine zweijährige Frist einführen müssen. Um diese nicht zu verkürzen, hätte die sechsmonatige Verjährungsfrist des § 477 BGB an das Ende dieser Frist für das Auftreten des Mangels geschoben werden müssen, so daß man letztendlich bei einer Fristverlängerung auf 2,5 Jahre gelandet wäre. Hier hat man sich aber darauf geeinigt, daß beide Fristen gleich lang sind und auch zum gleichen Zeitpunkt beginnen, so daß man zu einer Zweijahresfrist gelangt.
Mit der Einbeziehung eines objektiven Qualitätsstandards in Form von objektivierbaren Relationen von Preis und Qualität, aber auch durch das Einbeziehen von Werbe- und öffentlichen Aussagen des Verkäufers in den Vertrag wird eine Lücke geschlossen, die das deutsche AGBG bisher offenließ. Es beschränkt sich zwar in § 11 Nr. 7 und Nr. 10 darauf, in standardisierten Kaufverträgen die Gewährleistung des Verkäufers zu beschränken oder auszuschließen, allerdings läßt § 8 AGBG die Möglichkeit, statt durch von Rechtsvorschriften abweichenden Klauseln, einfach den Leistungsinhalt durch standardisierte Leistungsbeschreibungen zu Lasten des Verbrauchers herabzusetzen. Diese Methode führt zu einer Beschneidung der gerechtfertigten Erwartungen eines Käufers. Der objektive Qualitätsstandard wir allerdings im Einzelfall schwer festzustellen sein.
2.9.2 Was ändert sich in anderen Mitgliedstaaten?
Da die einzelstaatlichen Regelungen der Mitgliedstaaten voneinander abweichen, führt die Angleichung Änderungen mit sich.
Besonders eklatant sind diese hinsichtlich der gesetzlichen Garantiefrist: bisher gab es in Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Finnland eine nicht geregelte Garantiefrist von unbestimmter Dauer. Diese weicht nun der Zweijahresfrist. Außer den Deutschen haben auch die Spanier, Portugiesen, Griechen und Österreicher eine sechsmonatige Garantiefrist, die sich durch die Neuregelung vervierfachen würde. Sechs Jahre dagegen gibt es in Großbritannien und Irland, wo man sich nun auf ein Drittel der Ursprungsfrist umstellen darf. Da jedoch die Richtlinie lediglich einen Mindeststandard vorschreibt, dürfen diese Staaten auch weiterhin an ihrer ursprünglichen, strengeren Regelung diesbezüglich festhalten. In Dänemark und Italien verdoppelt sich die einjährige Garantiefrist, und allein für die Schweden ändert sich hinsichtlich der Länge ihrer Garantiefrist nichts.
3. Vor- und Nachteile der Richtlinie
Der Entwurf ist sehr umstritten. Seine Gegner und Befürworter sind sich immer noch nicht einig, ob der von der Richtlinie versprochene Nutzen tatsächlich derartige Eingriffe in das einzelstaatliche Kaufrecht rechtfertigt.
3.1 Vorteile
Der Binnenmarkt wurde nicht nur zum Wohle der Unternehmen geschaffen und kann nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Verbraucher aktiv daran mitwirken. Ein möglichst ungehinderter Warenaustausch ist Voraussetzung für eine weitere Steigerung des Wirtschaftswachstums und damit für die Förderung und Sicherung des Lebensstandards in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Korrekt informierte Verbraucher können durch ihre Kaufentscheidungen die positiven ökonomischen Auswirkungen eines integrierten Marktes beschleunigen. Der Kauf von Waren jenseits der Grenze kann sich aber nur dann aufwärts entwickeln, wenn der Verbraucher die Gewißheit hat, daß ihm ungeachtet des Anbieterstandortes gleiche Garantie- und Kundendienstkonditionen geboten werden. Eine Minimalharmonisierung könnte hier Hemmnisse vor Käufen im Ausland beseitigen.
Auch für die Unternehmen ist es interessant, wegen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten auf ähnliche Regelungen zu treffen. Hier wäre allerdings ein größerer Schritt notwendig als nur eine Minimalharmonisierung.
Die kommerzielle Garantie spielt in der Praxis eine große Rolle, so daß ihre Regelung sinnvoll ist. Mit einem Garantiezertifikat befindet sich der Verbraucher im Reklamationsfalle in einer gute Position. Ferner ist die Garantie auch für den Garantiegeber attraktiv, stellt sie doch neben dem Preis und der Qualität ein gutes Verkaufsargument dar.
Die Vorteile liegen somit hauptsächlich in der grundsätzlichen Funktion einer Kaufrechtsrichtlinie.
3.2 Nachteile
Es besteht aber auch die Gefahr, daß durch die Harmonisierungstendenzen in Europa die kulturelle Verschiedenheit zerstört wird. Durch die Hinzufügung einer zusätzlichen, nur für Verbraucher geltenden Regelung werden die nationalen Regelungen verkompliziert anstatt vereinfacht. Zudem enthält der EU-Vorschlag viele sachliche Unklarheiten. Das nationale Privatrecht würde durch die europäischen Rechtseinflüsse widersprüchlicher und komplexer. Durch den weiten Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten können die einzelnen Rechtsordnungen auch nur beschränkt aneinander angeglichen werden. Dies bestätigt auch Art. 1 Abs. 1 des EU-Vorschlages, wo lediglich von einem „Verbraucherschutz- Mindestniveau“ die Rede ist.
Eine Angleichung an internationales Recht, das bisher für Gewerbetreibende galt, scheint dem Schutz des Verbrauchers entgegenzustehen. Es kann nicht sein, daß der dem Großhändler gegenüber wirtschaftlich viel schwächere Verbraucher behandelt werden soll, wie bisher im Geschäftsleben heimische Handelspartner. Die zweimonatige Anzeigefrist nach dem Erkennen der Vertragswidrigkeit ist ebenfalls zu kurz, um einen effizienten Verbraucherschutz bewirken zu können.
Durch die neue Richtlinie wird der beim Gebrauchtwagenkauf bisher weithin übliche Gewährleistungsausschluß unmöglich gemacht. Besonders unangemessen ist das dann, wenn sich die Kaufsache schon vorher im Besitz des Käufers befunden hat, dieser somit die Sache besser kennt als der Verkäufer.
Ist eine Eigenschaft vereinbart, nach dem Vertrag vorausgesetzt oder wird eine gewöhnliche Verwendungseignung vorausgesetzt, muß nach der Richtlinie nicht unbedingt ein Vertrauen des Käufers bestehen. Zwischen Verbraucher und Gewerbetreibendem besteht jedoch immer ein Informationsgefälle, welches gerade die Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers bewirkt und welches auch ein entsprechendes Vertrauen erfordert. Leitet man hieraus im Einzelfall ein Argument des Verkäufers, sich seiner Verantwortung zu entziehen her, führt dies zu unnötigen Streitigkeiten und bringt den Verbraucher gegenüber einer juristisch effizient vertretenen Firma schnell in eine schwache Position.
Der Vorschlag enthält Lücken: Es bleibt offen, was gelten soll, wenn Mobilien als Zubehör von Immobilien mitverkauft werden (§ 314 BGB). Ebenso unklar ist die Rechtslage, wenn ein Händler als Vertreter des Eigentümers verkauft - sind doch nur berufsmäßige Verkäufe von der Richtlinie erfaßt. Nicht geregelt ist außerdem, was gilt, wenn eine Sache sowohl privat als auch beruflich genutzt werden soll. Überhaupt ist in Frage zu stellen, wieso ein Käufer im Falle eines Privatkaufes anders geschützt werden soll, als wenn er das Verbrauchsgut für geschäftliche Zwecke zu verwenden gedenkt. Genauso offen geblieben ist die Frage der Erfüllungsorte, welche gerade bei grenzüberschreitenden Transaktionen für den Verbraucher eine große praktische Bedeutung gehabt hätte.
Wenn eine Nachbesserung vollständig und ohne große Belästigung des Käufers gelingt, kann es diesem letztlich gleichgültig sein, ob nachgebessert oder nachgeliefert wird. Allein der Verkäufer kann beurteilen, welche Art der Nacherfüllung für ihn die einfachste ist, und er trägt ja auch das Risiko eines Fehlschlags der Nachbesserung. Mithin wäre es sachgerechter, wenn das Wahlrecht nicht dem Käufer, sondern dem Verkäufer zustände, wie es auch in § 438 des Entwurfes der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts geregelt ist.
Der Entwurf verletzt angeblich das Subsidiaritätsprinzip (Art. 3b II EGV) und beachtet den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3b III EGV) nicht ausreichend und geht deshalb über das für den Verbraucherschutz erforderliche Maß hinaus.
3.3 Abwägung
In den wesentlichen Punkten setzt der Richtlinienvorschlag dort an, wo es auch die meisten einzelstaatlichen Regelungen tun. Da er lediglich einen Mindestschutz vorgibt, steht es im Ermessen der Einzelstaaten, diesen noch zu intensivieren. Dem Argument, der Richtlinienentwurf vertrage sich nicht mit den bestehenden Richtlinien und internationalen Verträgen, ist daher nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Ebenso unwahr ist, daß es derzeit nur wenige grenzüberschreitende Transaktionen gebe. Und stimmte dies, könnte man diese Erscheinung darauf zurückführen, daß die verschiedenen Gesetzgebungen gerade so unterschiedlich ausgestaltet sind. Eine Erforderlichkeit könnte jedoch in Zweifel gezogen werden, wenn man bedenkt, daß auch ohne die Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten Bestrebungen zu einer Verbesserung des Mindestschutzes festzustellen sind. Eventuell hätte zur Erleichterung von Verbraucherkäufen über die Grenze statt einer Vereinheitlichung des Kaufrechts für Verbraucher auch eine sektorale Vereinheitlichung, wie sie das CISG für grenzüberschreitende Warenkaufverträge gewerblich tätiger Parteien gebracht hat, genügen können. Wegen der Distanz zum Kaufort bei grenzüberschreitenden Käufen, wäre eine Verbesserung des Verbraucherschutzes bereits damit zu erreichen, daß die Gewährleistungspflichten des Verkäufers als Bringschuld, die Kaufpreiszahlungspflicht des Käufers dagegen als Holschuld ausgestaltet würden. Außerdem hilft dem Verbraucher bereits jetzt Art. 14 EuGVÜ, wenn es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Auf der anderen Seite wäre es jedoch inkonsequent, in einem solch offensichtlichen Wandelungsprozeß stehenzubleiben und nicht den Wandel ebenfalls auf europäischer Ebene zu fördern.
Man könnte auch einlenken, daß aufgrund zu großer Unterschiede der einzelnen Rechtssysteme in Europa eine Harmonisierung nicht möglich ist. Jedoch war eine Harmonisierung des Handelskaufes im Wiener Kaufgesetz ebenfalls möglich, und diese war viel umfassender. Der bisher übliche Gewährleistungsausschluß bei Gebrauchtwagen soll nach der Richtlinie nicht mehr möglich gemacht werden können. Wenn der Käufer die Sache jedoch schon vorher in seinem Besitz gehabt haben sollte, ist der Verkäufer jedoch durch Art. 3 Abs. 1 geschützt, welcher besagt: „Der Verkäufer soll nicht haften, wenn der Käufer beim Kaufabschluß die Vertragswidrigkeit kannte oder über sie nicht in Unkenntnis sein konnte“. In Art. 2 Abs. 2 wird die Vertragsgemäßheit der Sache anhand von Beschaffenheit und dem gezahlten Preis bestimmt, was Einschränkungen bei gebrauchten Sachen rechtfertigt. Außerdem kann nach der Neufassung der Richtlinie die Gewährleistungsfrist beim Gebrauchtwagenkauf, wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen, durch Einigung zwischen Käufer und Verkäufer auf ein Jahr verkürzt werden. Dies ermöglicht zwar immer noch keinen Ausschluß der Gewährleistung, ist aber im Gegensatz zum ersten Richtlinienentwurf immerhin eine Verbesserung um 50%.
Unklar ist die Rechtslage, wenn ein Händler als Vertreter des Eigentümers verkauft - sind doch nur berufsmäßige Verkäufe von der Richtlinie erfaßt. Hier ist allerdings eine Möglichkeit zu sehen, den Gewährleistungsausschluß bei Gebrauchtwagen doch noch zu vereinbaren - der Händler in der Vertreterposition dient hier als offengehaltene Hintertür.
Für die Richtlinie angeführt wird ferner, daß sie eine Minderung von Wettbewerbsverzerrungen bewirken solle. Allerdings ist zu bezweifeln, daß ein deutscher Verbraucher im Grenzgebiet zu Holland und Belgien den Kauf in einem der beiden anderen Staaten vorzieht, weil ihm dessen Kaufrecht am transparentesten erscheint.
Einige Lücken bleiben offen, vor allem die Frage nach dem Erfüllungsort. Probleme, die bei dem Versuch entstehen, verbraucherrechtliche Fragen mit aus dem Handelsrecht stammenden Grundsätzen lösen (kurze Zweimonatsfrist) zu wollen, sind nach wie vor ungelöst. Auch für die Rechtswahl durch den Käufer könnte eine Überarbeitung notwendig sein.
Man sieht, die Richtlinie existiert noch nicht ohne Fehler. Die Neufassung sieht zwar in einigen wesentlichen Punkten Verbesserung vor und entkräftet allzu starke Kritiken, allerdings löst auch sie die Problematik eines europäischen Verbraucherrechtes nicht vollkommen. Trotzdem muß man ihr zugestehen, daß sie in ihrem Grundgerüst ein für das europäische Wachstum notwendiges Werkzeug ist, dem man sich nicht grundsätzlich in den Weg stellen sollte. Nach einer weiteren Überarbeitungsphase werden die Vorteile aller Wahrscheinlichkeit nach überwiegen, so daß es letztlich zu einer Durchsetzung der Richtlinie kommen kann.
4. Die Umsetzung der Richtlinie
4.1 Formelle Umsetzung
Für eine Umsetzung der Richtlinie kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht.
4.1.1 Erweiterung des BGB
Eine sicher recht gute Lösung wäre die Einfügung einiger neuer Vorschriften ins BGB.
Allerdings paßt die Definition des Verbraucherkaufs von Art. 1 des Vorschlags nicht zum Stil des BGB. Sie könnte am ehesten in abgekürzter Form am Anfang eines § 459a BGB stehen, an anderen Stellen würde ein Verweis hierauf genügen. Auch Art. 5 der Richtlinie, welcher ja bezüglich der Garantien auch vertragsfremde Personen betrifft, dürfte schwer einzugliedern sein. Im wesentlichen ist hierin aber nur ein Schönheitsfehler zu sehen, den man hinnehmen kann. Die übrigen Regelungen wären bei den §§ 459, 477 und 480 BGB unterzubringen.
Statt die neuen Regeln in das allgemeine Kaufrecht einzufügen, könnte man auch die mittlerweile sachlich überholten §§ 481-492 BGB über den Viehkauf durch eine bereits in Arbeit befindliche Neuregelung komprimieren und zudem eine kurze Regelung des Verbraucherkaufs dort unterbringen.
4.1.2 Selbständiges Gesetz
Möglich wäre auch ein eigenes Gesetz nach dem Muster des VerbrKrG. Allerdings bilden Kreditverträge keinen eigenen Vertragstyp im besonderen Schuldrecht, so daß sie schlecht mit dem Kauf zu vergleichen sind, welcher einen sicheren Standort im BGB hat. Außerdem reicht die Regelung über den Verbraucherkauf viel weniger weit, als die für den Kreditvertrag, so daß ein eigenes Gesetz nicht notwendig wäre.
4.2 Verknüpfung mit dem BGB
Die Richtlinie stellt die Mitgliedstaaten vor die Alternative, entweder ein besonderes Kaufrecht für Verbraucher zu schaffen, oder aber ihr gesamtes vorhandenes Kaufrecht zu reformieren. Würde tatsächlich ein neues Kaufrecht für Verbraucher entstehen, wäre dies nach dem Kaufrecht des BGB und dem Handelskauf nun schon die dritte Ebene des deutschen Kaufrechts. Das UN-Kaufrecht (CISG) wäre als vierte Ebene für grenzüberschreitende Warenkaufverträge zuständig, die nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Grundstrukturen und Zentralbegriffe des CISG und des Richtlinienentwurfes weichen allerdings erheblich von denen des BGB und des HGB ab, so daß eine grundsätzliche Reform des geltenden Kaufrechts befürchtet werden muß.
Es muß zum Beispiel geprüft werden, ob nicht im Kaufrecht die Sonderregeln für Handelskäufe entfallen und im BGB nur noch eine Zweiteilung von Verbraucherkaufverträgen auf der einen und sonstigen Kaufverträgen auf der anderen Seite behandelt werden soll.
Außerdem würde nach einer Umsetzung der Kaufrechtsrichtlinie das Kaufrecht aus dem Rahmen des bisherigen deutschen Verjährungsrecht völlig herausfallen. Die Verjährungsfrist für bewegliche Sachen wäre zum Beispiel dann länger als Verjährungsfristen für Werkleistungen oder den Immobilienkauf. Dieser Mißklang wird zu einer Überprüfung der gesamten Verjährungsfristen führen müssen, damit nicht das gesamte Verjährungsrecht aus seiner Bahn gerät.
Es gibt somit einige Widersprüche zwischen BGB und dem EU- Richtlinienvorschlag, die für Probleme bei der Eingliederung desselben in das deutsche Zivilrecht sorgen. Einige dieser Schwierigkeiten würden verschwinden, wenn der deutsche Gesetzgeber die von der EU geforderten Rechtsänderungen nicht nur auf den Verbraucher beschränken würde und insbesondere eine Änderung der Gewährleistungsfristen allgemein bestimmen würde. Auch die Verbesserung des Verkäuferregresses könnte allgemein angeordnet werden. Auf diese Weise ließe sich eine Absplitterung vom Zivilrecht und damit eine Verkomplizierung des Privatrechts vermeiden.
5. Abschliessende Zusammenfassung
Es bleibt zu sagen, daß die Richtlinie - trotz ihrer immer noch vorhandenen stellenhaften Fehlerhaftigkeit - einen weiteren Schritt zu einem einheitlichen Kaufrecht in der Europäischen Union darstellt. Innerhalb dieses Prozesses werden auch in der Richtlinie noch einige Lücken geschlossen werden. Sie will jedoch nicht das Kaufrecht vollständig regeln: Sie hat sich lediglich den Teil des verbraucherschutzrechtlichen Aspektes herausgegriffen, welcher den Bereich der Garantiehaftung und Mängelgewährleistung betrifft. Auch hier setzt sie lediglich eine Mindestvorgabe, bei der es den Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt, selbst strengere Regeln beizubehalten oder einzuführen. In der Mindestvorgabe liegt jedoch die Chance, daß Verbraucher sich auch bei grenzüberschreitenden Kaufgeschäften hinreichend abgesichert fühlen, und es auf lange Sicht so zu einer wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung des europäischen Marktes kommt, ohne daß die einzelstaatlichen Rechte zu sehr beschnitten werden. Eine weitergehende Angleichung mag in einem länger währenden Prozeß möglich sein.
LITERATURVERZEICHNIS
Arnold, Dirk Verbraucherschutz im Internet - Anforderungen an die Umsetzung der Fernabsatz-Richtlinie
Computer und Recht 1997, S. 526 ff.
(zitiert: Arnold, Verbraucherschutz im Internet, CR 97, 526)
CMLR Editorial Comments On the way to a European consumer sales law? Common Market Law Review 1997, S. 207 ff
(zitiert: Editorial Comments, CML Rev. 97, 207)
Cranston, Ross The Green Paper on guarantees CLJ 1995, S. 110 ff.
(zitiert: Cranston, The Green Paper on guarantees, CLJ 95, 110)
Dürrschmidt, Armin Werbung und Verbrauchergarantien: zur Notwendigkeit
einer Novellierung des § 13a UWG vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsentwicklung
Dissertation
München, 1997
(zitiert: Dürrschmidt, Werbung und Verbrauchergarantien, Diss. 1997, 97)
Heinrichs, Helmut Die EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
Neue Juristische Wochenschrift 1993, S. 1817 ff.
(zitiert: Heinrichs, Die EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, NJW 93, 1817)
Hoffmann, Dieter „Gerechtigkeitsprinzipien“ im Europäischen Verbraucherprivatrecht - Fortschreitende Privatrechtskodifikation als Teil des sozialen Europas
in: Krämer / Micklitz / Tonner (Hrsg.): Law and diffuse Interests in the European Legal Order / Recht und diffuse Interessen in der Europäischen Rechtsordnung
Liber amicorum Norbert Reich, S. 291 ff.
Baden-Baden, 1997/98
(zitiert: Hoffmann, Fortschreitende Privatrechtskodifikation, in: Festschrift Norbert Reich, 291)
Hondius, Edwoud Kaufen ohne Risiko: Der europäische Richtlinienentwurf zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1997, S. 130 ff.
(zitiert: Hondius, Kaufen ohne Risiko, ZEuP 97, 130)
Kötz, Hein Europäisches Vertragsrecht I Tübingen, 1996
(zitiert: Kötz, Europäisches Vertragsrecht I, 1996, 194)
Medicus, Dieter Ein neues Kaufrecht für Verbraucher?
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1996, S. 1925 ff.
(zitiert: Medicus, Ein neues Kaufrecht für Verbraucher?, ZIP 96, 1925)
Pescatore, Pierre Le recours, dans la jurisprudence de la cour de justice des Communautotés Européennes, a des normes déduites de la comparaison des droits des états membres
Revue international de droit comparé 1980, S. 337 ff.
(zitiert: Pescatore, Le recours, dans la jurisprudence de la cour de justice des Communautotés Européennes, a des normes déduites de la comparaison des droits des états membres Revue international de droit comparé 80, 337)
Reich, Norbert Garantien unter Gemeinschaftsrecht
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1995, S. 71 ff.
(zitiert: Reich, Garantien unter Gemeinschaftsrecht, EuZW 95, 71)
Reich, Norbert Europäisches Verbraucherrecht: Eine problemorientierte Einführung in das europäische Wirtschaftsrecht, S. 401 ff
3. Auflage
Baden-Baden, 1996 (zitiert: Reich, Europäisches Verbraucherrecht, 1996, 401)
Reich, Norbert Die neue Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1997, S. 581 ff.
(zitiert: Reich, Die neue Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucher- schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, EuZW 97, 581)
Scherpe, Jens M. Haustürgeschäfte in Dänemark Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1997, S. 1078 ff.
(zitiert: Scherpe, Haustürgeschäfte in Dänemark, ZEuP 97, 1078) Schlechtriem, Peter Verbraucherkaufverträge - ein neuer Richtlinienentwurf Juristenzeitung 1997, S. 441 ff.
(zitiert: Schlechtriem, Verbraucherkaufverträge - ein Richtlinienentwurf, JZ 97, 441) im Anschluß daran: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla- ments und des Rates über den Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter Juristenzeitung 1997, S. 446 ff.
(zitiert: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter, JZ 97, 446)
Schmidt-Räntsch, Jürgen Zum Stand der Kaufrechtsrichtlinie Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, S. 849 ff.
(zitiert: Schmidt-Räntsch, Zum Stand der Kaufrechtsrichtlinie, ZIP 98, 849) Schmidt-Salzer, Joachim Transformation der EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherkaufverträgen in deutsches Recht und AGB-Gesetz Betriebs-Berater 1995, S. 733 ff.
(zitiert: Schmidt-Salzer, Transformation der EG-Richtlinie über miß- bräuchliche Klauseln in Verbraucherkaufverträgen in deutsches Recht und AGB-Gesetz, BB 95, 733) Schnyder, Anton K. (mit Straub, Michael)
Das EG-Grünbuch über Verbrauchsgütergarantien und Kundendienst - Erster Schritt zu einem einheitlichen EG-Kaufrecht?
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1996, S. 8 ff.
(zitiert: Schnyder / Straub, Das EG-Grünbuch überVerbrauchsgütergarantien und Kundendienst, ZEuP 96, 8)
Straub, Ralf Michael s. Schnyder, Anton K.
ZIP-aktuell BR-Rechtsausschuß zum EU-Richtlinienvorschlag zum Verbraucherkauf
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1996, S. XIV
(zitiert: BR-Rechtsausschuß zum EU-Richtlinienvorschlag zum Verbraucherkauf, ZIP-aktuell 96, XIV Nr. 259, 2 c)
ZIP-Dokumentation Richtlinienvorschlag zum Verbraucherkauf Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1996, S. 1845 ff.
(zitiert: Richtlinienvorschlag zum Verbraucherkauf, ZIP 96, 1845)
ZIP-Dokumentation Politische Festlegung des gemeinsamen Standpunktes zum Verbrauchsgüterkauf
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, S. 889 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck der Richtlinie zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie in der Europäischen Union?
Die Richtlinie zielt darauf ab, Verbrauchern in der gesamten Europäischen Union einen einheitlichen Mindestschutz zu garantieren, insbesondere im Hinblick auf die Qualität gekaufter Waren und das Funktionieren von Garantien.
Welche Vorteile soll die Richtlinie bringen?
Die Richtlinie soll Hemmnisse für Käufe im Ausland beseitigen, indem sie sicherstellt, dass Verbraucher unabhängig vom Standort des Anbieters gleiche Garantie- und Kundendienstkonditionen erhalten. Sie soll auch Unternehmen helfen, ähnliche Regelungen für ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen in verschiedenen Mitgliedstaaten zu treffen.
Was versteht man unter dem Begriff "Verbraucher" im Kontext dieser Richtlinie?
Ein Verbraucher ist eine natürliche Person, die zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Es handelt sich also um den privaten Letztverbraucher.
Was gilt als "Verbrauchsgut" gemäß der Richtlinie?
Ein Verbrauchsgut ist jedes in der Regel für den Letztverbrauch oder zur Letztverwendung bestimmte bewegliche Erzeugnis mit Ausnahme von Immobilien, Gütern, die aufgrund von Zwangsvollstreckung verkauft werden, Wasser und Gas (sofern nicht in Behältnissen abgefüllt), und Strom.
Was sind die Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit eines Verbrauchsguts?
Ein Verbrauchsgut muss dem Kaufvertrag entsprechen. Das bedeutet, dass es mit den Beschreibungen des Verkäufers, mit Proben oder Mustern übereinstimmen muss, für die Zwecke geeignet sein muss, für die derartige Erzeugnisse gewöhnlich gebraucht werden, und eine zufriedenstellende Qualität und Leistung aufweisen muss.
Welche Rechte hat der Verbraucher, wenn das Verbrauchsgut nicht vertragsgemäß ist?
Der Verbraucher hat das Recht auf Nachbesserung, Nachlieferung fehlerfreier Ware, Minderung des Kaufpreises oder Auflösung des Vertrages.
Was ist der Unterschied zwischen der gesetzlichen und der kommerziellen Garantie?
Die gesetzliche Garantie ist ein Recht der Sachmängelgewährleistung, das sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt. Die kommerzielle Garantie ist eine freiwillige Zusage des Garantiegebers (Verkäufers oder Herstellers), für bestimmte Mängel zu haften, die an der verkauften Sache auftreten können.
Welche Fristen sind im Rahmen der gesetzlichen Garantie zu beachten?
Der Verkäufer haftet für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Übergabe besteht und binnen zwei Jahren von diesem Zeitpunkt an offenbar wird. Der Käufer muss dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit innerhalb eines Monats (Neufassung: zwei Monate) nach Feststellung des Mangels anzeigen.
Welche Anforderungen werden an kommerzielle Garantien gestellt?
Kommerzielle Garantien müssen die Lage des Begünstigten verbessern, schriftlich vorliegen, vor dem Kauf einsehbar sein und die wesentlichen Elemente für ihre Inanspruchnahme unmissverständlich enthalten. Sie müssen außerdem darlegen, dass der Verbraucher bereits im Rahmen der einzelstaatlichen Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf Rechte hat, welche von der Garantie nicht berührt werden.
Welchen zwingenden Charakter hat die Richtlinie?
Vertragsklauseln oder Vereinbarungen, die die durch die Richtlinie gewährten Rechte außer Kraft setzen, sind für den Verbraucher nicht bindend. Lediglich für den Kauf von Gebrauchtwagen darf man sich nach der Neufassung der Richtlinie auf eine weniger lange Haftfrist für den Verkäufer einigen, welche jedoch ein Jahr nicht unterschreiten darf.
Welche Einzelstaatsrechte bleiben erhalten und welchen Mindestschutz muss die Richtlinie gewährleisten?
Der nationale Gesetzgeber kann den EU-Vorschlag nur in ausdrücklich bezeichneten Grenzen einschränken, die Stellung des Käufers kann auf nationaler Ebene ohne weiteres verbessert werden. Art. 1 Abs. 1 des EU-Vorschlages spricht lediglich von einem „Verbraucherschutz- Mindestniveau“.
Welche Auswirkungen hat die Richtlinie auf das deutsche Recht?
Die Richtlinie erweitert das Arsenal der gesetzlichen Mängelrechte des BGB um die Möglichkeit der Nachbesserung. Die Frist des § 477 BGB wird von sechs Monaten auf zwei Jahre vervierfacht. Die Richtlinie enthält ebenfalls Regelungen für einen objektiven Qualitätsstandard.
- Arbeit zitieren
- Ramona Kann (Autor:in), 1998, Verbraucherkauf in der EU, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95999