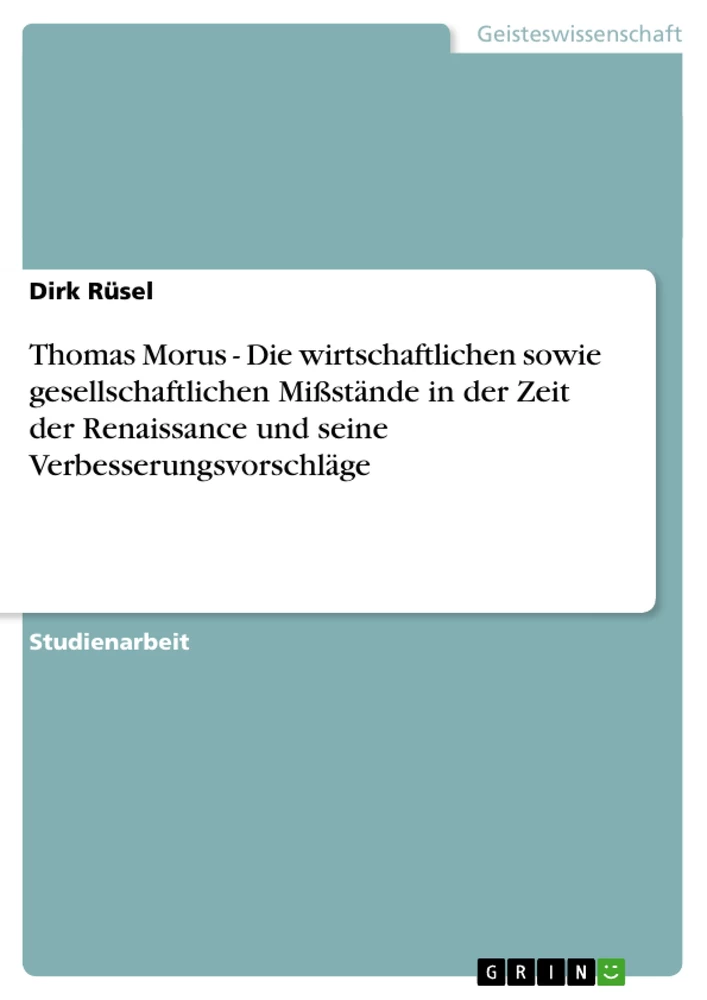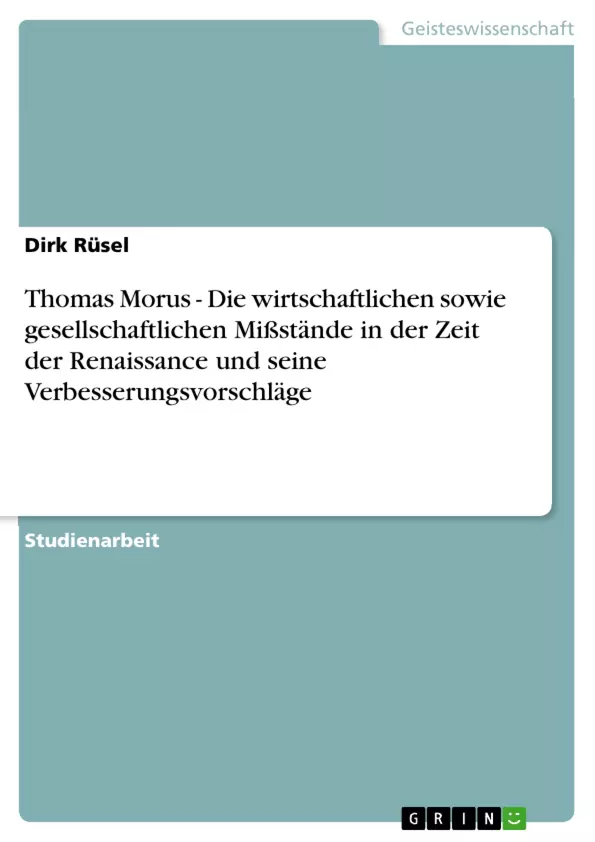Was wäre, wenn eine perfekte Gesellschaft existierte, ein Ort, an dem Armut, Ungerechtigkeit und Leid der Vergangenheit angehören? Thomas Morus' "Utopia" entführt den Leser in eine faszinierende Welt, in der soziale Harmonie, wirtschaftliche Gleichheit und philosophische Vernunft das Fundament einer idealen Staatsordnung bilden. Doch ist dieses Utopia wirklich so erstrebenswert, wie es auf den ersten Blick scheint? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Erzählung, die die politischen und gesellschaftlichen Missstände der Renaissance aufdeckt und gleichzeitig revolutionäre Lösungsansätze präsentiert. Begleiten Sie den Seefahrer Raphael Hythlodeus auf seiner Entdeckungsreise zu einer fernen Insel, auf der das Privateigentum abgeschafft, die Arbeit gerecht verteilt und die Bildung allen zugänglich ist. Erleben Sie, wie die Utopier ihr Leben in einer Gemeinschaft gestalten, die von gegenseitigem Respekt, Bescheidenheit und dem Streben nach Wissen geprägt ist. Doch hinter der glänzenden Fassade dieser idealen Welt verbergen sich auch dunkle Schattenseiten: Überwachung,Uniformität und der Verzicht auf individuelle Freiheit. Ist der Preis für soziale Gerechtigkeit die Aufgabe der persönlichen Entfaltung? "Utopia" ist mehr als nur ein Roman; es ist eine tiefgründige philosophische Untersuchung über die Natur des Menschen, die Grenzen der Vernunft und die Möglichkeiten einer besseren Zukunft. Entdecken Sie ein zeitloses Meisterwerk, das auch heute noch zum Nachdenken anregt und uns dazu auffordert, unsere eigenen Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Strukturen kritisch zu hinterfragen. Erforschen Sie die komplexen Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Ethik in einer Welt, in der das Streben nach dem Ideal zur bitteren Realität werden kann. Lassen Sie sich von Morus' Vision einer besseren Welt inspirieren und stellen Sie sich der Frage, ob Utopia wirklich ein Ort ist, an dem wir leben möchten. Dieses Buch ist eine intellektuelle Reise, ein gesellschaftliches Experiment und eine persönliche Herausforderung zugleich – ein Muss für alle, die sich für Philosophie, Geschichte, Politik und die Zukunft der Menschheit interessieren. "Utopia" ist nicht nur ein Buch, sondern ein Spiegel, der uns unsere eigenen Ideale und Widersprüche vor Augen führt.
Inhaltsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffserklärungen
2.1 Die Renaissance
2.2 Der Begriff der Utopie
2.3 Der Begriff der Vernunft
3. Die Renaissance
3.1 Das allgemeine Staats- und Wirtschaftsbild dieser Zeit
3.2 Philosophisches Gedankengut dieser Zeit
4. Utopia, das erste Buch
4.1 Zusammenfassung des ersten Buches
4.2 Kritik an der ökonomischen Situation
5. Utopia, das zweite Buch
5.1 Zusammenfassung des zweiten Buches
5.2 Morus´ Verbesserungsvorschläge
6. Schlußbemerkung
Anhang
Literaturverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Der Autor Thomas Morus
1.Einleitung
Jedem Menschen schwebt irgendwann einmal in seinem Leben ein Bild von einer optimalen Staatsverfassung und im Vergleich zu seiner momentanen Lebenssituation besseren Lebensform vor. Oft werden Zukunftsschlösser errichtet, die bei genauerer Betrachtung mehr oder weniger praktikabel erscheinen. Der Humanist Thomas Morus versucht in seinem Buch ,,Utopia" die sozialen und wirtschaftlichen Mißstände darzustellen und gleichzeitig in Form einer idealen Welt die von ihm aufgedeckten Mißstände zu vermeiden. Er prangert die derzeitige Gesellschaft durchaus geschickt, humoristisch wie zynisch an. Seine Botschaft teilt er in Form einer Fabel mit, so daß sich keiner der damaligen Herrscher angegriffen fühlen mußte. Zusätzlich verschafft er sich Distanz durch kritische Zwischenfragen der beiden zusätzlichen Antagonisten.
Übersetzt man die griechischen Namen der Akteure, läßt er den Raphael Possenkundig(Hythlodeus) vom StaateNirgendland(Utopia) berichten, mit der Hauptstadt ,,Schall und Rauch"(Amaurotum) am FlusseWasserlos(Anydrus), erobert und geformt vom KönigOhne-Land(Utopos) und regiert vom PräsidentenOhne-Volk(Tranibor)[1]. Noch heute stellt sich die Frage was Morus eigentlich mit diesem Werk bezwecken will. Ist die ,,Utopia" nur eine Satire der damaligen Zeit? Will er mit dem Bild des utopischen Gemeinwesens die damaligen Mißstände verdeutlichen? Oder sind die utopischen Einrichtungen erste ernsthaft gemeinte Revolutionsgedanken?
Zu der Zeit als das Werk verfaßt wurde [1516 n.Chr.] stand die Renaissance noch am Anfang. Die politischen und ökonomischen Reformationen hätten noch friedlich vollzogen werden können. Einen Umsturz des nationalen Gefüges, wie die Französische Revolution, wird zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch kein Mensch in Erwägung gezogen haben. Den Humanisten Morus werde ich in dieser Arbeit nicht weiter erläutern. Aspekte wie ,,Selbstbefreiung des Denkens", ,,Ablösung der Kirche als allein herrschende Macht" ,,Vernünftige Wissenschaft" und vor allem der Betrachtung der Rechtsprechung sind bewußt vernachlässigt worden, obwohl diese Begriffe entscheidend für den geistigen und weltlichen Umbruch in der Renaissance darstellen. Trotzdem werden diese, soweit es für den wirtschaftlichen Aspekt erwähnenswert erscheint, näher erläutert.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die von Morus in seinem Werk aufgeführten Mißstände, sowie die dementsprechenden Verbesserungsvorschläge, zu verdeutlichen, in einen wirtschaftlichen Zusammenhang einzuordnen und den utopischen Staat auf Praktikabilität zu untersuchen.
2. Begriffserklärungen
2.1 Die Renaissance
,,Renaissance"[frz.: Wiedergeburt] bezeichnet im allgemeinen den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit (ca.14.-16. Jahrhundert), oder im engeren Sinne, die kunstgeschichtliche Epoche des 15./16.Jahrhunderts. In dieser Epoche, in der der Mensch seinen Geist frei entfalten konnte, entstand das Bild vom Menschen als Individuum. Diese Art des neuen Denkens wirkte sich sowohl auf die Naturwissenschaften als auch auf Philosophie und Literatur aus. Die Anfänge der Renaissance fanden sich in den Stadtstaaten Mittelitaliens, vor allem in Florenz. Aus der Renaissance entstand die Neuzeit.
2.2 Der Begriff der Utopie
Der Begriff der ,,Utopie" stellt einen Begriff vor allem der Neuzeit dar.
Thomas Morus benutzt als erster Autor den Begriff in seinem StaatsromanDe optimo rei publicae statu, deque noua insula Vtopia(1516).
Utopie[griech.] ist ein dem Kunstwort ,,Utopia" (,,Nirgendort", ,,Nicht-Platz") nachgebildetes Substantiv aus der Negation ,,ou"[griech.: nicht] und dem Substantiv ,,topos" [griech.: Platz]. Dieser dient zur Erfassung 1. einer, die Realitätsbezüge ihrer Entwürfe, bewußt oder unbewußt vernachlässigenden Denkweise, sowie 2. einer literarischen Denkform, in der Aufbau und Funktionieren idealer, alternativer Gesellschaften und Staatsverfassungen eines räumlich und/oder zeitlich entrückten Ortes, oft in Form fiktiver Reiseberichte, konstruiert werden.
Vor allem in den Utopien des 16. und 17. Jahrhunderts rücken die von den Autoren erfahrenen Defizite der aktuellen Gesellschaft in den Vordergrund.
Hauptproblem der Autoren war das der politischen Ordnung und der sozialen Gerechtigkeit. Bevorzugte Gattung der literarischen Utopie ist der utopische Roman, in dem meist ein in den Augen des Verfassers ideales Gegenbild zu den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der jeweiligen Gegenwart entworfen wird.
Als Vorbild dieser literarischen Richtung gilt Platon(,,Politea", etwa 374 v. Chr.).
Ihm folgten neben Thomas More, Tommaso Campanella(,,Der Sonnenstaat", 1623), Francis Bacon(,,Neu-Atlantis", 1627), Jonathan Swift(,,Gulliver´s travels", 1726), E. Cabet(,,Reise nach Ikarien", 1842) etc.. Durch die im 19. Jahrhundert einsetzende technisch-naturwissenschaftliche Entwicklung kommt der durch Jules Verne geprägte Begriff derScience-fictionauf. Im folgenden 20. Jahrhundert überwiegen dieAntiutopien, in denen Schreckensversionen einer totalitär beherrschten Gesellschaft überwiegen, wie z.B. in Orwell, George(,,1984", 1949).
2.3 Der Begriff der Vernunft
Vernunft beschreibt das menschliche Vermögen, sinnliche Wahrnehmungen geistig zu verarbeiten, Dinge und Erscheinungen in ihrem Zusammenhang zu begreifen.
Die Philosophen der Renaissance benutzen den Begriff mehr naturwissenschaftlich und sahen jegliche menschliche Handlungsweisen als vernünftig an, die nicht wider der Natur waren. Als vernünftig gilt, was wissenschaftlich und mathematisch erkannt werden kann.
3. Die Renaissance
3.1 Das allgemeine Staats- und Wirtschaftsbild dieser Zeit
Das Staatsbild der Renaissance stellt sich vor allem durch die aus der Trennung von Kirche und Staat hervorgegangenen, zentralisierten Territorialstaaten oder Stadtstaaten(z.B. Florenz) dar. Diese werden absolutistisch von Fürsten oder Königen beherrscht. Als Zeichen der königlichen Macht werden prunkvolle Schlösser errichtet, in dem ein großer Hofstaat beschäftigt wird. Weiterhin werden große, stehende Heere errichtet, die die königliche Macht nach innen und außen repräsentieren. Das wirtschaftliche Handeln dieser Zeit ist ebenfalls durch einen Umbruch geprägt. Der Schwerpunkt ökonomischen Handels verlagert sich von der Agrarwirtschaft auf den Handel, Industrie und das aufkommende Finanzwesen (Banken, Börsen). Dieser wirtschaftliche Zeitabschnitt findet seinen Höhepunkt im aufkommenden ,,Merkantilismus", der wirtschaftspolitisch besonders die Förderung des Handels, Gewerbes und Industrialisierung gekennzeichnet wird[2].
3.2 Philosophisches Gedankengut dieser Zeit
Die europäische Philosophie dieser Zeit ist sehr naturwissenschaftlich geprägt. Selbst die verschiedenen Strömungen der Philosophie versuchen ihr Weltbild auf eine verwandte Weise darzustellen. Durch diese naturwissenschaftliche und mathematische Strömung verliert die Kirche Einfluß am weltlichen Leben. Es tritt der individuelle Mensch in den Vordergrund und die alte feudale Gesellschaft (Mittelalter) wird angezweifelt.
Aus diesem gemeinsamen Grundstrukturen entwickeln sich drei wesentliche Richtungen. Eine Richtung favorisiert ein idealsozialistisches Gemeinwesen mit der völligen Abschaffung des Privateigentums. Bedeutende Vertreter dieser Denkrichtungrichtung sind Thomas Morus (1478-1535)
und Tomaso Campanella (1568-1639).
Eine zweite Richtung sieht den Menschen als egoistisches Individuum, welches von einer oberen Instanz gelenkt werden muß, da Sittlichkeit, Anstand und Gemeinwesen nicht angeboren sind. Aus diesem Grunde muß ein Staat absolutistsich von einen Regierungsorgan geführt werden. Einen philosophischen Vertreter dieser Richtung stellt Thomas Hobbes (1588-1679) dar.
Ein ausgeprägtes, zum staatlichen Überleben notwendiges, nationales Zusammengehörigkeitsgefühl steht bei der dritten Richtung im Vordergrund, für die Niccolo Macchiavelli (1469-1527) eintritt[3].
4. Utopia, das erste Buch
4.1 Zusammenfassung des ersten Buches
Das erste Buch beschreibt ein Gespräch zwischen Thomas Morus und einem Freund, Petrus Ägidius, einerseits und Raphael Hythlodeus, einem weitgereisten Philosophen. Hythlodeus zeigt sich - nach langer Abwesenheit vom Abendland - sehr irritiert und erstaunt über die in seinen Augen mißratene Politik der damaligen Gesellschaft. Er zeigt viele Mißstände in Politik, Staats- und Finanzwesen auf und bringt zugleich treffende Verbesserungsvorschläge. Mißstände, die ihm bei diesem Gespräch besonders am Herzen liegen sind das damalige Strafrecht und konsequente Ausnutzung des Volkes.
Thomas Morus und Petrus Ägidius versuchen Raphael zu überzeugen, daß es doch überaus hilfreich und förderlich für ihn und die gesamte Volkswirtschaft seih, den Beruf des Staatsmannes oder Fürstendiener in einer beratenden Funktion zu ergreifen. Doch Raphael widerstrebt es völlig diesen Weg einzuschlagen, da es aus sich seiner Sicht unmöglich darstellt, den Beruf des Philosophen und Gelehrten mit dem des Staatsmannes zu vereinen. An einem Beispiel seiner Erfahrungen am Hofe des englischen Kardinals John Morton belegt er ausführlich seine Überzeugung[4]. Im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtet Raphael noch anhand von drei weiteren Formen der Staatsverfassung, die er auf seinen Reisen kennengelernt hat. Viele Staatsorganisationen, die bei anderen Völkern erfahren hat, stellten sich aus seiner Perspektive sozialer und gerechter dar, doch die optimale Staatsorganisation in Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und wohlgeordnetem bürgerlichen Gemeinwesen hat er bei dem Volk auf der Insel Utopia kennengelernt, bei dem er fünf Jahre in dessen Hauptstadt gelebt hat. Zum Ende des ersten Buches kommt Raphael zu dem Schluß, daß das Privateigentum das zentrale Hindernis an einer gerechten Politik und Staatsorganisation sei.
4.2 Kritik an der ökonomischen Situation
Morus spricht in dem ersten Buch zwei wesentliche ökonomische Mißstände an: die Unterdrückung der Bauern und Bürger durch das Fürstentum und die finanzielle Mißwirtschaft.
Die Ökonomische Situation stellt sich aus mehreren oligopolartigen Märkten zusammen, die ausnahmslos von wenigen Fürsten und Adeligen beherrscht werden. Den Bauern wird Land enteignet und dieses mit Viehzucht weitergenutzt. Durch diesen Umstand resultiert ein Preisanstieg der anderen landwirtschaftlichen Produkte. Dieser Umstand beinhaltet aber nicht, daß die Preise der ausgedehnt geförderten landwirtschaftlichen Produkte sinken. Denn diese Produkte werden in den Händen der Fürsten und Herrscher einbehalten bis sie die geforderten Preise erzielen. Es entstehen erste monopolistische Strukturen[5]. Man könnte auch von einer Art ,,informellem Kartell" sprechen.
Eben durch diese fürstlichen Machenschaften wird die Verelendung und Kriminalität des Volkes nicht nur verstärkt, sondern der Staat auch langsam aber sicher zermürbt. Das untertänige Volk beobachtet natürlich das Ausnutzen ihrer Arbeitskraft und eine allgemeine Unzufriedenheit breitet sich aus. Trotz dem Machtstreben der Fürsten folgt aber dennoch eine Landflucht. Ehemalige Bauern, arbeitslose Handwerker und Söldner ziehen zu den Hofstaaten der Fürsten um sich dort in Abhängigkeit zu begeben und mit dem Risiko bei dem Tode des Fürsten oder einem ,,In Ungnadefallen" ohne jegliches Auskommen leben zu müssen. Folglich sind diese wiederum bei derartigen widrigen Umständen gezwungen, wenn sie überleben wollen, zu stehlen oder sich auf die Wanderschaft zu begeben und eine neue Bleibe zu suchen[6]. Damit wäre ein Teufelskreis der Armut aufgrund mangelnder beruflicher Fähigkeiten und einem in einseitiger Abhängigkeit geführtem Lebenswandel geschlossen. Der nächste, von Raphael beobachtete, nicht erstrebenswerte Zustand behandelt die Finanzwirtschaft. Die Finanzen des Staates werden durch Steuern eingenommen, die entweder generell erhoben werden oder zu einem besonderen Anlaß, z.B. Krieg oder Bau eines neuen Schlosses, zusätzlich erhoben werden.
Jegliche Bediensteten des Fürsten und Staatsdiener beraten die Oberhäupter nur der Richtung, in welcher Art und Weise das Volk am effektivsten ausgenommen werden kann. Eine soziale Gerechtigkeit wird überhaupt nicht einbezogen. Selbst Richter stehen im Bann dieser Verschwörung und unterstützen den Aufbau stehender Heere sowie die Sicherung prunkvollen Lebens zu Hofe. Dies alles geschiet unter dem Vorwand gottgebebener königlicher Macht[7]. Bei dieser absolutistischen Staatsführung wird nicht die Produktivität bedacht. Das Volk wird gebraucht um den Staat mit seinem Einrichtungen zu finanzieren. Staatliche Programme zur Wohlfahrtsförderung oder zur Steigerung der Produktivität der Produktion, auf dem Agrarsektor oder in der beginnenden Industrialisierung des Handwerks, werden nicht unternommen. Es werden keine Ausgaben für friedliche Zwecke getätigt, sondern nur der hohe Lebensstandard zu Hofe und Kriege finanziert um Macht zu repräsentieren und weiter auszubreiten.
Der letzte, eigentlich alles überwiegende und ursächliche Mißstand ist das Privateigentum. Denn ohne Privateigentum wäre das Streben nach Geld, Macht, Vergnügen und prunkvoller Kleidung nicht existent. Die Bevölkerung würde nicht für diese niederen Zwecke von Fürsten, die es in einem Staatsgebilde ohne Privateigentum als solche gar nicht in Erscheinung treten würden, ausgenutzt. Somit wäre die gesamte Bevölkerung versorgt. Kriege zu Ausweitung der Macht müßten ebenfalls nicht mehr ausgetragen werden. Das Übel des bestehenden Gemeinwesens wäre quasi mit diesem Schritt schon im Keim erstickt. Es kann nirgendwo, wo noch Privateigentum existiert, eine gerechte und erfolgreiche Politik betrieben werden, da noch alles nach dem Wert des Geldes bemessen wird[8].
5. Utopia, das zweite Buch
5.1 Zusammenfassung des zweiten Buches
Raphael beginnt das zweite Buch mit der Lage der Insel und ihrer Entstehung. Die Insel Utopia ist vor langer Zeit von einem König namens ,,Utopos" erobert worden. Dieser hat die vormalige Halbinsel zur Insel umarbeiten lassen und erzog von fortan das nun von der alten Welt abgenabelte Volk zu einer außergewöhnlichen Bildung und Gesittung. Die zum Zeitpunkt der Erzählung bestehende halbmondförmige Insel Utopia ist von 54 Städten besiedelt, die alle fast ähnlich aufgebaut sind. Die Hauptstadt wird Amaurotum genannt. In Utopien wird das Prinzip der absoluten Gleichheit gelebt. Die Insel gleicht einer riesigen Hauswirtschaft in der alle die gleichen Pflichten haben, die gleiche Kleidung tragen, zur selben Zeit arbeiten, formgleiche Wohnungen bewohnen, zur selben Zeit gemeinsam Mahlzeiten einnehmen und Geld überhaupt nicht existiert.
Jeder Bewohner der Insel muß einen zweijährigen, militärisch organisierten Arbeitsdienst auf dem Land leisten. Die Utopier leben einen sehr bescheidenen Lebenswandel, wobei jegliches Privateigentum nicht vorhanden ist, selbst Türen zu den Privatwohnungen sind nicht verschließbar. Privatsphäre in jeglicher Hinsicht ist nicht verhanden. Aus jeder Familie geht ein Phylarch [griech.:Aufseher] hervor, der die Verantwortung für diese trägt und ebenfalls ihre Belange vertritt. Die Weiterführende Staatsorganisation ist wie das übrige utopische Leben sehr geometrisch geordnet und schließt jegliche Form von Machtmißbrauch aus.
Der Staatspräsident wird auf Lebenszeit gewählt.
Im Staate Utopia unterliegt der gesamte Lebens-, und Tagesablauf der Bevölkerung einem festen Plan. Kein freies Mitglied der Bevölkerung genießt irgendwelche zusätzlichen Voroder Nachteile. Sklaven oder zur besonderen Arbeitsleistung verurteilte leben in ausgewiesenen Lagern. Jegliche Form des Zusammenlebens ist bis ins Detail durch wenige Gesetze durchdacht. Verstöße oder Unregelmäßigkeiten werden vorerst nicht hart bestraft, sondern es wird ein Ausschluß aus der Gemeinschaft oder Arbeitsdienst vorgesehen. Wiederholte Straftaten werden mit dem Tode bestraft, denn die utopische Gesellschaft kann nicht verstehen, daß in einem solchen Gemeinwesen, trotz dieses optimal geregeltem Zusammenlebens, immer noch Ausbrüche vorkommen.
Einen besonderen Stellenwert wird der Entwicklung des Geistes in der sonst stationären Gesellschaft zugeschrieben. Jeder Bürger Utopias ist angehalten seine Freizeit sinnvoll, möglichst in geistiger Weiterbildung, zu gestalten. Sie sind bemüht Neuerungen und Erfindungen anderer Völker und Staaten kennenzulernen. Die Vernunft spielt eine herausragende Rolle in ihrem Leben. Triebe wie Lust, Haß, Vergeltungsstreben oder Gewalt liegen der utopischen Bevölkerung fern. Jegliche Handlungsweisen, sei es die zwischenmenschliche Beziehung, z.B. die Ehe, oder die staatliche Kriegsführung, stellen wohlüberlegte Schachzüge dar, die von der Bevölkerung akzeptiert und gelebt werden. Die Erzählung endet offen, mit einer Bemerkung Morus´, daß sicherlich viele Einrichtungen in Utopia sinnvoller als in der übrigen Welt gestaltet sind, welche er aber damit anspricht wird dem Leser vorenthalten.
5.2 Morus´ Verbesserungsvorschläge zum optimalen Staatsbild
Morus hat in der ,,Utopia" einen Staat geschaffen in der das Privateigentum gänzlich abgeschafft ist. Um diesen Staat funktionsfähig erscheinen zu lassen fügt er viele Instrumente in die Erzählung ein, die dem Staat politisch und wirtschaftlich funktionieren helfen sollen. Ich beginne mit der Produktion und der Versorgung der Bevölkerung. In den Städten werden Speicher betrieben, in denen die nötigen ländlichen und städtischen handwerklichen Erzeugnisse gelagert werden und von den Phylarchen unentgeltlich angefordert werden können. Für den Bereich der Lebensmittel sind Märkte eingerichtet, an denen die Köche für die gemeinsamen Mahlzeiten der Familien den Bedarf ebenfalls unentgeltlich decken. Anforderungen über einzelne Bürger sind zwar erlaubt aber unschicklich und finden nach Morus nicht statt[9]. Die Produktion wird regional und überregional durch die Syphogranten und Protophylarchen nach Art, Menge und Bedarf beschlossen und ein Produktionsplan erstellt. Einzelne Unterdeckungen des Bedarfs werden durch eben dieses Senatsinformationssystem wieder ausgeglichen. So besteht eine ständige Verbindung von der Obrigkeit zur Basis, in der Informationen regelmäßig in beide Richtungen fließen und eine schnelle Reaktionsfähigkeit gewährleistet ist. Überproduktion wird exportiert und Mangelware importiert[10].
Sicherlich kommt bei dieser Schilderung des utopischen Lebenswandels schnell der Gedanke auf, daß einige Bürger sich aus diesem Solidarsystem zurückziehen können. Denn für eine ausreichende Versorgung ist ja gesorgt.
Doch wer sich von der Arbeit zurückzieht, wird von den gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschlossen und geächtet. Selbst diejenigen, die sich auf der Reise befinden, sind angehalten, an dem jeweiligen Aufenthaltsort ihren Beitrag zum täglichen Arbeitspensum beizutragen.
Bei einem Mißachten der Regeln tritt der staatliche Regelmechanismus in Gang und bestraft Zuwiederhandlungen.
Als zweiten Arbeitsmotivationsgrund nennt Morus die Erziehung, die der Bevölkerung von Kind an unterzogen wird.
Jeder arbeitet pro Tag nur sechs Stunden und hat den verbleibenden Rest des Tages, neben den gemeinsamen Mahlzeiten, frei zur sinnvollen freien Verfügung. Jeder Bürger stellt ein Rad im utopischen Uhrwerk dar. Fällt eines aus, steht das Uhrwerk still. Morus setzt diese Einsicht beim utopischen Volk aufgrund der gelehrten Vernunft voraus. Die Vernunft spiegelt sich ebenfalls stark in der Innen- und Außenpolitik wieder. Die Utopier leben in einem Staat der durch Volksvertreter oder Ältestenvertretung geführt wird. Die Mitgliedschaft im Senat werden teilweise täglich ausgewechselt und Behörden werden jährlich neu besetzt. Es findet kein Senatsbeschluß oder Behördenentscheid ohne die Anhörung und vorherige Information des Volkes statt.
Utopia folgt dem späteren Grundsatz: ,,Der Staat ist das Volk"[11].
Innerhalb der Familien, die nicht mehr als vierzig Männer und Frauen umfassen, herrscht eine klare männerdominierende Hierarchie. Größere Familien werden entweder in andere Familien eingegliedert oder in Kolonien umgesiedelt. Somit ist eine Machtergreifung durch einige wenige Familien ausgeschlossen.
Die Bevölkerungspolitik ist an einen geometrischen Grundsatz gebunden. Übertrifft eine Stadt eine bestimmte Einwohnerzahl werden bestimmte Familien in Kolonien umgesiedelt, wo das utopische Leben weitergelebt wird.
In diesem Punkt ist ein agressive Bevölkerungspolitik versteckt geschildert. Denn den Einheimischen der Kolonien wird die utopische Lebensweise aufgezwungen.
Die Kolonialisierung durch die Utopier stellt eine verschönerte Form des Kriegs- und Eroberungsbegriffes dar. Bei diesem gelebten utopischen Gemeinwesen kann, auch bei einer höheren als der staatlich bestimmten Einwohnerzahl, keine Machtübernahme durch eine Familie stattfinden.
Das Hauptproduktionsgewerbe, wie überall in Europa zu dieser Zeit, ist die Agrarwirtschaft.
Die Landarbeit wird in einer Art Militärdienst organisiert, die einen zweijährigen Aufenthalt auf dem Land beinhaltet. Selbst die Häuser der Familien werden alle zehn Jahre gewechselt. All diese Verordnungen beugen gemeinsam mit der Einheitskleidung einem Liebgewinnen und Besitzdenken vor und fördern gleichzeitig ein erzwungenes gemeinschaftliches Zusammenleben. Über eine reibungslose Abwicklung dieser Einrichtungen und eventuelle Störungen wird nicht berichtet. Somit wird den Utopiern nicht die Gelegenheit gegeben über eine eventuelle andere Lebensform nachzudenken, denn es wird nicht über Alternativen jeglicher Organisation berichtet.
Es liegt hier eine sozialistische Grundorganisation zugrunde. Die Jugend wird von klein auf in dieses gemeinschaftliche Denken eingeschlossen und großgezogen. Der ständige Wechsel der Lebensgewohnheiten, z.B. Wohnungs- und Arbeitswechsel, lassen es nur schwer zu, einen Eigentumsgedanken aufkommen zu lassen. Bürger in der Stadt und auf dem Land unterscheiden sich in keiner Form, selbst nicht durch Kleidung, denn sie sind wechselweise beides[12], Bürger und Bauern.
Doch auch Morus muß Bedenken gegenüber der reibungslosen Vollzugs des Staatsgeschehens gehegt haben. Denn sonst hätte er nicht den ,,Phylarchen"
[griech.:Aufseher], die Verantwortung für das Verhalten ihrer Familien übertragen. Denn deren fast einzige Aufgabe ist es dafür zu sorgen, daß keiner ihrer Schützlinge tatenlos und müßig, sowohl während der Arbeitszeit als auch während der Freizeit, herumsitzt[13]. Als nächsten Schritt möchte ich mich der utopischen Außenpolitik widmen. Unter Außenpolitik fallen der Handel mit anderen Staaten und das Kriegswesen, die bei den Utopiern in einer engen Verbindung stehen. Ich beginne mit dem Handel. Jeglicher Überschuß aus der Produktion wird an andere Staaten verkauft. Selten werden Güter, außer in Notsituationen, gegen Waren getauscht. Generell ist es Usus gegen Grundstücke oder Pfandbriefe zu tauschen[14].
Diese Handelserlöse werden verwendet um später für anfallende Kriegshandlungen angehäuerte Söldner zu bezahlen. Wird gegen Gold getauscht, werden daraus Güter des täglichen Bedarfs hergestellt, damit die utopische Bevölkerung keinen immatriellen Wert mit Gold oder anderen Edelmetallen verbindet. Denn die Freude am ,,Schönem" ist für das utopische Volk nicht ,,sinnvoll" und damit unnützlich[15].
Werden Güter importiert, holen die Utopier sich die Güter eher ab, als daß diese von den Handelspartnern ins Land gebracht werden. Denn den Utopiern ist äußerst viel daran gelegen, die Seefahrt ständig zu verbessern und besser zu beherrschen.
Das utopische Kriegswesen ist besondersvernünftigverankert. Sie sind ein besonders friedfertiges Volk, das jeglicher Form von körperlicher Gewalt entsagt. Sie nehmen, entgegen der üblichen damaligen Verfahrensweise, nicht selbst an Kriegshandlungen teil, sondern führen einen ,,Kalten Krieg". Anstatt sich eine eigene stehende Armee zu halten, heuern sie im Krisenfall Söldner an um diese für ihre Zwecke kämpfen und sterben zu lassen. Bezahlt werden diese aus den Handelsgewinnen mit anderen Staaten. Die besondere utopische Taktik sind ,,geistiger Waffen". Geschickt machen sie Gebrauch von Terrorismus und Kriegspropaganda, z.B. setzen sie Kopfgelder auf feindliche Fürsten aus, führen im gegnerischen Land für den Gegner unvorteilhafte Propaganda, oder sticheln gegnerische fürstliche Familien gegenseitig auf, so daß ihre bezahlten Truppen ein leichtes Spiel mit dem Gegner haben[16].
Da die Utopier jeglichem Konflikt auszuweichen versuchen, und nur bei extremen Ungerechtigkeiten gegen ihr eigenes Volk oder befreundete Völker eingreifen, ist diese geistige Haltung durchaus zu verstehen und vernünftig. Doch ob diese geistige Haltung gerecht ist, ist eine andere Frage. Jedenfalls findet diese Lösung mit dem Ziel des geringsten Blutvergießen der eigenen Gattung Einklang. Diese Art der Kriegsführung ist weder gerecht, noch steht sie mit jeglicher christlichen Lebensart in einem positiven Verhältnis, der Morus sehr verbunden war.
Diese Geisteshaltung bedeutet aber nicht , daß der Utopier grundsätzlich den körperlichen Kampf scheut. Wenn ein Kampf nicht mehr zu vermeiden ist zieht er, wenn möglich, mit der gesamten familiären Unterstützung in den Kampf .
Morus will nicht von einer gerechten Kriegsführung berichten, sondern in seinen Augen sind diejenigen, die der Gewalt leben und sich ihr hingeben unmenschlich[17]. Nach Morus ist der Krieg ,,einfach bestialisch", und die einzige Art mit diesem umzugehen, ist ihn abzuschaffen[18].
Zusammenfassend kann behauptet werden, daß die gesamte utopische Bevölkerung gleichgeschaltet wird. Das einzelne Individuum rückt in den Hintergrund und Entscheidungsträger sämtliche Lebenssituationen wird die ,,Masse". Verweigert sich ein Individuum, wird es gemaßregelt oder ausgeschaltet. Ebenso verhält es sich zu Beziehungen zu fremden Staaten.
6. Schlußbemerkung
Zum Schluß stellt sich die Frage, ist das von Morus erdachte System tatsächlich so optimal wie Raphael berichtet, oder erscheinen bei einer genauen Betrachtung des utopischen Staates Unregelmäßigkeiten?
Gewiß muß man die Zeit berücksichtigen, in der Morus´ Werk entstanden ist. Doch Morus´ führt in seinem Werk keine absoluten Neuerungen ein, sondern schwächt vielmehr nur die bestehenenden europäischen Staats- und Wirtschaftsysteme ab. Abschwächung bedeutet, die Ausbeutung und die Wertlosigkeit der einzelnen bürgerlichen Arbeitskraft steht nicht offensichtlich im Vordergrund.
Somit komme ich zu der Schlußfolgerung, daß Utopia kein erstrebenswerterIdealstaatsein kann.
Morus bemängelt in der Rahmenhandlung, dem ersten Buch, die Unfreiheit der Bevölkerung und dessen Ausnutzung durch den Adel. Doch auch in der utopischen Bevölkerung leben Sklaven und Zwangsarbeit ist ebenfalls verhanden. Es wird bei wiederholten Straftaten sogar die Todesstrafe vollzogen. Die Sklaven verrichten die für die Utopier unzumutbaren Arbeitsaufgaben, z.B. Schlachten, Tische für Mahlzeiten herrichten etc.. Folglich ist dieses Gemeinwesen nicht optimal und stellt nur eine Umwandlung der bestehenden Gesellschaftsform dar. Ungerechtigkeit schafft er durch diese Form der Gesellschaft nicht ab. Er verlagert vielmehr die Macht von der ,,suberbia" auf die breite Masse[19]. Doch diese stellt sich nicht weniger rücksichtslos dar als der im ersten Buch beschriebene Adel. Die Gefahr der Machtausnutzung ist weiterhin gegeben.
Der gesamte Tages- und Lebensablauf der Utopier ist vorgeschrieben. Es besteht kein Weg zur Flucht. Die Einwohner stehen unter ständiger Kontrolle der Phylarchen, die ihnen einen Müßiggang verweigern.
Doch Freiheit bedeutet, innerhalb bestimmter rechtlicher Grenzen, sich frei zu bewegen im Stande zu sein und ebenfalls der Tätigkeit nachfolgen zu dürfen, die einem beliebt. Morus konnte zu dieser Zeit auch keine freiheitliche Staatsorganisation nach heutigem europäischen Vorbild kennengelernt haben. Sein Gedankengut stellt sicherlich eine Neuerung der damiligen Zeit dar. Doch Utopia löst nicht das eigentliche Problem der Ausbeutung. Abschließend komme ich zu der Folgerung, daß Utopia eine treffende humoristische Darstellung der damiligen ökonomischen und sozialen Stiuation mit all ihren Nachteilen darstellt, doch das utopische Gemeinwesen kein praktikablen Ausweg zur Lösung der Probleme dieser Zeit darstellt.
Anhang
Anhang 1: Der Autor Thomas Morus
Thomas Morus gilt als der Hauptvertreter des englischen Humanismus.
Der am 7. Februar 1478 geborene Sohn einer wohlhabenden Londoner Bürgerfamilie entschied sich bereits in jungen Jahren für ein humanistisches Studium in Oxford, das er aber bereits nach zwei Jahren wieder abbrach.
Auf Wunsch des Vaters, eines anerkannten Richters, ließ er sich anschließend in London zum Rechtsanwalt ausbilden und wurde kurz darauf Mitglied im Parlament. Eine spätere Ernennung zum Undersheriff brachte ihm schließlich weitere Vollmachten als Richter und führte ihn einige Jahre später im Auftrag von Heinrich VIII. in die heutigen Niederlande, wo er in einer Gesandtschaft über wirtschaftliche Themen verhandeln sollte. Dort traf er auf bedeutende Humanisten seiner Zeit, darunter Erasmus von Rotterdam, mit dem ihn schon seit 1499 eine enge Freundschaft verband.
Nach seiner Rückkehr im Jahre 1516 verfaßte Thomas Morus sein bekanntestes Werk, die ,,Utopia", die er seinem Freund Erasmus widmete. Seinem erfolgreichen politischen Engagement hatte er es zu verdanken, daß er bald darauf zum Unterschatzkanzler avancierte und 1529 zum Lordkanzler ernannt wurde. Diese Position machte ihn neben dem König zur wichtigsten politischen Person in England.
Nur drei Jahre später legte er sein Amt freiwillig nieder. Anlaß war die von Heinrich VIII. durchgesetzte Trennung der englischen Kirche von Rom und das damit verbundene Supremat des Königs über die Landeskirche. Thomas Morus, der seine humanistische Auffassung eng mit seiner religiösen Überzeugung verband, widersetzte sich diesen Maßnahmen und wurde nach einer längeren Kerkerhaft wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und schließlich 1535 in London durch Enthauptung hingericht.
Literaturverzeichnis:
- Benhabib, Seyla (1992): Kritik, Norm und Utopie
- Berneri, Marie Louise (1982): Reise durch Utopia
- Kristeller, Paul Oskar(1982): Thomas Morus als Humanist
- Krumbachner, Josef (1991): Geschichte der Wirtschaftstheorie
- Morus, Thomas (1517): Utopia; in: Grassi, Ernesto (1960): Der utopische Staat, Seite 13-110
- Platschek (1996) : Die Thomas Morus Homepage, URL: http://www.lrz-muenchen.de/~u3731ks/www/morus.htm (Stand 25.03.1996)
- Starbatty, Joachim (1989): Thomas Morus in: Starbatty, Joachim (1989): Klassiker des ökonomischen Denkens
- Titzmann, Michael: Wielands Staatsromane im Kontext des utopischen Denkens in: Acta Hohenschwangau (1993): Utopia und die Wege dorthin - Vom Schicksal der großen Entwürfe
- Unbekannt (1996): The St. Thomas More Web Site, URL: http://pw2.netcom.com/~rjs474/thomasmore.html (Stand 01.05.1999)
[...]
[1] Vgl. Starbatty (1989) S.80
[2] Vgl. Krumbachner (1992), S.29 f.
[3] Benhabib (1992), S.83 f.
[4] Vgl. Morus (1960), S.22 [Philosoph und Fürstendiener]
[5] Vgl. Morus (1960), S.27 [Teuerung].
[6] Vgl. Morus (1960), S.26 [Schafzucht und Einhegungen]
[7] Vgl. Morus (1960), S.38 f. [Kritik der üblichen Finanzpolitik]
[8] Vgl. Grassi (1960), S. 44 [Das Privateigentum als Hindernis gerechter Politik]
[9] Vgl. Morus (1960), S.59 f. [Versorgung der Bevölkerung]
[10] Vgl. Starbatty (1989), S.85
[11] Vgl. Grassi (1960), S.53 [Die Behörden]
[12] Vgl. Berneri (1982), S. 71 [Tugend und Glückseligkeit]
[13] Vgl. Grassi (1960), S. 54 [Die Gewerbe]
[14] Vgl. Grassi (1960), S. 64 f. [Handel und Zahlungsausgleich]
[15] Vgl. Grassi (1960), S.72 [Lehre von der Lust]
[16]Vgl. Grassi (1960), S. 88 f.
[17] Vgl. Grassi (1960), S. 93 [Einsatz von Frauen, Kampfmoral]
[18] Vgl. Berneri (1982), S. 85
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des "Utopia" von Thomas Morus?
Das vorliegende HTML-Dokument enthält eine umfassende Analyse von Thomas Morus' "Utopia". Es umfasst ein Inhaltsverzeichnis, das die Einleitung, Begriffserklärungen (Renaissance, Utopie, Vernunft), eine detaillierte Betrachtung der Renaissance selbst, die Zusammenfassungen und Analysen von "Utopia", Buch I und Buch II, eine Schlussbemerkung sowie Anhänge mit einem Literaturverzeichnis und Informationen über den Autor Thomas Morus umfasst.
Welche Themen werden in der Analyse von "Utopia" behandelt?
Die Analyse behandelt unter anderem die Kritik an der ökonomischen Situation zur Zeit von Morus, Morus' Verbesserungsvorschläge für ein optimales Staatsbild, die politische und wirtschaftliche Struktur des utopischen Staates, sowie eine Schlussfolgerung zur Praktikabilität des utopischen Gemeinwesens.
Was sind die Hauptkritikpunkte an der damaligen ökonomischen Situation, die von Morus angesprochen werden?
Morus kritisiert vor allem die Unterdrückung der Bauern und Bürger durch das Fürstentum, die finanzielle Misswirtschaft und die daraus resultierende Verelendung des Volkes. Er beanstandet auch das Privateigentum als zentrales Hindernis für eine gerechte Politik und Staatsorganisation.
Was sind Morus' Verbesserungsvorschläge für ein optimales Staatsbild in "Utopia"?
Morus schlägt die Abschaffung des Privateigentums, ein System der gemeinschaftlichen Produktion und Versorgung, die Organisation der Arbeit durch gewählte Vertreter, die Förderung der Bildung und Vernunft, sowie eine gerechte und friedliche Außenpolitik vor.
Wie ist das Leben in Morus' "Utopia" organisiert?
Das Leben in "Utopia" ist durch absolute Gleichheit, gemeinschaftliche Arbeit und Mahlzeiten, bescheidenen Lebenswandel und eine straffe staatliche Organisation geprägt. Es gibt keine Privatsphäre und das gesamte Leben der Bewohner folgt einem festen Plan.
Welche Rolle spielt die Vernunft in der utopischen Gesellschaft?
Die Vernunft spielt eine zentrale Rolle in der utopischen Gesellschaft. Sie beeinflusst das Handeln der Bürger, die Organisation des Staates und die Außenpolitik. Die Utopier streben danach, alle Entscheidungen auf der Grundlage der Vernunft zu treffen und Triebe wie Lust, Hass oder Vergeltungsstreben zu vermeiden.
Wie funktioniert die Wirtschaft in "Utopia"?
Die Wirtschaft in "Utopia" basiert auf gemeinschaftlicher Produktion und Verteilung. Es gibt Speicher, in denen landwirtschaftliche und handwerkliche Erzeugnisse gelagert werden und von den Phylarchen unentgeltlich angefordert werden können. Überschüsse werden exportiert und Mangelware importiert.
Wie wird in "Utopia" mit Arbeit und Faulheit umgegangen?
Jeder Bürger muss arbeiten. Wer sich von der Arbeit zurückzieht, wird von den gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschlossen und geächtet. Selbst Reisende sind angehalten, an ihrem Aufenthaltsort ihren Beitrag zum Arbeitspensum zu leisten. Die Erziehung soll ebenfalls zur Arbeitsmotivation beitragen.
Wie ist die Außenpolitik Utopias gestaltet?
Die utopische Außenpolitik ist friedfertig, aber pragmatisch. Sie betreiben Handel, um Überschüsse zu verkaufen und Mangelware zu importieren. Sie setzen im Kriegsfalle auf Söldner und "geistige Waffen" wie Terrorismus und Propaganda, um Blutvergießen zu vermeiden.
Was ist die Schlussfolgerung zur Praktikabilität von Morus' "Utopia"?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass "Utopia" zwar eine treffende humoristische Darstellung der damaligen ökonomischen und sozialen Situation darstellt, aber kein praktikabler Ausweg zur Lösung der Probleme dieser Zeit ist. Es wird bemängelt, dass die Unfreiheit der Bevölkerung, die Ausnutzung und die mangelnde Individualität weiterhin bestehen.
- Quote paper
- Dirk Rüsel (Author), 1999, Thomas Morus - Die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Mißstände in der Zeit der Renaissance und seine Verbesserungsvorschläge, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95873