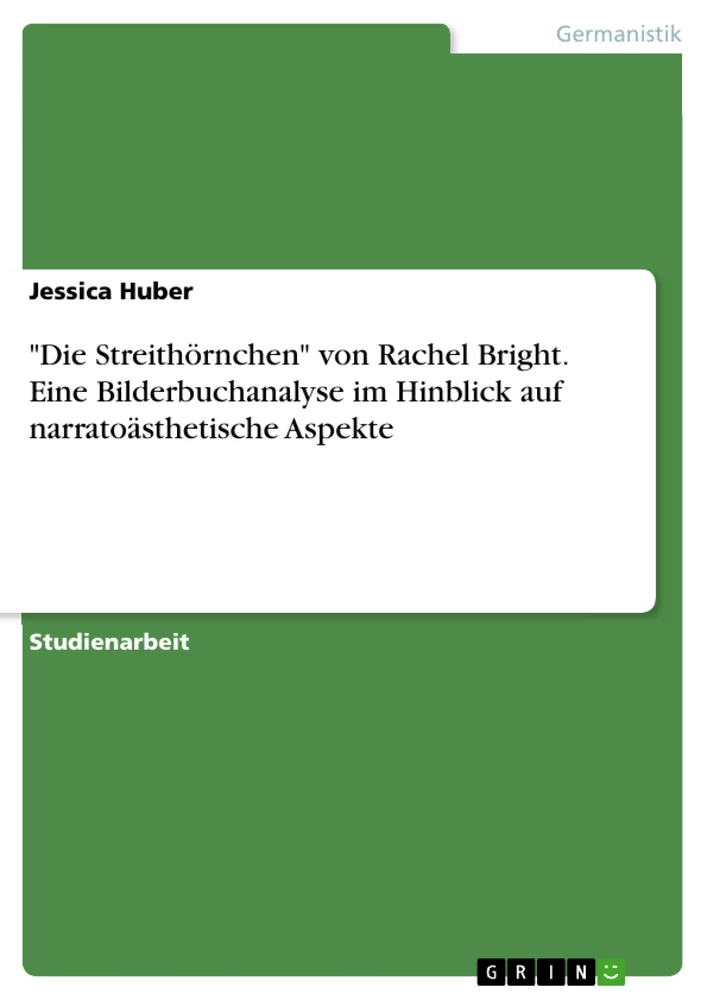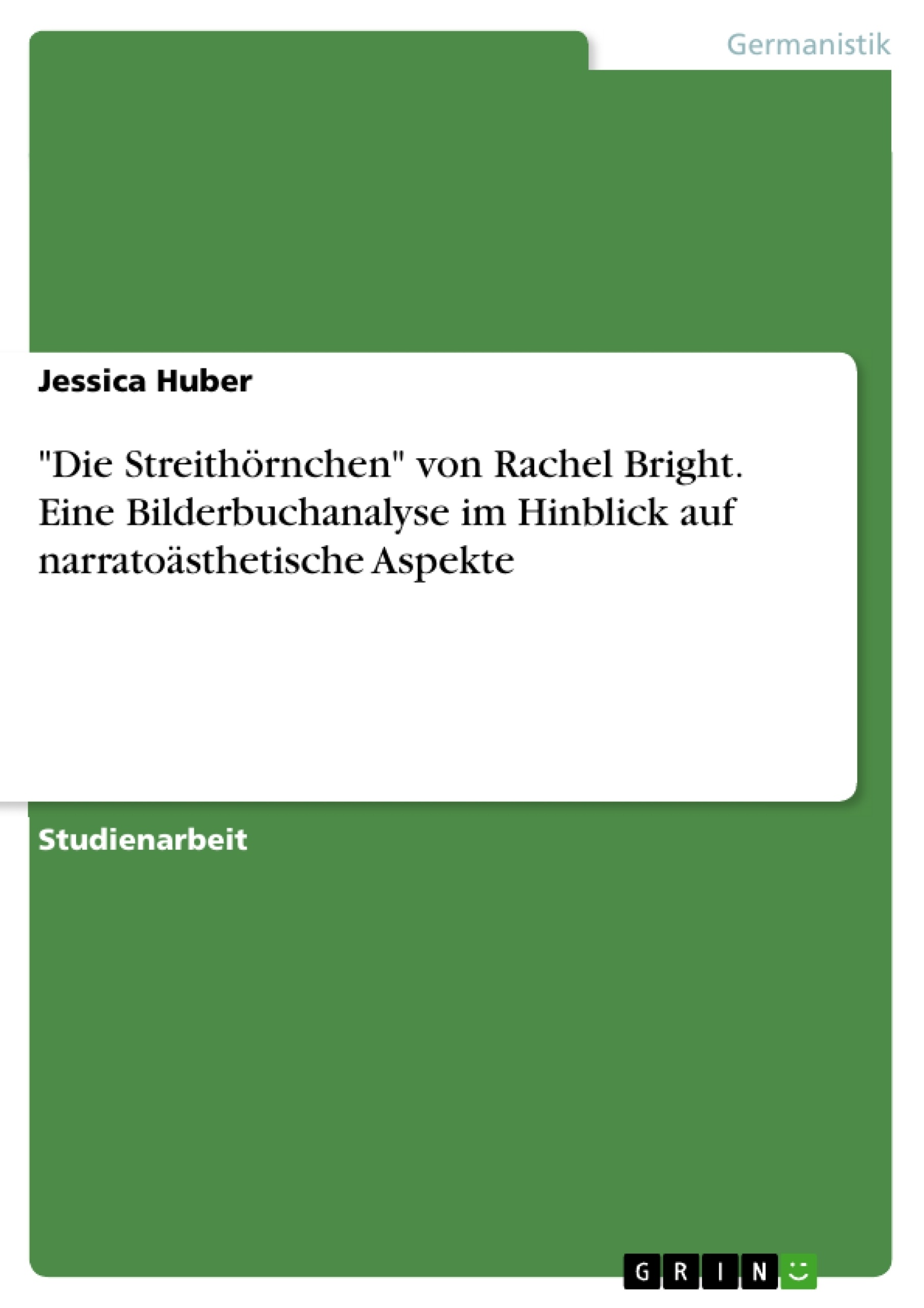Die vorliegende Bilderbuchanalyse beschäftigt sich mit dem Bilderbuch "Die Streithörnchen" von Rachel Bright, das für Vorschulkinder konzipiert ist. Das Bilderbuch behandelt Thematiken wie Uneinigkeiten und Auseinandersetzungen. Aber auch Themen wie das Miteinander, das Teilen oder Freundschaft stehen im Fokus. Anhand des Buches "Bilderbuchanalyse: Narrativik – Ästhetik – Didaktik" von Tobias Kurwinkel soll das Bilderbuch unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte analysiert werden. Untersucht werden sollen unter anderem Aspekte der narratoästhetischen Bilderbuchanalyse. Den Hauptteil bildet demnach die Analyse des Bilderbuchs "Die Streithörnchen".
Am Anfang widmet sich diese wissenschaftliche Arbeit der Frage nach der Makroebene, bei welchem die Aspekte Produktion, Distribution und Rezeption im Mittelpunkt stehen. Nachfolgend geht diese Arbeit auf die Mikroanalyse ein, wo zum einen textexterne und textinterne Aspekte untersucht werden. Das Hauptaugenmerk bei der textinternen Analyse liegt dabei darin, wie es und was dargestellt wird. Dabei werden die Handlung und Figuren näher betrachtet sowie auf Motive und den Raum Bezug genommen. Darüber hinaus werden Schrift- und Bildtext untersucht und es gibt theoretischen Einblick in spezifische Erzählmerkmale. Auch die Gestaltungsmerkmale und Illustrationen werden näher betrachtet. Des Weiteren wird auch auf die sprachliche Gestaltung Bezug genommen. Unter anderem wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung das Bild und der Text übernehmen. Am Ende folgt die Schlussfolgerung mit dem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die narratoästhetische Bilderbuchanalyse
- Makroanalyse
- Mikroanalyse: Textexterne Aspekte
- Paratext
- Materialität
- Mikroanalyse: Textinterne Aspekte
- Was wird dargestellt?
- Wie wird es dargestellt?
- Interdependenzen von Bild und Text
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Bilderbuch "Die Streithörnchen" von Rachel Bright, das für Vorschulkinder konzipiert ist. Ziel ist es, das Buch unter Verwendung der narratoästhetischen Bilderbuchanalyse zu untersuchen. Dabei werden die Aspekte Produktion, Distribution und Rezeption sowie die textexternen und textinternen Aspekte des Buches betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der Handlung und Figuren, der Gestaltungsmerkmale und der Illustrationen sowie der sprachlichen Gestaltung des Buches.
- Die Darstellung von Uneinigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den Figuren
- Die Bedeutung des Miteinanders, des Teilens und der Freundschaft im Kontext der Geschichte
- Die Interaktion zwischen Bild und Text und deren Bedeutung für die Gesamtwirkung des Buches
- Die Gestaltungsmerkmale und Illustrationen als Mittel zur Vermittlung der Geschichte und zur emotionalen Ansprache des jungen Publikums
- Die Analyse der sprachlichen Gestaltung und der Nutzung von erzählerischen Mitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bilderbuchanalyse ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Im Kapitel 2 wird die narratoästhetische Bilderbuchanalyse im Detail betrachtet. Dabei werden zunächst die Makroebene mit den Aspekten Produktion, Distribution und Rezeption beleuchtet.
Anschließend werden die textexternen Aspekte des Buches "Die Streithörnchen" anhand von Paratext und Materialität untersucht. In der Mikroanalyse liegt der Fokus auf der textinternen Analyse, bei der die Geschichte und die Figuren näher betrachtet werden. Dabei werden die Handlung, die Motive und der Raum analysiert.
Das Kapitel 2.3 befasst sich mit der Interdependenz von Bild und Text und beleuchtet die Gestaltungsmerkmale, Illustrationen und die sprachliche Gestaltung des Buches. Es werden die Bedeutung des Bildes und des Textes für die Gesamtwirkung des Buches untersucht.
Schlüsselwörter
Bilderbuchanalyse, narratoästhetische Bilderbuchanalyse, Makroanalyse, Mikroanalyse, Paratext, Materialität, Textexterne Aspekte, Textinterne Aspekte, Handlung, Figuren, Gestaltungsmerkmale, Illustrationen, Sprache, Interdependenz von Bild und Text, Kinderbuch, "Die Streithörnchen", Rachel Bright, Jim Field.
- Quote paper
- Jessica Huber (Author), 2019, "Die Streithörnchen" von Rachel Bright. Eine Bilderbuchanalyse im Hinblick auf narratoästhetische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/957924