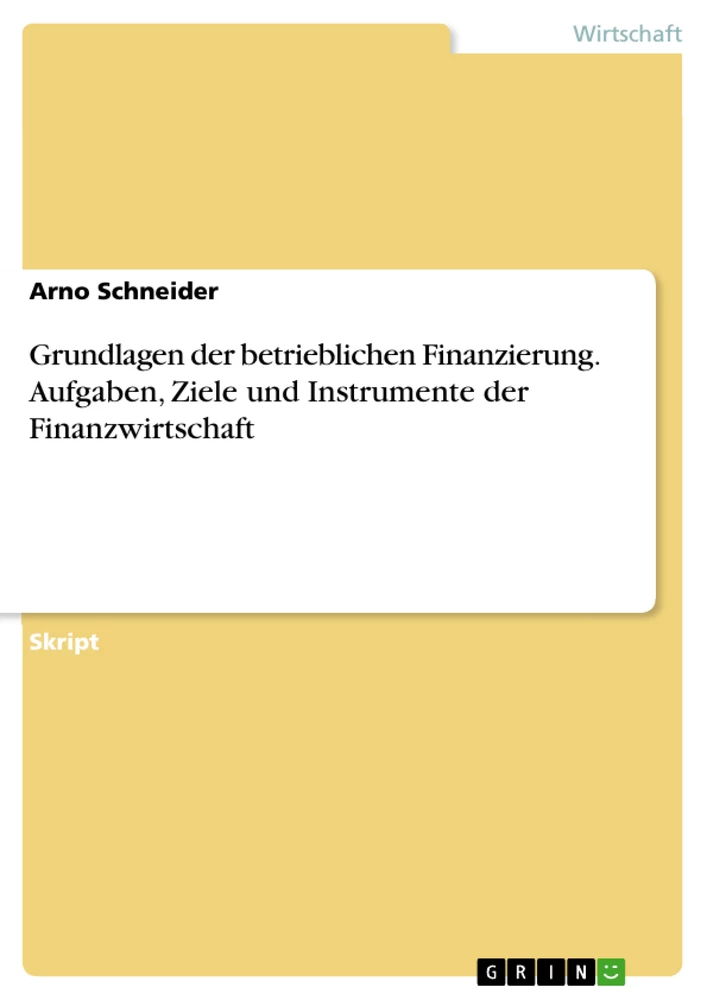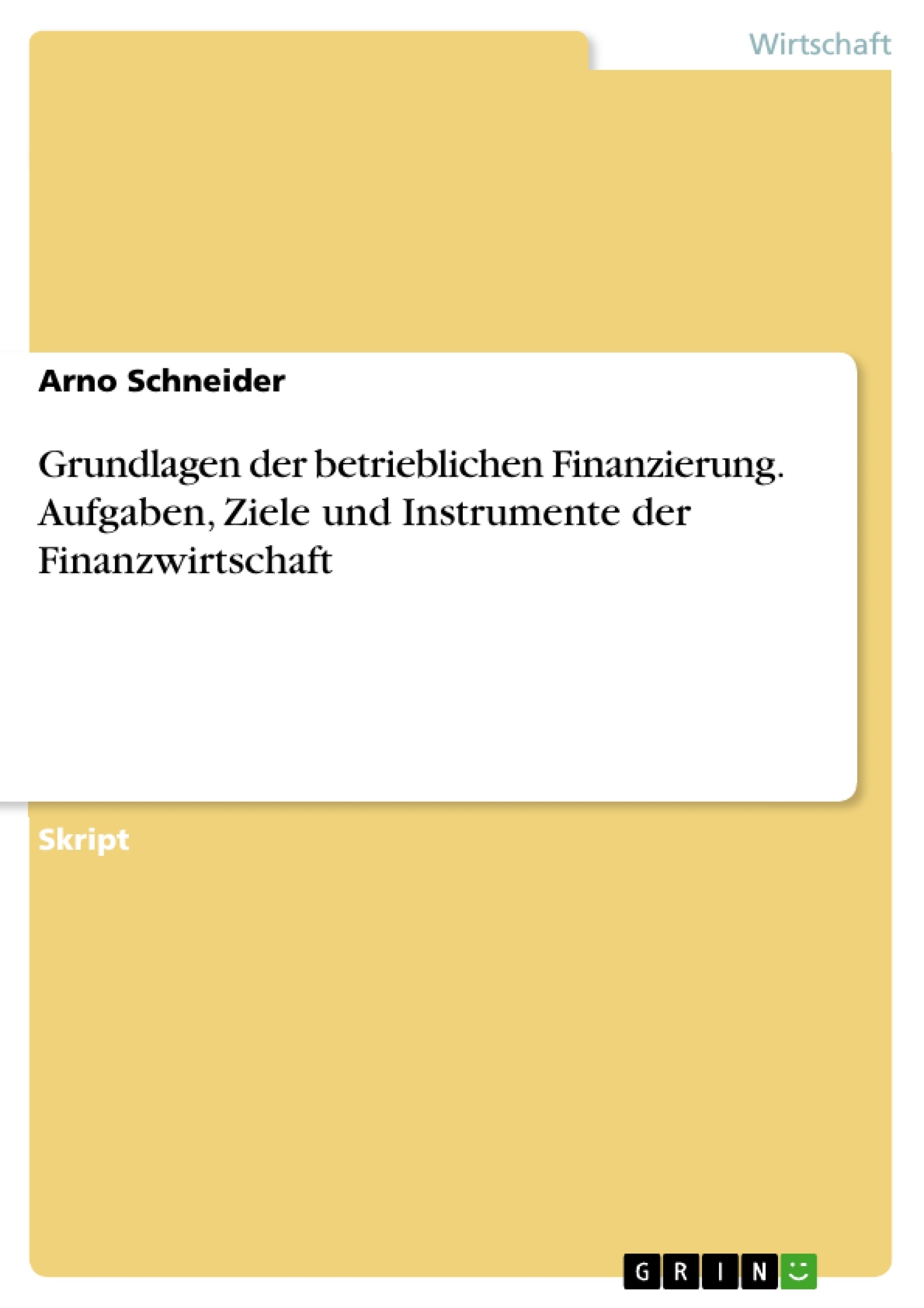Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über das Thema Finanzierung im Kontext des "Technischer Betriebswirt"-Lehrgangs. Es enthält eine Vorschau mit Inhaltsverzeichnis, Lernzielen, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern.
Welche Finanzierungsarten werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt verschiedene Finanzierungsarten, geht aber nicht im Detail darauf ein. Der Fokus liegt eher auf den Aufgaben und Zielen der betrieblichen Finanzwirtschaft.
Welche Aufgaben der betrieblichen Finanzwirtschaft werden genannt?
Zu den genannten Aufgaben gehören Budgetierung, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung von Geldersatzmitteln/Buchgeld, Verwaltung des Finanzanlagevermögens, Vorbereitung und Durchführung von Kredit- und Eigenkapitalaufnahmen sowie Finanzierungsalternativen.
Welche Ziele der Finanzwirtschaft werden hervorgehoben?
Die zentralen Ziele sind Liquidität, Unabhängigkeit, Sicherheit und Stabilität sowie Rentabilität.
Wie wird Liquidität betrachtet?
Liquidität wird sowohl statisch (mittels Kennzahlen wie Liquidität I, II, III) als auch dynamisch (Kapitalflussrechnung) betrachtet.
Welche Kennzahlen zur Liquidität werden genannt?
Die statischen Liquiditätsgrade I (Barliquidität), II (Liquidität auf kurze Sicht) und III (Liquidität auf mittlere Sicht) werden mit ihren Berechnungsformeln aufgeführt.
Was ist eine Kapitalflussrechnung?
Die Kapitalflussrechnung, im Dokument als "Kapitalflußberechnung" bezeichnet, ist eine dynamische Betrachtung der Liquidität, die Einnahmen, Ausgaben und die Differenz über einen bestimmten Zeitraum erfasst.
Was sind Bewegungsbilanzen?
Bewegungsbilanzen werden als Darstellung der Veränderung von Aktiva und Passiva über einen Zeitraum hinweg erwähnt und anhand eines Beispiels illustriert.
Wie werden Skonti behandelt?
Das Dokument erklärt die Bedeutung und den Nutzen von Skonti und präsentiert eine Formel zur Berechnung des effektiven Zinssatzes bei Inanspruchnahme von Skonto.
Wie werden Cash-Flow-Probleme angesprochen?
Es werden Unterliquidität, Überliquidität und Illiquidität als Cash-Flow-Probleme genannt und mögliche Gegenmaßnahmen sowie Gründe für Illiquidität aufgezeigt.
Welche Ziele werden neben der Liquidität genannt?
Neben der Liquidität werden Unabhängigkeit, Sicherheit und Stabilität sowie Rentabilität als wichtige Ziele der Finanzwirtschaft aufgeführt.
Wie wird Rentabilität definiert und gemessen?
Die Eigenkapitalrentabilität (R EK), Gesamtkapitalrentabilität (R GK) und Umsatzrentabilität (R U) werden mit ihren Berechnungsformeln dargestellt.
Was ist der Verschuldungsgrad?
Der Verschuldungsgrad wird definiert als Fremdkapital dividiert durch Eigenkapital und dient zur Beurteilung der finanziellen Stabilität eines Unternehmens.
Welche Instrumente der Finanzwirtschaft werden genannt?
Finanzplanung (strategisch, taktisch, operativ), Finanzdisposition (Cash Management) und finanzwirtschaftliche Analyse (Substanz, Kennzahlen, Finanzierungsstruktur, Liquidität, Rentabilität) werden als Instrumente genannt.
Welche Finanzierungsarten werden im Beispiel behandelt?
Im Beispiel wird Eigenkapitalfinanzierung und Fremdkapitalfinanzierung, einschließlich Mischformen, anhand einer Beispielrechnung betrachtet.
Welche finanzwirtschaftlichen Bestandsgrößen werden unterschieden?
Es werden Eigenkapital (ausgewiesen und nicht ausgewiesen) und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) unterschieden.
Wie wird die Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdkapital behandelt?
Es werden verschiedene Kriterien zur Unterscheidung von Eigen- und Fremdkapital aufgeführt, darunter Rechtsverhältnis, Haftung, Fristigkeit, Entgelt, steuerliche Absetzbarkeit, Umfang, Vermögen und Mitbestimmung.
Welche Formen des Kapitalbedarfs werden genannt?
Anschaffungen im Anlage- und Umlaufvermögen, Gewinnausschüttungen, Tilgung/Zinsen, Abfindungen, Steuerzahlungen und Löhne/Gehälter werden als Formen genannt.
Welche Beeinflussungsfaktoren des Kapitalbedarfs werden genannt?
Struktur des Beschaffungs- und Absatzmarktes, Preisstruktur am Beschaffungsmarkt, staatliche Restriktionen, fortschreitende Technologie, Rechtsform und Anordnung des Produktionsprozesses.
Was ist der Inhalt der Beispielaufgabe zum Finanzplan?
Die Aufgabe beinhaltet die Erstellung eines Finanzplans für ein kleines Industrieunternehmen über drei Monate, sowie die Analyse von Überschüssen, Fehlbeträgen und der Vernetzung des Plans mit anderen Unternehmensbereichen.
Was ist der Inhalt der Aufgabe zu Bilanzbewertungen nach der Liquidität?
Es werden Beispiele zur Bilanzbewertung nach Liquiditätsgesichtspunkten gegeben und Schlussfolgerungen hinsichtlich der finanziellen Stabilität abgeleitet.
Was ist ein Cash-Flow?
Der Cash-Flow wird als eine wichtige Größe zur Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens genannt, es wird auf Unterliquidität, Überliquidität und Illiquidität im Zusammenhang mit dem Cash-Flow hingewiesen.
Welche Finanzierungsregeln werden genannt?
Horizontale Finanzierungsregeln (Goldene Finanzregel, Goldene Bilanzregel) und vertikale Finanzierungsregeln (Two-One-Regel, One-To-One-Regel) werden aufgeführt.
Welche Instrumente der Finanzwirtschaft werden genannt?
Es werden Finanzplanung, Finanzdisposition und finanzwirtschaftliche Analyse aufgeführt.
Welche Themen werden in Bezug auf Aktien behandelt?
Es werden Bestandteile, Rechte, Formen von Aktien (Nennwertaktien, Quotenaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, Stammaktien, Vorzugsaktien, Eigene Aktien, Junge Aktien), sowie Aktienkennzahlen (Bilanzkurs, Ertragswert, Kurs-Gewinn-Verhältnis) behandelt.
Welche Formen der Kapitalbeschaffung werden genannt?
Es werden Beteiligungsfinanzierung und Fremdfinanzierung behandelt. Im Bereich der Beteiligungsfinanzierung werden Einzelunternehmen, Stille Gesellschaft, GdbR, OHG, KG und AG erwähnt. Im Bereich der Fremdfinanzierung werden kurzfristige und langfristige Kredite genannt.
Welche Arten kurzfristiger Kredite werden genannt?
Handelskredite (Lieferantenkredite), Kontokorrentkredite, Wechselkredite und Diskontkredite.
Welche Arten langfristiger Kredite werden genannt?
Annuitätendarlehen, Abzahlungsdarlehen, Blockdarlehen und Schuldscheindarlehen werden genannt.
Welche Punkte werden im Kapitel Leasing erwähnt?
Es werden Operate-Leasing und Finance-Leasing unterschieden.
- Quote paper
- Arno Schneider (Author), 1998, Grundlagen der betrieblichen Finanzierung. Aufgaben, Ziele und Instrumente der Finanzwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95294