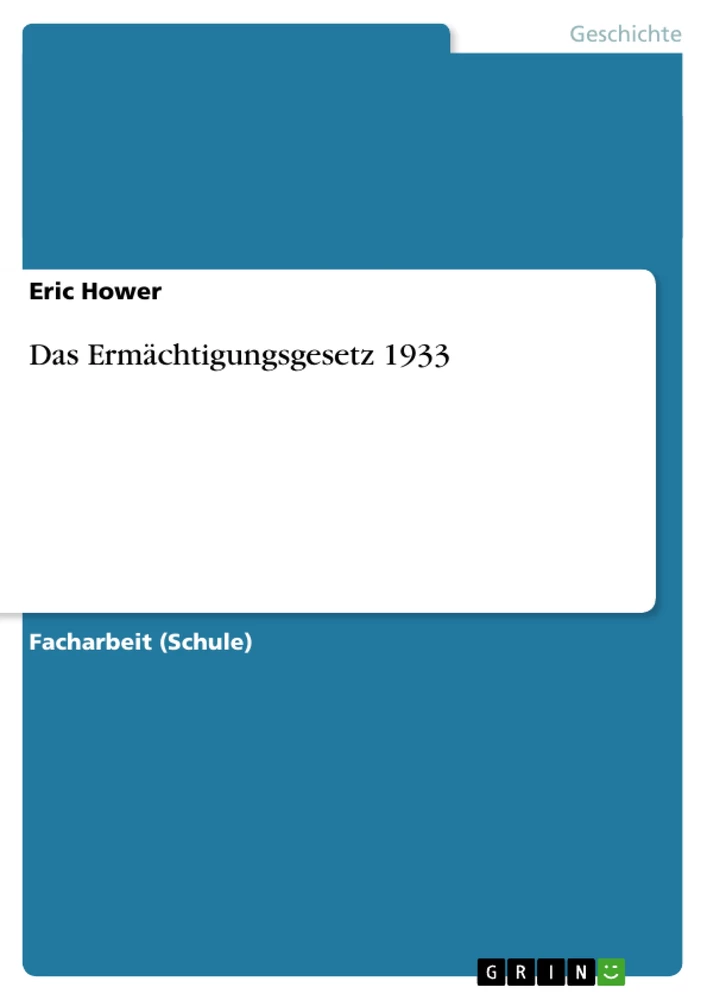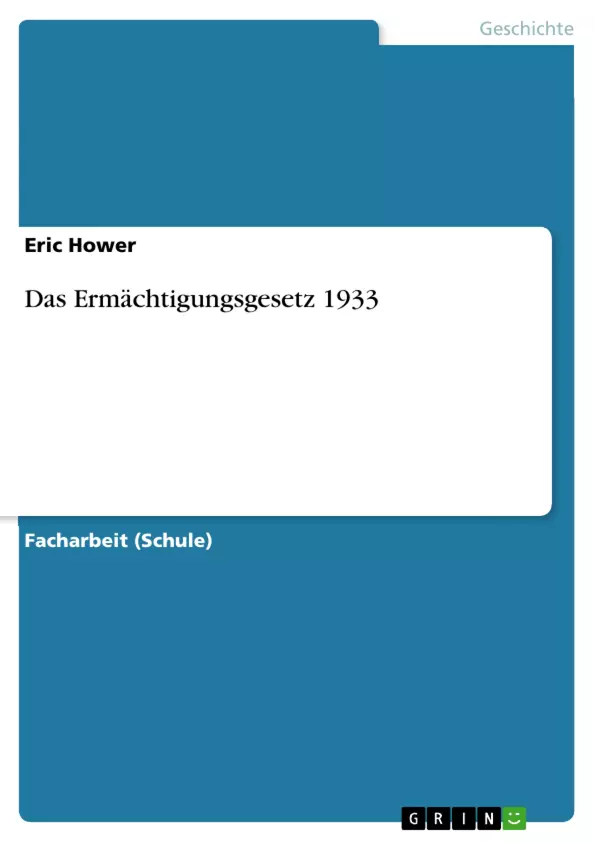Ein Wendepunkt der deutschen Geschichte, eine Nation am Abgrund: Dieses Buch enthüllt die erschütternden Ereignisse und politischen Schachzüge, die zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes im März 1933 führten. Tauchen Sie ein in eine Zeit der Instabilität, in der die Weimarer Republik zerbrach und Adolf Hitler die Bühne betrat, um seine Macht zu festigen. Erleben Sie hautnah die Intrigen und Verhandlungen hinter den Kulissen, während Hitler geschickt das Zentrum umwarb, um seine Zustimmung zu diesem verhängnisvollen Gesetz zu sichern. Analysiert werden die verfassungspolitische Lage, die Rolle des Reichstagsbrands und die perfiden Ziele der Nationalsozialisten. Das Buch beleuchtet die innerparteilichen Beratungen des Zentrums, die zerrissenen Gewissen und den immensen Druck, dem die Abgeordneten ausgesetzt waren. Verfolgen Sie den dramatischen Tag der Abstimmung in der Krolloper, die Reden von Otto Wels und Prälat Kaas, und die Atmosphäre der Angst und Einschüchterung, die über allem lag. Eine minutiöse Rekonstruktion der Ereignisse, die Deutschland für immer veränderten. Die Leser werden Zeugen, wie Grundrechte außer Kraft gesetzt, politische Gegner verfolgt und der Rechtsstaat ausgehöhlt wurden. Es wird untersucht, inwiefern die Notverordnung zum Reichstagsbrand und das Ermächtigungsgesetz die Grundgesetze der NS-Diktatur bildeten. Neben den unmittelbaren Konsequenzen für das Weimarer System werden auch die langfristigen Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland analysiert. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der die Mechanismen des Machtmissbrauchs verstehen und die Lehren aus der Vergangenheit für die Gegenwart ziehen will. Es schildert, wie Hitler durch Täuschung, Lügen und dem Ausnutzen der Schwächen der Weimarer Verfassung seine totalitären Ziele verfolgen konnte. Die Analyse der Ereignisse von 1933 bietet wichtige Einblicke in die Fragilität von Demokratien und die Notwendigkeit, Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Schlagworte: Ermächtigungsgesetz, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Hitler, Zentrumspartei, Reichstagsbrand, Krolloper, Demokratie, Diktatur, Verfassungsgeschichte, Rechtsstaat, politische Intrigen, Machtergreifung, NS-Regime, Deutschland 1933, Geschichtsaufarbeitung, politische Analyse, Parlamentarismus, Hindenburg, Otto Wels, Prälat Kaas, politische Verfolgung, Gleichschaltung, Analyse.
Inhaltsverzeichnis
Erklärung
1. Einleitung
2. Die verfassungspolitische Lage am Ende der Weimarer Republik
3. Entwicklungen bis zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes
3.1. Die Machtergreifung Hitlers
3.2. Der Reichstagsbrand und die Reichstagsbrandnotverordnung
3.3. Ziele und Absichten der Regierung Hitler
3.4. Innerparteiliche Beratungen des Zentrums und die Verhandlungen mit Hitler über das Ermächtigungsgesetz
4. Der Tag der Abstimmung
5. Die Folgen des Ermächtigungsgesetzes
5.1. Unmittelbare Folgen des Ermächtigungsgesetzes
5.2. Die Folgen des Ermächtigungsgesetzes auf die BRD
6. Zusammenfassung und Ausblick
7. Literaturverzeichnis
8. Anhang
Erklärung
Hiermit erkläre ich, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfaßt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet ha- be.
Insbesondere versichere ich, daß ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.
Salmtal, den
(Unterschrift)
1. Einleitung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Umstände aufzuzeigen, die zur Annahme des Ermächtigungsgesetzes führten. Neben der Darstellung des Verhaltens und der Zielset- zungen der Regierung Hitlers bei der Ausarbeitung des Gesetzes, wird insbesondere dargestellt, wie es Hitler gelang, das Zentrum zu einer Zustimmung zu bewegen. Des weiteren werden die Geschehnisse des 23. März 1933, dem Tag der Annahme des Ge- setzes, geschildert. Als letzter Punkt dieser Facharbeit werden die unmittelbaren Folgen für das Weimarer System und für die Bundesrepublik Deutschland dargestellt.
2. Die verfassungspolitische Lage am Ende der Weimarer Republik
Um ein besseres Verständnis des Zustandekommens des Ermächtigungsgesetzes zu erhalten, werden zu Beginn die Umstände beschrieben, die es erst ermöglichten, daß ein Regime überhaupt an die Macht kam, die dieses Gesetz mißbrauchte.
Seitdem die letzte von einer Mehrheit im Parlament getragene Regierung gescheitert war, und Reichskanzler Müller am 27 März 1930 zurücktrat, gab es nur noch Präsidia l- kabinette. Diese Präsidialkabinette waren allein abhängig vom Wohlwollen des Reic hs- präsidenten, der aufgrund des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung ohne die Zustimmung des Parlamentes Gesetze erlassen konnte, die sog. Notverordnungen. Da die darauffolgenden Regierungen nur auf das Wohlwollen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg angewiesen waren, konnten sich diese Regierungen nicht lange halten. So wurde der ab 1930 regierende Reichskanzler Heinrich Brüning 1932 abgesetzt , als Reichspräsident Hindenburg seine Unterschrift zu einer Notverordnung verweigerte. Brüning, der nicht vom Parlament, sondern ausschließlich vom Reichspräsidenten ab- hängig war, mußte zurücktreten. Ihm folgte Franz von Papen und dessen „Kabinett der Barone“, dem schon in der ersten Sitzung des neugewählten Reichstages das Mißtrauen mit 512 gegen 42 Stimmen ausgesprochen wurde. Daraufhin wurde auch dieser einige Zeit später von Reichspräsident Hindenburg fallen gelassen und General von Schleicher zu seinem Nachfolger ernannt. Der erst am 3. Dezember 1932 als Reichskanzler er- nannte General von Schleicher wurde jedoch schon am 28. Januar 1933 wieder entlas- sen. Grund hierfür war, daß seine Politik der „Querfront“, gestützt auf Gewerkschaften und den linken Flügel der NSDAP unter Gregor Strasser, gescheitert war, und Reic hs- präsident Hindenburg ihm eine Notverordnung zur Auflösung des Reichstages verwei- gerte.
Die personelle Abhängigkeit der Regierung von Hindenburg hatte nicht nur Auswir- kungen auf die Politik und die betreffenden Politiker, sondern auch auf die Verfassung selbst. Dies liegt bereits im Jahr ihrer Entstehung unter Reichspräsident Friedrich Ebert begründet. So wurden in den Jahren zwischen 1919 und 1923 insgesamt 136 Notver- ordnungen und 6 Ermächtigungsgesetze erlassen, die jedoch keines verfassungsändern- den Elemente enthielten. Sie beschränkten sich fast ausschließlich auf die Behebung wirtschaftlicher Probleme; insbesondere gilt dies für das Krisenjahr 1923. Aus einem dieser Ermächtigungsgesetze, dem zweiten Ermächtigungsgesetz vom 8 Dezember 1923, wurde die Formel der Überschrift des Ermächtigungsgesetzes von 1933 „Not von Volk und Reich“ übernommen. Der Effekt dieser großen Zahl an Ermächtigungsgeset- zen und Notverordnungen war, daß „die Bevölkerung an die Ausschaltung bzw. Selbst- ausschaltung des Reichstages gewöhnt wurde“1.
In den „goldenen Zwanzigern“ verschwanden die Notverordnungen und Ermächti- gungsgesetze als Mittel der Gesetzgebung fast vollständig bis zum Scheitern der Regie- rung Müller im März 1930. Ab diesem Zeitpunkt sank die Zahl der Sitzungen des Reichstages von 94 Sitzungen 1930 auf 13 Sitzungen 1932. Gleichzeitig sank die Zahl der vom Reichstag verabschiedeten Gesetze vom 98 im Jahr 1930 auf gerade einmal 5 im Jahr 1932. Dieser Entwicklung entgegengesetzt stieg wiederum die Zahl der Not- verordnungen von 5 auf 66 Notverordnungen zwischen den Jahren 1930 bis 1932.
3. Entwicklungen bis zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes
3.1. Die Machtergreifung Hitlers
Noch während der Amtszeit General von Schleichers traf sich Franz von Papen mit Hitler, um über ein neues Regierungskabinett für die Zeit nach von Schleicher, zu ver- handeln. Da Hitler weiterhin auf den Posten des Reichskanzlers beharrte, er aber bei der Besetzung der Ministerposten zu Kompromissen bereit war, glaubte von Papen er hätte sich Hitler „engagiert“ und ihn mit sieben nicht - nationalsozialistischen Ministern ge- nügend „eingerahmt“, um ihn kontrollieren zu können. Somit war die mit Feiern und Fackelzügen gefeierte Machtergreifung der Nationalsozialisten keine nationalsozialisti- sche Regierung, sondern eine Koalitionsregierung zwischen der NSDAP und der DNVP. Aus diesem Grund glaubte ein Großteil der Bevölkerung, daß von Papen als Vizekanzler und Hugenberg als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister die führen- den Personen der Regierung seien. Weiterhin war diese Regierung nur eine weitere Präsidialregierung, die noch von Reichspräsident Hindenburg abhängig war, da die Regierungskoalition lediglich über 40% der Stimmen des Reichstages verfügte. In Wirklichkeit war jedoch Hitler die bestimmende Gestalt in dieser Regierung. Dies zeig- te sich schon am 30. Januar noch vor der Vereidigung der neuen Regierung, als Hitler die Forderung nach sofortiger Reichstagsauflösung und Neuwahlen stellte. Hugenberg aber, der sich nur unter der Bedingung, daß es keine Neuwahlen gäbe, an Koalitions- verhandlungen beteiligt hatte, wehrte sich heftig dagegen, gab aber nach Drängen Pa- pens nach, um die neue Regierung nicht sofort scheitern zu lassen.
Die neue Regierung stellte ihr Programm unter dem Schlagwort „nationale Erhebung“, die alle Kräfte zu bündeln versuchte, die die Weimarer Republik nur als Übergangszeit ansahen, vor. Eine ähnliche Stimmung herrschte im Deutschen Volk, das endlich wie- der eine starke Nation, ohne innenpolitische Auseinandersetzungen mit einer fähigen, uneingeschränkten Regierung, sein wollte. Und diese fähige Spitze glaubten die Men- schen in Hitler zu sehen. So war die Stimmung der „nationalen Erhebung“ wahrschein- lich ebenso wichtig wie die Stimmung des „reinigenden Gewitters“ im August 1914 Nach der Auflösung des Reichstages am 1. Februar und noch vor der Verabschiedung von Reichstagsbrandnotverordnung und Ermächtigungsgesetz begann Hitler, sich durch Notverordnungen eine Machtbasis aufzubauen. Auf dieser Basis trieb er seinen Wahl- kampf voran und schwächte damit gleichzeitig seine politischen Gegner. Jegliche sozia- listische Presse wurde verboten, der immer noch sozialistische preußische Landtag wurde aufgelöst und die noch verbleibenden politischen Handlungsmöglichkeiten der Regierung Braun-Severing wurden der nationalsozialistischen Kommissariatsregierung übergeben. Die „Gleichschaltung“ Preußens wurde vollendet als Göring kommissari- scher Innenminister für Preußen wurde und den Befehl über die Polizei übernahm.
Bei der Wahl am 5. März 1933 erhielt die Regierungskoalition 51,9 % (NSDAP 43,9 %) und hatte somit eine regierungsfähige Mehrheit im Reichstag. Das Zentrum erhielt 11,2 %, die SPD 18,3 % und die KPD 12,3 % der Stimmen. Somit war es Hitler trotz des Terrors durch die SA nicht gelungen, die absolute Mehrheit für die NSDAP im Reichstag zu erreichen und die linken Parteien gänzlich zu unterdrücken.
3.2. Der Reichstagsbrand und die Reichstagsbrandnotverordnung
Der Brand des Reichstagsgebäudes am 27. Februar 1933 wurde geschickt von der Re- gierung Hitlers genutzt, um einen entscheidenden Schlag gegen die KPD zu führen und um ihre eigene politische Macht auszudehnen. Durch den am Tatort festgenommenen Kommunisten Marinus van der Lubbe schien bewiesen, daß die kommunistische Bewe- gung hinter dem Brandanschlag stecke. Mit dem Argument, einen kommunistischen Aufstand verhindern zu wollen, veranlaßte das Reichskabinett den Reichspräsidenten am nächsten Tag die „Reichstagsbrandnotverordnung“ zu erlassen. Ob die kommunisti- sche Bewegung tatsächlich den Anschlag verübte, und die Regierung die Lage nur ge- schickt ausnutzte, oder ob der Brand von den Nazis vorsätzlich gelegt wurde, ist bis heute umstritten.
Diese „Reichstagsbrandnotverordnung“ sollte „zur Abwehr kommunistischer staatsge- fährdender Gewaltakte“ dienen. Zu diesem Zweck wurde die Verhaftung der Abgeord- neten und der führenden Funktionäre der KPD, das Verbot der kommunistischen sowie ein vierzehntägiges Verbot der sozialdemokratischen Presse in Preußen und die Schlie- ßung der Parteibüros der KPD angeordnet. Weiterhin wurden die laut Strafgesetz fest- gelegten Strafen für Hochverrat und Brandstiftung von lebenslänglichen Haftstrafen zur Todesstrafe verschärft. Des weiteren war bei dieser Notverordnung keine Appellati- onsmöglichkeit der Verhafteten vorgesehen, so daß die Verurteilungen sofort ausge- führt werden konnten. Ihr wichtigster Bestandteil war jedoch die Aufhebung der Grund- rechte, wodurch SS und SA nun freie Hand hatten, um gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. Somit wurde der rechtsradikale Terror legalisiert. Da keine weiteren Aus- führungsbestimmungen durch den Innenminister folgten, waren den Möglichkeiten zu willkürlicher Auslegung und Ausweitung keine Grenzen gesetzt. Aufgrund dieser Reichstagsbrandnotverordnung wurden Tausende Kommunisten verhaftet, in erste Konzentrationslager gebracht, gefoltert und sogar schon getötet. Sie wurde außerdem genutzt, um durch Verbote Druck auf die SPD auszuüben, und die Position der NSDAP für die Wahlen am 5. März zu stärken.
Durch die offenkundige Instrumentalisierung der Reichstagsbrandnotverordung für die Zwecke der Nationalsozialisten, ist schon hier und nicht erst im späteren Ermächti- gungsgesetz die Basis des Rechtsstaates verlassen worden. Im übrigen ist die Reichs- tagsbrandnotverordnung, im Gegensatz zu allen vorherigen Notverordnungen, die nur eine Gültigkeit von einem halben Jahr hatten, bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nie außer Kraft gesetzt worden. Sie diente somit bis zum Zusammenbruch der NS-Herrschaft zur Begründung der willkürlichen Terrormaßnahmen der NS- NS-Regierung und kann somit als ein Teil, neben dem Ermächtigungsgesetz, des Grundgesetzes der nationalsozialistischen Diktatur bezeichnet werden.
3.3. Ziele und Absichten der Regierung Hitler
Die Planungen der NSDAP zur Begründung eines Ermächtigungsgesetzes gehen bereits auf August bzw. November 1932 zurück, auf eine Zeit, an der sie noch nicht an der politischen Macht war. In Goebbels Tagebuch findet man unter dem 6. August 1932 folgende Eintragung: „Wenn der Reichstag ein vom Führer gefordertes Ermächtigungs- gesetz ablehnt, wird er nach Hause geschickt.“ Goebbels rechnete also damit, daß Hitler bald vom Reichspräsidenten zum Reichskanzler ernannt werden würde. Auch Hitler war sich sicher, daß er bald zum Reichskanzler ernannt werden würde, da er in einem Brief vom 23.11.1932 an den Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten auf ein Schreiben vom Vortag über Verhandlungen zur Regierungsbildung folgende konkrete Angaben über ein Ermächtigungsgesetz macht: „Es ist daher in der Zukunft die Aufga- be eines Kanzlers, der [...] die Schwerfälligkeit des parlamentarischen Vorgehens als gefährliche Hemmung ansieht, sich eine Mehrheit für ein aufgabenmäßig begrenztes und zeitlich fixiertes Ermächtigungsgesetz zu sichern.“ Somit ist bereits hier die Ab- sicht Hitlers zu erkennen, die Möglichkeiten eines Ermächtigungsgesetzes auszunutzen, um die Verfassung auszuhöhlen.
Als am 30. Januar 1933 Hitler tatsächlich von Reichspräsident Hindenburg zum neuen Reichskanzler ernannt wird, ist in der am gleichen Tag geführten ersten Ministerbe- sprechung ein Hauptdiskussionspunkt ein Ermächtigungsgesetz und dessen Verab- schiedung im Reichstag. Anzumerken ist, daß die Regierungskoalition nur knapp 40% der Stimmen des Reichstages besaß, jedoch eine Zweidrittelmehrheit benötigte, um das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden. Hitler und Göring schlugen die Auflösung des Reichstages vor, um nach der anschließenden Wahl eine Zweidrittelmehrheit hinter sich zu vereinigen, mit der die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes möglich wäre. Auch Reichskommissar Dr. Gereke schlug Neuwahlen vor, da das Zentrum zur neuen Regierung eine ablehnende Haltung hatte und diese einem Ermächtigungsgesetz ihre Stimmen zu diesem Zeitpunkt verweigert hätten. Reichswirtschaftsminister Hugenberg hingegen war überzeugt, daß ein Verbot der KPD unumgänglich sei, um die erforderli- che Zweidrittelmehrheit zu erlangen. Staatssekretär Dr. Meißner vertrat die Meinung, ein Ermächtigungsgesetz zu beantragen, das der Regierung nur Maßnahmen zur Be- kämpfung der Arbeitslosigkeit erlaubt, da ein solches Ermächtigungsgesetz nur eine einfache Mehrheit erfordere und diese Mehrheit einfacher zu erreichen gewesen wäre.
In der am 31. Januar 1933 stattgefundenen Ministerbesprechung teilte Hitler dem Kabi- nett das Ergebnis einer Unterredung mit Zentrumsvertretern mit, die ihm zu dem Ent- schluß veranlaßten, daß Verhandlungen mit dem Zentrum über eine Vertagung des Reichstages auf ein Jahr sinnlos seien. Diese Zeit plante er zu nutzen, um auch ohne das Ermächtigungsgesetz, mit Hilfe von Notverordnungen zu regieren, um auf diese Weise die parlamentarische Demokratie weiter zu schwächen und auszuhöhlen. Da dieses Vorhaben jedoch scheiterte; vertrat er den Standpunkt, daß bei den nächsten Reichs- tagswahlen, die nach seiner und von Papens Meinung die letzten Wahlen zum Reichs- tag sein sollten, und es keine Rückkehr zum parlamentarischen System gäbe, die NSDAP mindestens 51% der Stimmen erreichen könne. In diesem Zusammenhang ist auch die Äußerung des Fraktionsvorsitzenden der DNVP; Ernst Oberfohren; vom 17. Februar zu sehen, in der er sagt: „Wenn wir die parlamentarische Mehrheit erhalten haben, wird nicht Parlament gespielt. Dann wird ein Ermächtigungsgesetz gemacht, und der Reichstag wird ein oder zwei Jahre nach Hause geschickt.“1
In der Ministerbesprechung vom 7. März 1933, in der die Regierungskoalition die Reichstagsbrandnotverordung und die errungenen 51% der Stimmen bei den Wahlen vom 5.März im Rücken hatte, war Hitler davon überzeugt, daß der Reichstag ein Er- mächtigungsgesetz verabschieden werde. Grund hierfür war, daß sich die Abgeordneten der KPD aufgrund der Reichstagsbrandnotverordnung schon in Haft bzw. auf der Flucht befanden. Göring teilte diese Meinung und kündigte eine Änderung der Ge- schäftsordnung des Reichstages an, in der die unentschuldigt abwesenden Mitglieder als anwesend zu zähle n wären, um einer parlamentarischen Obstruktion vorzubeugen. Wei- terhin führte er aus, daß der Fraktionsgeschäftsführer des Zentrums der Preußischen Zentrumsfraktion, Grass, schon vor der Wahl bei ihm gewesen sei, und seine Zustim- mung zu einer Mitarbeit gegeben habe, wenn keine Personalveränderungen in der Re- gierung stattfänden. Offensichtlich glaubte das Zentrum an eine “Einrahmung“ der Na- tionalsozialisten durch Papen und seine sieben weiteren konservativen Minister. Aber Göring, sich dieser Haltung bewußt, drohte mit der Entlassung aller dem Zentrum zu- gehörigen Beamten, wenn das Zentrum dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmen sollte. Somit stand für Hitler fest, daß das geplante Ermächtigungsgesetz, wie er es im November 1932 angedacht hatte, sogar mit der Zustimmung des Reichstages verwirk- licht werden kann. Seine Forderungen nach einem Ermächtigungsgesetz waren zu die- sem Zeitpunkt aus der parlamentarischen Situation heraus nicht begründet, da die Re- gierungskoalition bereits über eine absolute Mehrheit verfügte und somit im Verfas- sungsrahmen einer parlamentarischen Demokratie regieren konnte. Dies läßt schon hier die Absicht Hitlers erkennen, die verfassungsmäßigen Möglichkeiten eines Ermächtigungsgesetzes zu mißbrauchen.
In der am 15. März 1933 stattgefundenen Ministerbesprechung werden die Absichten der Nationalsozialisten noch deutlicher, da Reichsinnenminister Frick den Vorschlag unterbreitete, das Ermächtigungsgesetz in der Form abzufassen, daß von jeder Bestim- mung der Weimarer Reichsverfassung abgewichen werden könne. Somit erweiterte er den Entwurf Hitlers vom 23.11.1932, der damals nur ein aufgabenmäßig begrenztes Ermächtigungsgesetz in Planung hatte. Außerdem sollte nach Fricks Meinung die Gül- tigkeit des Ermächtigungsgesetzes von der Regierung Hitler abhängig sein. Nach Fricks Ausführungen äußerten Hitler und Göring abermals, daß sie überzeugt seien, daß die erforderliche Mehrheit erreicht werde, schlossen aber für den Fall der Fälle nicht aus, daß man einige Sozialdemokraten aus dem Saal verweisen könne, um dann die erforderliche Mehrheit zu erlangen. Den Deutschnationalen Ministern gefielen diese Absichten der Erweiterung des Ermächtigungsgesetzes nicht, da sie für eine weitere Stärkung der Rechte des Reichspräsidenten eintraten. Deshalb versuchte von Hugenberg noch in der selben Ministerbesprechung den Reichspräsidenten in die Mitwirkung bei der Beratung über das Gesetz miteinzubeziehen. Dieser Vorschlag wurde aber von Staatssekretär Dr. Meißner als unnötig kritisiert, der nur bei später zu beschließenden besonderen Gesetzen den Reichspräsidenten hinzuziehen wollte. Ein zweiter Versuch der Deutschnationalen, das Ermächtigungsgesetz zu beschränken scheiterte ebenfalls. Als Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk und Reichsminister Johannes Popitz „den Kreis der diesem Gesetz unterliegenden Gegenstände einzuschränken“ versuchten und beantragten, daß wenigstens die Kreditgesetze vom Reichstag verabschiedet werden sollten, stimmte Hitler zuerst zu, lehnte in der nächsten Sitzung den Vorschlag wieder ab. Er begründete sein Verhalten damit, daß die Parteiführer der übrigen Parteien mit dem Ermächtigungsgesetz einverstanden seien und keine Beschränkungen, sondern nur die Unterrichtung eines Ausschusses gewünscht hätten. Zu diesem Zeitpunkt fanden jedoch noch keine Verhandlungen mit anderen Parteien statt. Somit kann man sagen, daß Hitler bewußt seine eigenen Minister belogen hat, um seine Ziele zu erreichen. Auch ein letzter Versuch von Papens, den Reichspräsidenten in die Beratungen über das Ermächtigungsgesetz einzubeziehen scheiterten, obwohl er von Reichsjustizminister Dr. Gürtner unterstützt wurde. Da alle Bemühungen umsonst waren, hatte Hitler sich längst aus seiner „Einrahmung“ befreit, oder er es nie war.
Am 18. März 1933 wurde dann der endgültige Gesetzestext des Ermächtigungsgesetzes im Reichsministerium des Inneren geschrieben, der dann am 20. März in der Kabinettssitzung vorgelegt wurde.
3.4. Innerparteiliche Beratungen des Zentrums und die Ver- handlungen mit Hitler über das Ermächtigungsgesetz
Bei der Annahme des Ermächtigungsgesetzes in der Krolloper vom 23 März 1933 kam dem Zentrum eine besondere Rolle zuteil. Sie war bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 mit 11,2 % der Stimmen viertstärkste Partei geworden, und besaß somit 74 Man- date im Reichstag. Dadurch wurde sie zum „Zünglein an der Waage“ bei der Abstim- mung zum Ermächtigungsgesetz, da die Anzahl der Mandate die SPD und KPD erreicht hatten, nicht zur Verhinderung eines Ermächtigungsgesetzes genügt hätten. SPD und KPD besaßen zusammen nur 201 Mandate (SPD: 120 Mandate; KPD: 81 Mandate). Um das Ermächtigungsgesetz scheitern zu lassen, hätten sie aber 216 Stimmen ge- braucht. Außerdem waren die Mandatsträger der KPD und ein Teil der Mandatsträger der SPD entweder auf der Flucht oder saßen im Gefängnis. Seitdem die Reichstags- brandnotverordnung in Kraft getreten war, lagen gegen sie Haftbefehle wegen kommu- nistischer Agitation und revolutionistischer Umtriebe vor. Aufgrund dieser besonderen Umstände, und der Tatsache, daß einerseits die Deutschnationale Volkspartei als auch die Deutsche Staatspartei eine Zusage zum Ermächtigungsgesetz angedeutet bzw. zuge- sagt hatten, lag es in der Hand des Zentrums und der ihr nahestehenden Bayerischen Volkspartei, ob das Ermächtigungsgesetz verabschiedet werden würde oder nicht.
Darüber waren sich Hitler und dessen Kabinett bewußt. Unmittelbar nach Beendigung ihrer Beratungen in den Ministerbesprechungen über das geplante Ermächtigungsgesetz wurde eine Unterredung zwischen Vertretern1 des Zentrums und Reic hskanzler Hitler sowie Reichsinnenminister Frick für den 20 März 1933 anberaumt. In der am gleichen Tag noch stattgefundenen Ministerbesprechung berichtete Hitler über die Ergebnisse des Gespräches. Er führte aus, daß die Vertreter des Zentrums die von ihm begründete Notwendigkeit eines Ermächtigungsgesetz eingesehen und nur die Bitte geäußert hät- ten, ein Gremium zu bilden, das über alle Maßnahmen, welche aufgrund des Ermächti- gungsgesetzes getroffen würden, zu unterrichten sei. Hitler äußerte, daß er dieser Bitte nachkommen wolle, um die Zustimmung des Zentrums zum Ermächtigungsgesetz zu sichern. Am Ende dieser Sitzung stimmte das Reichskabinett dem vorgelegtem Entwurf des Ermächtigungsgesetzes zu2.
Ebenfalls am 20. März 1933 berichtete Prälat Ludwig Kaas1 in einer Sitzung des Vor- standes der Zentrumsfraktion seinerseits über die Unterredung mit Reichskanzler Hitler. In seinem Bericht nennt er Hitlers Grund zu einem Ermächtigungsgesetz: Hitler vermu- te ein Wiederaufleben der kommunistischen Agitation. Weiterhin berichtete er, daß die inhaftierten SPD - Politiker weiterhin in Haft blieben. Daraus zog er die Konsequenz, daß jegliche Sympathisierung mit der SPD zu unterlassen sei, um nicht dem Zentrum selbst zu schaden. Prälat Kaas beendete seinen Bericht einerseits mit Bekanntgabe der Zusicherung Hitlers, daß sowohl die Rechte des Reichspräsidenten als auch die Rechte des Reichstages und des Reichsrates erhalten bleiben sollten. Andererseits berichtete er von der Entschlossenheit Hitlers, sich diese Vollmacht zu verschaffen. In einer eben- falls noch am 20 März 1933 stattgefundenen Sitzung der Zentrumsfraktion ging Prälat Kaas nicht detailliert auf die Ergebnisse der Unterredung mit Hitler ein, sondern er sprach von einer Einengung der bisherigen Arbeitsmethoden, die aber einer morali- schen Bindung vorzuziehen sei, die die Zentrumspartei auf lange Zeit entrechnen würde. Dies bedeutet, daß er die sozialdemokratische SPD bei der Abstimmung zum Ermächtigungsgesetz im Stich lassen wollte, um damit mögliche Gewaltakte gegen das Zentrum zu verhindern.
Am 21. März 1933, dem Tag von Potsdam, wurde der neue Reichstag in der Potsdamer Garnisonskirche eröffnet. Während dem Volk eine inszenierte Verbindung der preußi- schen Tradition und der neuen Regierung vorgespielt wurde, reichten NSDAP und DNVP- Fraktion den Antrag zu einem Ermächtigungsgesetz ein, das jede vorhergegan- genen Tradition brechen sollte. Als Reaktion auf die Vorlage dieses Entwurfes schreibt Eugen Bolz2, Vorstandsmitglied des Zentrums, seiner Frau, daß der Inhalt des Entwur- fes alle Erwartungen überträfe und daß das Zentrum sich in der schwierigsten Situation seit der Annahme des Versailler Vertrages befände. In der am darauffolgendem Tag, dem 22. März 1933, stattgefundenen Vorstandssitzung des Zentrums teilte Prälat Kaas mit, daß er um 16 Uhr zu Reichskanzler Hitler bestellt sei, er aber diesen Termin für verfrüht halte, da man noch keine klärende Beschlußfassung für möglich halte. Er woll- te deshalb an dem betreffenden Termin versuchen, Änderungen, die er für kaum mög- lich hielt, vorzunehmen. Diese Veränderungen sollten vorerst sein:
- das Ausfertigungsrecht des Reichspräsidenten wiederherstellen oder ein internes Vetorecht , evtl. die Verkürzung der Dauer
- Klarstellung des Begriffes „jetzige Reichsregierung“
- Gremialbesprechungen
- Ausklammerung von Einzelheiten aus der Ermächtigung, die bereits Bestandteil der alten, kaiserlichen Verfassung waren, wie z.B. das Verhältnis von Staat und Schule, sowie Staat und Kirche.
An diesem Tag schreibt Eugen Bolz an seine Frau: „Hier ringen wir, jeder für sich, mit der Stellungnahme zu dem unerhörten Ermächtigungsgesetz. Das Für und Wider kann ich nicht schreiben. Die Zwangslage wird uns wohl zu einer Zustimmung bringen.“ Auch der BVP Abgeordnete Anton Wiedemann schildert seiner Frau in einem Brief die Situation als aussichtslos: „Es ist nichts anderes als sein Todesurteil selbst zu schreiben. Doch so oder so. Willst du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Fest steht für mich, daß die Machthaber das Heft nicht mehr so schnell aus der Hand geben.“ Beide erkannten die Ausweglosigkeit ihrer Lage, stimmten aber in der Hoffnung auf Verschonung beide dem Ermächtigungsgesetz zu.
Noch am gleichen Tag fand eine weitere Sitzung des Vorstandes des Zentrums statt, in der Prälat Kaas über die Unterredung mit Hitler berichtete, die er in der Zwischenzeit geführt hatte. In dieser wurden die Grundlage für eine Zustimmung der Zentrumsfrakti- on geklärt:
I) Einschaltung des Reichspräsidenten
II) Nähere Klärung des Arbeitsgremiums
III) Ausschaltung von Einzelgegenständen aus der Ermächtigung
Zu jedem dieser Punkte machte Prälat Kaas genauere Ausführungen:
Ad I) Prälat Kaas war überrascht über den Wortlaut des Ermächtigungsgesetzes und die Ausschaltung des Reichspräsidenten beim Vollzug der Gesetze aus der Ermächtigung. Des weiteren war er nicht mit der Dauer des Ermächtigungsgesetzes einverstanden. Hitler begründete die lange Zeitspanne damit, daß Staat, Finanzen und Außenpolitik diesen Zeitraum verlangt hätten. Prälat Kaas widersprach zwar; Hitler jedoch ging dar- auf nicht weiter ein, sondern kam auf die Rolle des Reichspräsidenten zu sprechen: Nach Hitlers Aussagen zufolge sollten die Rechte des Reichspräsidenten - auch das Recht, den Reichskanzler abzusetzen - weiterhin bestehen bleiben. Außerdem betonte er, daß er bei einer Meinungsverschiedenheit mit dem Reichspräsidenten nachgeben würde.
Ad II) Der Vorschlag einer Einrichtung eines Arbeitsgremiums wurde von Hitler positiv aufgenommen, wie Prälat Kaas berichtete. Die zu klärende Frage war, wie das Gremium zu besetzen sei. Einig war man sich dagegen in dem Punkt, daß keine Marxisten zum Gremium zugelassen werden sollten.
Ad III) Das Zentrum verlangte, einen bestimmten Status quo beizubehalten, der nicht mit Hilfe eines Ermächtigungsgesetzes verändert werden könne. Die bei den Verhand- lungen zwischen Kaas und Hitler gemachten Zusagen Hitlers zu den einzelnen aus der Ermächtigung fallenden Gegenstände, waren ein wichtiger Grund für die spätere Zu- stimmung des Zentrums. Eine erste Zusage Hitlers gegenüber dem Zentrum war, daß Fragen über Schulpolitik und dem Verhältnis zwischen Staat und Religion nicht über das Ermächtigungsgesetz geklärt werden sollten. Eine Ausnahme sollte das Judentum darstellen, da Hitler erklärte, daß dies keine Religion sei, sondern eine fremde Rasse. Beim Verhandlungspunkt über die Grundrechte, die durch die Reichstagsbrandnotver- ordnung außer Kraft gesetzt worden waren, sicherte Hitler wieder eine Einführung mit der Einschränkung, daß Kommunisten ihre Grundrechte nicht zurück erhalten sollten, zu. Weiterhin berichtete Kaas über die Ergebnisse der Verhandlungen zu der Unabsetz- barkeit der Richter, die Hitler vorgab nicht anrühren zu wollen. Des weiteren sicherte Hitler zu, dem Zentrum zugehörende Beamte nicht zu entlassen, als auch den Fortbe- stand des Reichstages, des Reichsrates und der Weimarer Verfassung selbst, die tatsächlich bis 1945 gültig blieb. Somit hatte Hitler zu allen Forderungen des Zentrums verbale Zugaben gegeben. Am Schluß der Verhandlungen mit Kaas jedoch hatte er es nicht versäumt darauf hinzuweisen, daß er bei der Nicht-Annahme des Ermächtigungs- gesetzes die ihm notwendig erscheinenden Maßnahmen über den Weg des Staatsnot- standes durchzusetzen gedenke, wie er es schon im Fall der Reichstagsbrandnotverord- nung getan hatte.
Die Öffentlichkeit sollte, nachdem eine Bestätigung der Forderungen in Form einer Regierungserklärung beim Zentrum eingegangen ist, informiert werden. Außerdem hatte Kaas Hitler den Vorschlag gemacht, die wesentlichen Punkte dieser Besprechung in der Regierungserklärung vorzutragen.
Bei dieser Unterredung wurde jedoch nicht geklärt, welche Rolle nun der Reichstag spielen sollte, wenn das Ermächtigungsgesetz verabschiedet war. Prälat Kaas hatte bis- her von Hitler nur die Bestätigung bekommen, daß der Reichstag und der Reichsrat weiterhin bestehen bleiben sollten. Prälat Kaas hatte keine Forderung an Hitler gestellt, wie die Rolle des Reichstages aussehen sollte. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß Prälat Kaas glaubte, durch die Fortexistenz des Reichstages auch die Fortexistenz der Rechte des Reichstages gesichert zu haben.
4. Der Tag der Abstimmung
Am Morgen des 23. März fand eine Sitzung der Zentrumsfraktion statt, in der Prälat Kaas der gesamten Fraktion die Ergebnisse seiner Unterredung mit Hitler vom 22. März 1933 darlegte. Prälat Kaas berichtete, daß Hitler auf alle Forderungen, auch auf Forde- rungen, die Hitler in seiner Machtausübung auch nach Verabschiedung des Ermächti- gungsgesetzes weiterhin einschränken sollten, eingegangen sei. Er betonte dabei beson- ders, daß Hitler zugesagt habe, keine Maßnahmen gegen den Willen des Reichspräsi- denten durchzuführen, die bestehenden Rechte der christlichen Konfessionen nicht zu verletzen und daß Hitler die Gleichheit vor dem Gesetz, mit Ausnahme der Kommunis- ten wiedereinführen werde. Außerdem sei das Bestehen des Reichstages, des Reichsra- tes und der Länder zugesichert worden. Prälat Kaas behauptete außerdem, daß der Reichstag für die Gesetzgebung eingeschaltet bliebe. Diese Zusage war jedoch von Hitler nie gegeben worden (vgl. 4.4. letzter Abschnitt).
Im Anschluß an seinen Bericht wies Prälat Kaas nochmals auf die schwierige und ent- scheidende Stellung des Zentrums bei der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz hin, wobei er erwähnte, daß die Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes für die Partei unangenehme Folgen hätte: Die Regierung hatte deutlich zum Ausdruck gebracht, die Durchsetzung ihrer Pläne auf anderem Weg zu erreichen. Danach teilte er mit, daß sich auch der Reichspräsident mit dem Ermächtigungsgesetz abgefunden habe, und daß er(Kaas) es ablehne, einen Vorschlag zu machen, wie die Entscheidung der Fraktion ausfallen solle.
Nach Prälat Kaas sprach Dr. Stegerwald, der ebenfalls an der Unterredung mit Hitler teilgenommen hatte. Er ergänzte, daß beabsichtigt sei, den Reichstag mehrere Male im Jahr zusammentreten zu lassen und man ihn nicht ausschalten wolle, wenn er der Reichsregierung keine Schwierigkeiten mache. Diese Aussage Dr. Stegewalds trägt einen Widerspruch in sich, und hätte viele Abgeordnete des Zentrums spätestens in diesem Moment dazu bringen müssen, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Die Frage, ob es nicht die eigentliche Aufgabe eines Parlamentes, und insbesondere die Aufgabe einer Opposition ist, der Regierung “Schwierigkeiten“ zu machen, indem sie alle Mißstände und Fehlentscheidungen der Regierung zu Tage bringt, wurde nicht diskutiert. Das Parlament wird nur noch zur Bühne der Selbstdarstellung der Regierung, da diese ungestört regieren kann.
Genau diese Gefahr erkennend, warnte Dr. Brüning vor dem Ermächtigungsgesetz, welches Hitler erlaubt als Diktator zu regieren und die Verfassung auszuhöhlen. Er hielt es für besonders bedenklich, daß sich auch der Reichspräsident mit diesem Gesetz ab- gefunden hatte. Er hatte diesen während seiner Amtszeit als Reichskanzle r bei der Wahl zum Reichspräsidenten insbesondere mit dem Argument unterstützt, daß Hindenburg ein “Garant und Treuhänder der Verfassung“sei. Brüning gab auch zu bedenken, daß keine Sicherheiten für die Erfüllung der Zusagen gegeben worden seien. Deshalb be- zeichnete Brüning das Ermächtigungsgesetz als “das Ungeheuerlichste, was je von ei- nem Parlament gefordert worden wäre“, und beschloß seine Rede damit, daß er sagte, daß er wahrscheinlich gegen das Ermächtigungsgesetz stimme werde.
Das Argument Brünings, daß keine Sicherheit für die Erfüllung der Zusagen existiere, wurde durch die Regierungserklärung Hitlers entkräftet. In dieser Erklärung machte er verbale Zusagen zu Forderungen, die von Vorstandsmitgliedern des Zentrums am 22. März formuliert worden waren. Er sicherte darin den Weiterbestand der Länder und der Verfassung, die Gleichheit vor dem Gericht1, den Kampf gegen einen staatsfeindlichen Umsturz2, die Unabsetzbarkeit der Richter, die Einbeziehung der christlichen Konfessi- onen in Schule und Erziehung, die Unkündbarkeit der Beamten, die Existenz des Reichstages und des Reichrates und die Stellung und Rechte des Reichspräsidenten zu.
Nach Beendigung der Regierungserklärung wurde die Reichstagssitzung für drei Stunden unterbrochen, um nach der Pause das Ermächtigungsgesetz in 3 Lesungen zu verabschieden. Diese Pause nutzte das Zentrum, das in einer letzten Fraktionssitzung die endgültige Entscheidung fällen wollte, wie man sich entscheiden wolle.
Durch die Zusagen der Forderungen des Zentrums in seiner Regierungserklärung hatte es Hitler geschafft, die meisten Zentrumsabgeordneten davon zu überzeugen, dem Er- mächtigungsgesetz zuzustimmen. Lediglich 14 Abgeordnete des Zentrums stimmten bei einer fraktionsinternen Probeabstimmung dem Ermächtigungsgesetz nicht zu, unter ihnen auch Brüning und Wirth3. Schließlich stimmten auch diese 14 Abgeordneten dem Ermächtigungsgesetz zu, um die Fraktionsdisziplin zu wahren und dem Votum der Mehrheit zu folgen, aber auch um mögliche Gewaltakte gegen sich und die gesamte Partei zu verhindern. Es wurde abschließend bestimmt, daß Prälat Kaas eine Erklärung dazu abgeben sollte.
Als sich die Abgeordneten der Parteien wieder auf den Weg zur Kroll- Oper machten, erwartete sie dort eine von Hitler organisierte Demonstration, die von den Abgeordne- ten forderte: „Gebt uns das Ermächtigungsgesetz, ihr Verräter!“ Der durch diese laut- starke Aufforderung von der Menschenmenge aufgebaute Druck auf die Abgeordneten wurde noch erhöht, als Hitler die Abgeordneten der Parteien nur durch ein enges Spa- lier durch die aufgebrachte Menge hindurch kommen ließ, um die Kroll - Oper zu er- reichen. Dadurch gelang es den Demonstranten, den vorbeigehenden Abgeordneten die Hüte vom Kopf zu schlagen und ihnen an den Haaren zu ziehen. In die Oper selbst hatte Hitler Männer der SA einmarschieren lassen, um die Abgeordneten auch dort einzu- schüchtern und um eine weitgehende Kommunikation der Fraktionen untereinander unmöglich zu machen. Hitler befürchtet, daß einzelne Abgeordnete der SPD versuchen könnten, auf einzelne Abgeordnete anderer Parteien zuzugehen, um diese doch noch von einer Able hnung zu überzeugen.
Bei der Wiedereröffnung des Reichstages durch Reichstagspräsident Göring erhielt zuerst Otto Wels1 das Wort. In seiner Rede versuchte er, die Haltung der SPD gegen das Ermächtigungsgesetz zu rechtfertigen. Am Anfang zählte er eine Reihe von Zustim- mungen zu Forderungen der Nazis, die auch schon die SPD erhoben hätte, auf. So sei auch die SPD für die Revision des Kriegsschuldartikels 2311 des Versailler Vertrages. Danach greift er die Tatsache auf, daß die Regierung Hitler kein Ermächtigungsgesetz brauche, da sie über die absolute Mehrheit im Reichstage verfüge. Weiterhin übte er Kritik gegen den Vorwurf, daß die SPD Greulnachrichten über das neue Deutschland verbreite, wies aber auf die Unterdrückung der freien Presse und die von den Nazis ausgeübte Gewalt hin. Schließlich sprach Otto Wels die Verfolgung linker Politiker durch die Regierung an: es könne niemand mehr behaupten, „daß die volle Rechtssi- cherheit für alle wiederhergestellt sei“. Am Ende der Rede beschwörte er die ewigen Ideen von Gerechtigkeit und Freiheit, für die die SPD eintrat, und grüßte in einem mu- tigen Schlußwort alle bereits Verfolgten und Bedrängten im Deutschen Reich. Durch diese Rede angestachelt ließ sich Hitler zu einer spontanen Erwiderung verleiten, in der er die Behauptung aufstellte, daß die Sozialdemokraten die letzten vierzehn Jahre allein regiert hätten. Unter Verfälschung von Tatsachen behauptete er außerdem, daß das Aus- land die Weimarer Verfassung Deutschland aufoktroyiert hätte. Die Unterdrückung linker Politiker und der linken Presse begründete er mit dem Hinweis auf die langjähri- ge Unterdrückung seiner Partei während der Weimarer Republik. Aber auch dies war eine Lüge, da die Gewalttaten rechtsextremistischer Gruppen meist nur sehr lasch oder gar nicht verfolgt wurden. Am Ende seiner Rede sprach Hitler eine Drohung gegen jeden aus, der sich ihm nicht anschließen wolle, indem er sagte: „Denn ich möchte nicht in den Fehler verfallen, Gegner bloß zu reizen, statt sie entweder zu vernichten oder zu versöhnen.“
Nach Beendigung der Heil-Rufe für Hitlers Rede erteilte Reichstagspräsident Göring Prälat Kaas das Wort. Dieser erkläre in einer kurzen Rede, daß die von Hitler gemach- ten Zusagen, die er in seiner Rede nochmals bekräftigt habe, dazu führten, daß „eine Reihe wesentlicher Bedenken, welche die zeitliche und die sachliche Ausdehnung des Ermächtigungsgesetzes der Regierung ausgelöst hatte, auslösen mußten, anders zu beurteilen.“ Ähnliche Erklärungen machten auch Ritter von Lex, Vertreter der BVP, Reinhold Maier für die Staatspartei und Simpfendörfer für die Volkspartei.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, rief Reichstagspräsident Hermann Göring zur namentlichen Abstimmung auf. Diese ergab folgendes Ergebnis: Bei 535 abgegebenen Karten stimmten 94 mit Nein und 441 mit Ja. Diese Zahlen wurden später noch einmal korrigiert, da 538 Karten abgegeben wurden, diese aber lediglich die Zahl der Ja- Stimmen auf 444 erhöhten.
Damit war das Ermächtigungsgesetz mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet und trat am nächsten Tag, dem 24. März, in Kraft.
5. Die Folgen des Ermächtigungsgesetzes
5.1. Unmittelbare Folgen des Ermächtigungsgesetzes
Durch das Inkrafttreten des Ermächtigungsgesetzes war es Hitler gelungen, die Weima- rer Verfassung vollkommen auszuhöhlen und seinem Handeln den Schein von Legalität zu geben. Er hatte erreicht, das Prinzip der Gewaltenteilung zu durchbrechen, indem die Legislative der Exekutive die Befugnis zum Erlaß von Gesetzen eingeräumt hatte. Zwar wurde die Weimarer Verfassung nie abgeschafft, jedoch umging er sie durch das Er- mächtigungsgesetz und die Reichstagsbrandnotverordnung, in dem Maße, daß er da- durch diktatorische Vollmachten erlangen konnte. So erteilt Artikel 1 des Ermächti- gungsgesetzes der Regierung das Recht, jegliche Art von Gesetzen zu verabschieden, selbst wenn diese Gesetze inhaltlich von der Weimarer Verfassung abweichen sollten.
Dieser Artikel enthält zwar Beschränkungen, daß solche Gesetze nicht den Reichstag und den Reichsrat abschaffen dürften und daß die Rechte des Reichspräsidenten ge- wahrt bleiben sollten, jedoch sollten sich beide Beschränkungen als unbrauchbar erwei- sen. Nach dem Tod Hindenburgs übernahm Hitler dessen Amtsbefugnisse als Reic hs- präsident. Durch die Beseitigung der Länder am 30.01.1934, brach er nicht nur eine an das Zentrum gegebene Zusage, sondern schaffte schließlich durch ein Gesetz vom 14.02.1934 den Reichsrat ab. Da Hitler sich nicht an seine dem Zentrum gegenüber gemachten Zusagen hielt, kam es zur Selbstauflösung oder zum Verbot aller Parteien der Weimarer Republik. Die Folge war, daß Hitler am 14.07.1933 das „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ verkündete, und die einst von einer großen Parteienviel- falt gekennzeichnete Weimarer Republik, in einen Einparteienstaat mit einem “Führer“ an ihrer Spitze verwandelt hatte.
5.2. Die Folgen des Ermächtigungsgesetzes auf die BRD
Da es erlaubt war, auch Gesetze zu beschließen, die von der Weimarer Verfassung abweichen konnten, ist bis heute nicht geklärt, ob manche Rechtsurteile im Dritten Reich nach gültigem Recht oder aus Willkür gefällt wurden. Wird heute ein solcher Fall neu verhandelt, muß zuerst diese Frage geklärt werden.
Das Ermächtigungsgesetz hatte auch Folgen auf unsere heutige Verfassung. So können zwar im Prinzip alle Grundgesetzartikel mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden, um jedoch einer Entstellung oder Abschaffung unserer freiheitlich- demokratischen Grundordnung vorzubeugen, sind im Grundgesetz gewisse „Garantieklausen“ enthalten. Zum einem ist dies Art. 19,2 GG; dieser besagt, daß kein Artikel der Verfassung so verändert werden darf, daß sein Wesen völlig entstellt oder geändert wird. (Wesensge- haltsgarantie). Zum anderen ist dies Art. 79,3 GG, der das föderative Prinzip der Bun- desrepublik schützt. Weiterhin schützt er Art. 1 GG und damit den Grundrechtskatalog 1-19. Des weiteren schützt er Art. 20 GG und damit die Selbstdefinition der BRD als ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (Art. 20,1), sowie den Merkmalskatalog des demokratischen Systems (Art.20, 2-4).
6. Zusammenfassung und Ausblick
Adolf Hitler erlangte durch heuchlerische Zusagen und Lügen das Vertrauen großer Teile des Zentrums. Angst vor Einschüchterungen und einer Behandlung ähnlich der der SPD und der KPD spielten eine wesentliche Rolle dafür, daß sich das Zentrum für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes entschied. Man war außerdem dem Irrglauben aufgesessen, durch dieses Ermächtigungsgesetz Hitler besser kontrollieren zu können. Es gab zwar einige wenige Beschränkungen im Gesetz, die sich jedoch als unnütz er- wiesen1.
Viele Abgeordnete des Zentrums versuchten nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ihre Zustimmung zu rechtfertigen; immerhin war Hitler durch deren Zustim- mung zu diktatorischen Vollmachten gelangt. Der Verfasser ist jedoch der Meinung, daß sie noch nicht wissen konnten, wem genau sie dort in die Hände gespielt hatten. Es gab zwar schon erste Opfer des Hitler-Regimes, aber eine Vorstellung, von dem was tatsächlich noch geschehen sollte, hatte zu jenem Zeitpunkt noch niemand. Heute sind Historiker sich einig, daß Hitler auch ohne die gesetzliche Grundlage seinen Totalitäts- anspruch, vielleicht mit der Folge noch größerer Opfer unter oppositionellen Politikern, verwirklicht hätte.
Das Ermächtigungsgesetz zeigt auch die Schwächen der Weimarer Verfassung. So sehr die “Verfassungsväter“ von Weimar auf ein großes Maß an Liberalismus und Demokra- tie wert legten, so sehr wurden diese Freiheiten von den Nazis ausgenutzt. Die “Verfas- sungsväter“ unserer Verfassung waren sich dieser Sachlage bewußt, und konstituierten ein Grundgesetz, das sich vom “Rechtspositivismus der Weimarer Republik“2 absetzt, und sich damit auf ein Demokratieverständnis stützt, „in welchem sich Demokratie nicht auf Mehrheitsentscheid allein reduziert“3.
7. Literaturverzeichnis
Benz, Wofgang; Graml, Hermann; Weiß, Hermann (Hrsg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus; Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1997
Karl Dietrich Erdmann,
Deutschland unter der Herrschaft des Nationalsozia- lismus 1933- 1939 Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Band 20 Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1980
Groenewald, Sabine (Hrsg.): Wels, Otto: Rede zur Begründung der Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes durch die Sozialdemokratische Fraktion in der Reichstagssitzung vom 23. März 1933 in der Berliner Krolloper, mit einem Essay von Irving Fetscher; Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1993
Haffner, Sebastian: Von Bismarck zu Hitler Ein Rückblick; Kindler Verlag GmbH, München 1987
Jasper, Gotthard: Die gescheiterte Zähmung; Wege zur Machtergreifung Hitlers 1930-1934; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1986
Morsey, Rudolf (Hrsg.): Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933; Quellen zur Geschichte und Interpretation des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich; Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 1992
Schumacher, Martin (Hrsg.): M.d.R. Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus; Politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933- 1945; Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 1991
8. Anhang
Anhang A Namentliche Abstimmung der 2. Sitzung am Donnerstag, den 23.März 1933; Schlußabstimmung über den von den Abgeordneten Dr. Frick, Dr. Oberfohren und Genossen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich
Anhang B Entwurf des Ermächtigungsgesetzes vom 18. März
Anhang C Ermächtigungsgesetz vom 24. März
Anhang D Die Gesetzgebung aufgrund des Ermächtigungsgesetzes 1933 - 1945
[...]
1 vgl. Rudolf Morsey: Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933; Quellen zur Geschichte und Interpretation des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich, Düsseldorf, 1992
1 vgl. Frankfurter Zeitung Nr. 133 vom 18. Februar 1933
1 Die Vertreter des Zentrums waren Kaas, Stegerwald und Hackelsberger
2 Der Entwurf entspricht wörtlich dem am 18. März vom Reichsminister des Innern vorgelegten Text.
1 Ludwig Kaas (1881-1952): Mitglied des Reichstages von Januar 1919 bis November 1933; 1928 - 1933 Vorsitzender des Zentrums; wirkte beim Abschluß des Reichskonkordats mit; im römischen Exil Berater Papst Pius` XII mit Kontakten zum dt. Widerstand und der brit. Regierung.
2 Eugen Bolz (1881- 1945): Mitglied des Reichstages von Januar 1912 bis November 1933; im Januar 1945 hingerichtet wegen Aufforderung zum Hochverrat und Feindbegünstigung.
1 Kommunisten sollten weiterhin ohne ihre Rechte bleiben.
2 Hitler spielt hier auf den Reichstagsbrand an.
3 Joseph Karl Wirth (1879-1956); seit 1914 Mitglied des Reichstages; 1921/22 Reichskanzler; verließ die Sitzung der Zentrumsfraktion am 23. März nach der Probeabstimmung über das Ermächtigungsgesetz, wurde zurückgeholt und stimmte schließlich zu.
1 Otto Wels (1878-1939); seit 1912 Mitglied des Reichstages, 1933 Vorsitzender der SPD-Fraktion, starb 1939 im Exil
1 vgl. Artikel des Versailler Vertrages, der Deutschland die alleinige Kriegsschuld am Ausbruch des 1. Weltkrieges gab.
1 Gemeint sind die in Punkt 5.1 erwähnten Beschränkungen durch den Reichspräsidenten und den Fortbestand Reictag und Reisrat
2 vgl. Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, in: Grundwissen Politik, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1991, S.52
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit über das Ermächtigungsgesetz?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Umstände aufzuzeigen, die zur Annahme des Ermächtigungsgesetzes führten, das Verhalten der Regierung Hitler, die Rolle des Zentrums und die Folgen des Gesetzes für die Weimarer Republik und die BRD zu untersuchen.
Wie war die verfassungspolitische Lage am Ende der Weimarer Republik?
Die Weimarer Republik war durch Präsidialkabinette geprägt, die vom Wohlwollen des Reichspräsidenten abhängig waren. Notverordnungen wurden häufig eingesetzt, was den Reichstag entmachtete und die Bevölkerung daran gewöhnte.
Was waren die wichtigsten Entwicklungen bis zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes?
Die Machtergreifung Hitlers, der Reichstagsbrand und die anschließende Reichstagsbrandnotverordnung, Hitlers Ziele und Absichten sowie die Verhandlungen mit dem Zentrum über das Ermächtigungsgesetz waren entscheidende Entwicklungen.
Welche Rolle spielte der Reichstagsbrand?
Der Reichstagsbrand wurde von der Regierung Hitler genutzt, um gegen die KPD vorzugehen und die eigene Macht auszubauen. Die Reichstagsbrandnotverordnung schränkte Grundrechte ein und legalisierte den Terror.
Was waren Hitlers Ziele und Absichten bezüglich des Ermächtigungsgesetzes?
Hitler plante bereits frühzeitig ein Ermächtigungsgesetz, um die Verfassung auszuhöhlen und seine Machtbasis auszubauen. Er war bereit, Lügen und Drohungen einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen.
Welche Rolle spielte das Zentrum bei der Annahme des Ermächtigungsgesetzes?
Das Zentrum hatte eine Schlüsselrolle, da es die nötige Mehrheit für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes sichern konnte. Hitler machte Zugeständnisse, um die Zustimmung des Zentrums zu gewinnen.
Was geschah am Tag der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz?
Am 23. März 1933 fanden intensive Beratungen innerhalb des Zentrums statt. Otto Wels hielt eine Rede gegen das Ermächtigungsgesetz, aber Hitler konnte die meisten Abgeordneten des Zentrums überzeugen. Das Gesetz wurde schließlich mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet.
Was waren die unmittelbaren Folgen des Ermächtigungsgesetzes?
Das Ermächtigungsgesetz ermöglichte Hitler, die Weimarer Verfassung auszuhöhlen und diktatorische Vollmachten zu erlangen. Das Prinzip der Gewaltenteilung wurde durchbrochen und die Länder wurden beseitigt.
Welche Folgen hat das Ermächtigungsgesetz für die Bundesrepublik Deutschland?
Das Ermächtigungsgesetz wirft bis heute Fragen nach der Rechtmäßigkeit von Urteilen im Dritten Reich auf. Es führte zur Einführung von Garantieklauseln im Grundgesetz, um eine Entstellung oder Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verhindern.
Was war die Zusammenfassung und der Ausblick der Arbeit?
Hitler erlangte durch Täuschung das Vertrauen des Zentrums. Das Ermächtigungsgesetz zeigt die Schwächen der Weimarer Verfassung. Das Grundgesetz der BRD setzt sich vom "Rechtspositivismus der Weimarer Republik" ab und stützt sich auf ein Demokratieverständnis, das sich nicht auf Mehrheitsentscheide allein reduziert.
- Arbeit zitieren
- Eric Hower (Autor:in), 1999, Das Ermächtigungsgesetz 1933, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95234