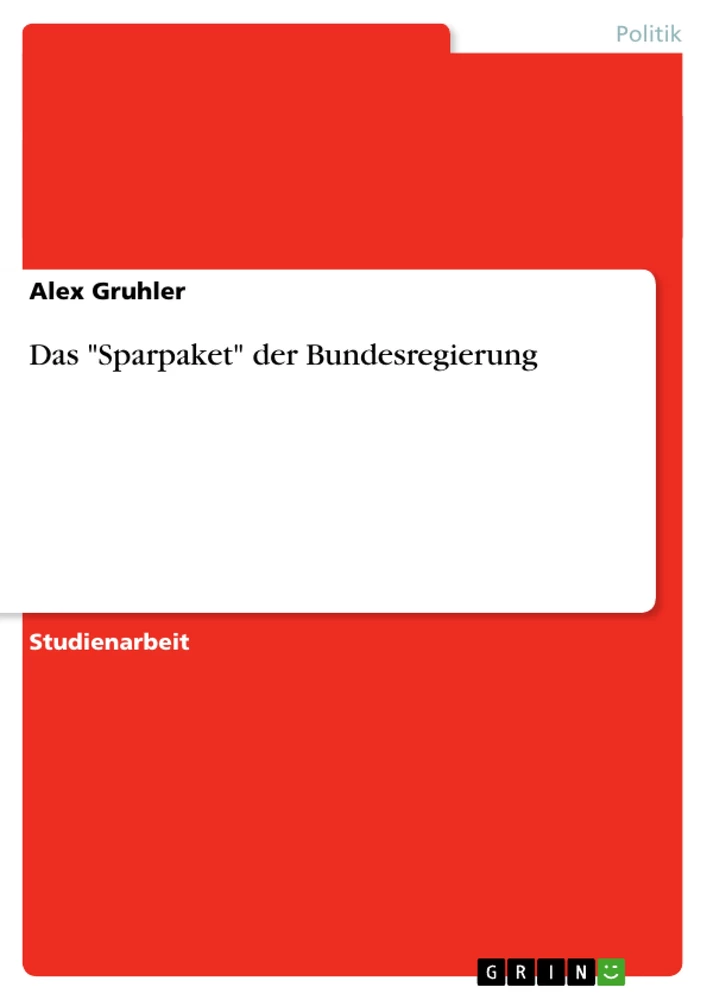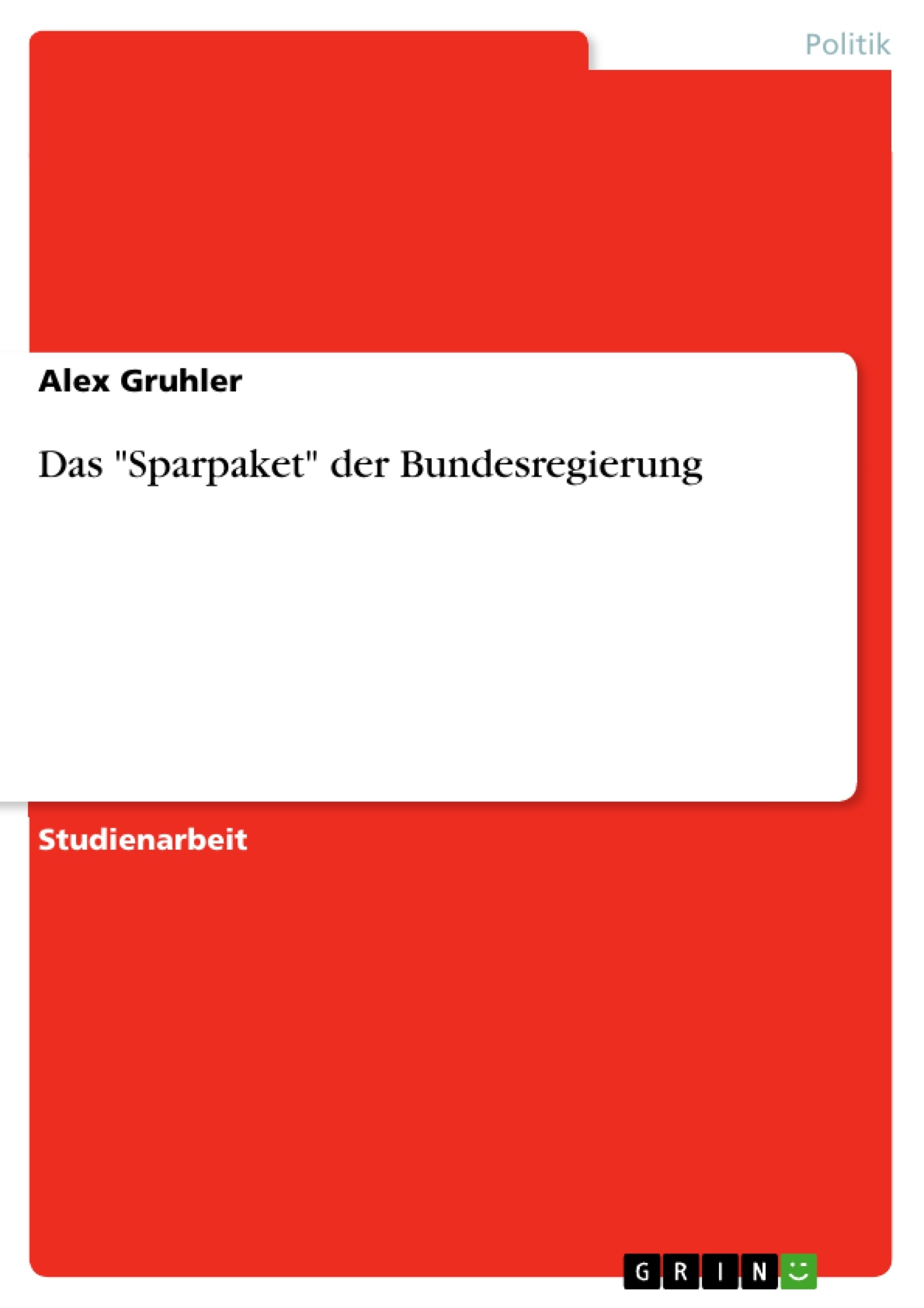Wie konnte ein vermeintliches "Sparpaket" die deutsche Politik und Gesellschaft in den 1990er Jahren derart spalten? Diese fesselnde Analyse beleuchtet die hitzigen Debatten rund um das "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung" von 1996, das als Zäsur in der deutschen Sozialpolitik gilt. Tauchen Sie ein in die komplexen Machtspiele zwischen Regierung, Opposition, Arbeitgebern und Gewerkschaften, die um die Neugestaltung des Sozialstaats rangen. Verfolgen Sie die parlamentarischen Auseinandersetzungen im Bundestag und Bundesrat, die von emotionalen Appellen und taktischen Manövern geprägt waren. Erfahren Sie, wie die geplanten Einschnitte in Lohnfortzahlung, Renten und Krankenkassenbeiträge die Republik in Aufruhr versetzten und zu Massenprotesten führten. Das Buch analysiert die Ursachen und Motive für die Reformen, die Positionen der verschiedenen politischen Kräfte und die ökonomischen sowie politischen Konsequenzen des "Sparpakets". Ein Exkurs nach Schweden zeigt einen alternativen Weg der Konsolidierung durch Konsens statt Konfrontation auf. Entdecken Sie die Hintergründe eines Schlüsselmoments der deutschen Geschichte, der bis heute nachwirkt und die Frage aufwirft, wie soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Notwendigkeit in Einklang gebracht werden können. Eine spannende Lektüre für alle, die sich für deutsche Politik, Sozialpolitik, Wirtschaftsgeschichte, Gewerkschaftsbewegung und die Herausforderungen des modernen Wohlfahrtsstaates interessieren. Dieses Werk bietet tiefgreifende Einblicke in die Mechanismen politischer Entscheidungsfindung und die Dynamik gesellschaftlicher Konflikte, und analysiert die Auswirkungen des "Sparpakets" auf Arbeitsmarkt, Sozialsystem und das Vertrauen in die Politik. Ein Muss für jeden, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft verstehen will. Die detaillierte Untersuchung der damaligen Ereignisse liefert wertvolle Erkenntnisse für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Inhalt
Einleitung
1. "Sparpaket" - Terminus oppositionis
2. Ursachen und Motive
3. Die Politischen Kräfte und ihre Positionen
3.1 Die Arbeitgeberseite
3.2 Die Gewerkschaften
3.3 Die Sozialpolitiker der Koalitionsparteien
3.4 Die SPD-Opposition
4. Das Gesetzespaket im Parlamentarischen Ablauf
4.1 Der Tag der Verabschiedung
4.2 Die wichtigsten Regelungen
4.3 Der Stellenwert des Bundesrates
5. Ökonomische und Politische Konsequenzen
6. Exkurs: Schweden - Konsens statt Konfrontation
Ausblick
Literaturverzeichnis
Einleitung
Mit dem am 13. September 1996 verabschiedeten "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung", vulgo: "Sparpaket", reagierte die Bundesregierung auf verschiedene ökonomische Zwänge, die konkretes Handeln erforderlich machten.
Der Inhalt des "Sparpakets" sorgte seit seiner erstmaligen Präsentation durch Helmut Kohl am 26. April 1996 für heftige emotionale Debatten und Auseinandersetzungen. Das Thema beherrschte im Zeitraum von April 1996 bis zur Verabschiedung im September 1996 die politische Agenda wie kein zweites. Der Ernst der Lage ließunparteiische Stimmen oder gar Enthaltungen kaum zu, so daßDeutschland in zwei unversöhnliche Lager gespalten wurde: Gegenüber standen sich die Anhänger der Regierungskoalition und die der oppositionellen Kräfte, deren Anliegen es war, das "Sparpaket" zu entschärfen und "gerechter" zu gestalten.
Die Zäsur, die die Regierung damit setzte, läutete einen deutlichen Richtungswechsel ein. Für manche Überraschung sorgten hierbei nicht nur die legislativen Abläufe im SPD-dominierten Bundesrat, auch die starre Haltung der Koalition gegenüber ihren Sozialpolitikern ist symptomatisch für den eisernen Willen der Regierung das unpopuläre Programm trotz des erheblichen Widerstands durchzusetzen. Um sämtliche Facetten des Entscheidungsprozesses aufzuzeigen, ist die Arbeit daher nach dem "Ursache-Folge-Wirkung"-Prinzip konzipiert.
Der Exkurs nach Schweden zeigt eine beispielhafte Sparpolitik auf, die - gestützt auf einen breiten öffentlichen Konsens - bereits 1992 eingeläutet wurde. Die beachtlichen Leistungen Schwedens veranlaßten sogar deutsche Regierungsmitglieder vor Bekanntgabe des "Sparpakets" nach Kopenhagen zu reisen, um vom dortigen Erfahrungsschatz zu profitieren.
1. "Sparpaket" - Terminus oppositionis
Das "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung" ist der Allgemeinheit unter dem schlichten Titel "Sparpaket" vertraut. Wortschöpfer waren die oppositionellen Kräfte in Deutschland, die das Regierungsprogramm auf den prägnant eingängig klingenden Begriff "Sparpaket" reduzierten. Der Erfolg dieser Wortbelegung manifestierte sich durch seine Übernahme in den Medien, die dieses negativ belegte Kürzel häufig verwendeten und sich so (teils unbewußt) auf die Sprache der Opposition einließen.
Mitglieder der Regierung und der Koalitionsfraktionen sahen durch diesen Begriff freilich die Motive des "Sparpakets" entfremdet und sinnentstellt. Der Fraktionsvorsitzende der FDP beschrieb die Problematik treffend: "Wer den Vorwurf erhebt, das sei ein Sparpaket, hat das nicht verstanden. Natürlich gehört Sparen dazu. Aber es gehören auch - das ist noch wichtiger - strukturelle, dauerhaft wirkende Veränderungen dazu. Das ist in dem Paket enthalten, beispielsweise durch die Änderung der Lohnfortzahlung oder des Kündigungsschutzes."
Die Dynamik, die dieser Begriff innerhalb der deutschen Medienlandschaft und darüber hinaus entfachte, dokumentierte die Gesellschaft für Deutsche Sprache in Wiesbaden. Nachdem 1994 "Superwahljahr" und 1995 "Multimedia" als "Wort des Jahres" gekürt wurden, fiel 1996 die Wahl auf das "Sparpaket".
2. Ursachen und Motive
Die in den Debatten des Bundestags immer wieder vorgebrachten Argumente für die Notwendigkeit einschneidender Reformen fanden lange fraktionsübergreifende Zustimmung. Die Differenzen politischer Standpunkte entzündeten sich "lediglich" an dem Weg bzw. den Maßnahmen, die der Regierungsentwurf vorsah.
Das Primärmotiv für das "Sparpaket" lieferte die schlechte konjunkturelle Lage und die damit verbundene mangelnde Standortattraktivität im internationalen Wettbewerb. Um das "Investitionshemmnis", die hohe Staatsquote, zu verringern mußten die Staatsausgaben reduziert werden. Sozialpolitische Einschränkungen waren notwendig um die hohen Lohnnebenkosten senken zu können. Das Hauptargument, das die Gegner des "Sparpakets" mundtot machen sollte, war die damit angestrebte Reduzierung der Arbeitslosen bis zum Jahr 2000.
Als weiterer Grund für die Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Beitritt zur Europäischen Währungsunion (EWU) angegeben. Dies aufnehmend stilisierten Gegner und Kritiker den Euro populistisch als Sündenbock für das "Sparpaket", wodurch die Ablehnung gegen ihn und Europa wuchs.
Verminderte Steueraufkommen aufgrund zu optimistischer Prognosen des Vorjahrs zwangen ebenfalls zu Konsolidierungsmaßnahmen. Die tatsächlich nicht genug dimensionierte Sozialleistungsquote von 33,4% des Bundeshaushalts legte Kürzungen in diesem Bereich nahe. Die Veränderung der Alterspyramide zwang die Bundesregierung auch zu Änderungen in der Rentenversicherung.
Auch wenn der Entlastungs-Effekt des "Sparpakets" mager ist: Wolfgang Schäuble prognostizierte eine Reduzierung der Sozialleistungsquote auf lediglich 33% des Bruttoinlandsprodukts. So ist mit dem "Sparpaket" 1996 die Lanze dafür gebrochen worden, auch künftig weitere Schritte in diese Richtung unternehmen zu können. Ein von den Befürwortern des "Beschäftigungsprogramms" gerne angeführtes Argument ist, daßdie Sozialleistungen mit einer Reform nicht wegfallen, sondern gesichert werden, ehe am Ende das ganze System in Frage gestellt werde.
3. Die Politischen Kräfte und ihre Positionen
3.1 Die Arbeitgeberseite
Ein Großteil der getroffenen Maßnahmen des "Sparpakets" bestand aus langjährigen Forderungen der Arbeitgeberverbände. Dementsprechend wurde das Vorhaben der Bundesregierung von der Wirtschaft unterstützt. So forderte der Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) die SPD auf, ihre "Verweigerungshaltung in Sachen Sparpaket aufzugeben und die dringend notwendigen Reformen nicht weiter zu behindern". Kritisiert wurde desweiteren, daßdie SPD bisher keine konkreten Vorschläge auf den Tisch gelegt habe, "wie die Bundesrepublik wieder flottzumachen sei", erklärte der BGAVorsitzende Michael Fuchs.
Obwohl die Arbeitgeberverbände mit den getroffenen Maßnahmen einen Großteil ihrer Forderungen erfüllt sahen und das Gesetzespaket als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichneten, ergingen anschließend an die Regierung weitere Empfehlungen zur Sicherung des Standorts Deutschland:
Bereits einen Tag nach der Verabschiedung, am 14. September 1996, stimmte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Fritz-Heinrich Himmelreich die Einschränkung an: "Das reicht nicht", die Kürzungen seien ungenügend und die Sozialkosten müßten weiter gesenkt werden.
Für kurze Zeit goutierte auch die FDP die neuerlichen Forderungen der Arbeitgeberverbände. Der Forderung des Gesamtmetall-Chefs Stumpfe, daßdas Streikrecht eingeschränkt werden müsse, da die Waffengleichheit nicht mehr gegeben sei, schloßsich die FDP Sozialpolitikerin Babel an. Stumpfes Bemerkung fand bei der Abgeordneten Babel Unterstützung, da sich die Arbeitgeber laut Stumpfe nicht in der Lage sähen, das "Sparpaket" der Bundesregierung in laufende Tarifverträge umzusetzen.
Von derartigen Reaktionen zeigte sich der Bundeskanzler indigniert, lehnte einen Eingriff in die Tarifautonomie ab und forderte die Arbeitgeber auf, nun endlich zu handeln und die getroffenen Rahmenbedingungen sinnvoll zu nutzen. Die Regierung schließlich sei ihren Pflichten nachgekommen, jetzt sei die Wirtschaft am Zug.
Entscheidende Teile des "Sparpakets", die flexibleren Kündigungsregelungen und die eingeschränkte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, traten bereits am 1.Oktober 1996 in Kraft. Großunternehmen, wie Daimler-Benz und Siemens, kündigten bereits kurz nach der erfolgreichen Verabschiedung im Bundestag an, laufende Tarifverträge aufzukündigen, um von den neuen Gesetzen Gebrauch machen zu können. Die Daimler-Benz AG kündigte am 25.September an, daßdie eingeschränkte Lohnfortzahlung ab dem 1.Oktober eingeführt werde. Aufgrund massiver Proteste und Arbeitsniederlegungen erklärten sich die Konzernmanager jedoch zum Einlenken bereit und erklärten den Verzicht auf Eingriffe in gültige Tarifverträge.
Das aggressive Klima gegen die eingeschränkte Lohnfortzahlung ließen die Gewerkschaften auch in die neuerlichen Tarifverhandlungen einfließen, die kurze Zeit später stattfanden. Aber auch die Arbeitgeberverbände profitierten von dem Gewerkschaftsjunktim "Lohnfortzahlung": Als Gegenleistung, daßin der Metallbranche in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, beim Einzelhandel in Nordrhein- Westfalen und in der Chemieindustrie die "Lohnfortzahlung" garantiert wurde, erhielten die Arbeitgeber in anderen Punkten großzügige Zugeständnisse (in Fragen der Lohnerhöhung etc.)
3.2 Die Gewerkschaften
Die frühzeitige Ankündigung von Sparmaßnahmen seitens der Regierung ermöglichte den Gegnern ihre Aktionen mittelfristig zu planen und umzusetzen. Zum herausragenden Instrument des politischen Protestes geriet dabei die Großdemonstration. Die Zahl der von den Gewerkschaften und Sozialverbänden organisierten Aufmärsche war bald nicht mehr überschaubar, und auch die Zahl der Teilnehmer variierte in allen Größenordnungen. Zum bundesweiten Vorbild des politischen Protestes gerieten dabei die Großstädte Berlin, Kiel, München, Mühlheim, Nürnberg oder Bonn, deren Teilnehmerzahlen oftmals die 300.000 Grenze überschritten.
Begleitet wurden die Demonstrationen von sich wiederholenden Parolen und Slogans, von der "Rote-Karte"- Aktion (gerichtet an die Regierung), der Aufforderung "Mehr Druck von unten", mit dem Ziel, den Sozialabbau zu stoppen und die Koalitionsparteien zum Einlenken zu bewegen. Dabei wurde auch auf alte Klassenkampfparolen (Umverteilung von oben nach unten!) zurückgegriffen.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelen-Kefer sprach von einem unverantwortlichen Sparprogramm, das die sozialen Ungerechtigkeiten und die Arbeitslosigkeit erhöhe. Das "Sparpaket" käme einer "Kampfansage an den Sozialstaat gleich und [sei] der Versuch die Bundesrepublik marktradikal umzubauen". Zudem schwäche diese Politik die für die Beschäftigung erforderliche gesamtwirtschaftliche Nachfrage.
Trotz der enormen Mobilisierung konnten die Massenveranstaltungen den politischen Entscheidungsprozeßkaum beeinflussen und änderten nichts am Inhalt des "Sparpakets". Schäuble erklärte änläßlich der 350.000 Menschen großen Protestkundgebung Ende Juni in Bonn, daßihn "die Zahl der Teilnehmer [...] überhaupt nicht" überzeuge und "wir dem Druck der Straße nicht nachgeben". Helmut Kohl räumte zwar ein, gesprächsbereit zu sein, gleichzeitig setzte die Bundesregierung ihren Kurs aber fort. Dabei betonte er, daß, wer sich notwendigen Reformen verweigere und "protestierend ins Abseits begibt", den sozialen Frieden zu gefährden.
Obwohl die Gewerkschaften und Sozialverbände nicht zu Veränderungen am "Sparpaket" beitragen konnten, profitierten sie für einen Moment von der emotionsgeladenen Debatte. Kurz vor Bekanntgabe der Sparmaßnahmen schien die künftige Rolle der Gewerkschaften unklar, viele Stimmen stellten ihren Nutzen, einige ihre Existenz sogar in Frage. Seit der Bekanntgabe des "Sparpakets" im April 1996 aber wurden die Arbeitnehmerverbände aus ihrer Lethargie gerissen und erfuhren eine qualitative Aufwertung. Der vormalige Mitgliederschwund ging zurück, und in den größeren Gewerkschaften erhöhte sich sogar die Zahl der Neueintritte. Bei der IG Chemie erhöhte sie sich alleine im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 43%. So dankte der Hauptkassierer der IG Metall in "stillen Stunden" Kohl und der FDP, die mit ihrem gescheiterten Versuch, die Lohnfortzahlung zu kürzen, der IG Metall innerhalb von zwei Monaten 28.000 neue Mitglieder einbrachte.
Zum anderen erfuhr die traditionelle Verbundenheit der Sozialdemokraten zu den Gewerkschaften eine neue Qualität. Vertreter der SPD nahmen konstant an den Gewerkschaftsprotesten teil, und führende Gewerkschafter riefen zur Ablösung der Regierung Kohl auf, um damit den gemeinsamen Schulterschlußzu symbolisieren. So wurde aus dem gescheiterten "Bündnis für Arbeit" ein Bündnis der SPD mit dem DGB.
3.3 Die Sozialpolitiker der Koalitionsparteien
Das "Sparpaket", das von Beginn an von der überwiegenden Mehrheit der Arbeitnehmerverbände abgelehnt wurde, wurde auch von Teilen der Koalitionsparteien skeptisch aufgenommen, einzelne Abgeordnete empfanden es sogar als eine "Provokation". Die Gegner innerhalb der Koalition berufen sich auf die Tradition der christlichen Soziallehre, dieser mehr als 100 Jahre alten politischen Richtung, auf die sich der Arbeitnehmerflügel der CDU gründet. Ihre Mitglieder sind in Arbeitnehmer-Interessenvertretungen bzw. in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), den sog. Sozialausschüssen, organisiert. Symptomatisch für die unterschiedlichen Standpunkte innerhalb der CDU war der Auftritt eines thüringischen CDU-Ministers bei einer CDA-Bundesvorstands-Sitzung in Gera: Dort pries er am Tag nach der Verabschiedung das Werk und erntete daraufhin laute Pfiffe und Buh-Rufe.
Aus der Befürchtung heraus, daßdie parteiinternen "Sparpaket"-Gegner gegen die Anträge der Koalition stimmen würden, habe der Fraktionschef der CDU/CSU, Wolfgang Schäuble, viele Sozialpolitiker in "Vier-Augen-Gesprächen" unter Druck gesetzt, wie sich CDA- Mitglieder bei Zusammenkünften erzählten. "Ich habe gehört, der hat denen sogar gedroht, daßja bald der Bundestag verkleinert wird", sagte ein Parlamentarier, der seine Anonymität gewahrt wissen wollte.
Rainer Eppelmann, der Vorsitzende der Sozialausschüsse, befürchtete, daßdurch den eingeschlagenen Weg "Kapitalismus pur" entstehe, und sein Kollege Peter Altmaier sah auf diese Weise die CDA von unten ausbluten.
Diese Form der Ablehnung und die Neigung das "Sparpaket" mit negativ belegten Schlagworten zu kommentieren, ähnelt der Sprache der Opposition. Zum einen beabsichtigte der "Sozialflügel" der Koalition damit, die Interessen seiner Klientel zu vertreten, zum anderen aber auch, den Maßnahmekatalog zu seinen Gunsten zu verändern.
Diese Zerstrittenheit innerhalb der CDU/CSU-Fraktion setzte gleichzeitig einen Diskussionsprozeßin Gang, der in die Öffentlichkeit getragen wurde und so maßgeblich den Entscheidungsprozeßmitprägte. Der Vorwurf, die CDU sei eine "Ein-Mann-Partei" und tauge nicht mehr zu Diskussionen in sachlichen Fragen, trifft für die "Sparpaket"-Debatte sicherlich nicht zu. Dadurch, daßder Vorsitzende der CDA, Rainer Eppelmann, sich bemühte, die aggressive Stimmung aufzufangen, kam es während der Debatte zu keinem ernsthaften Konflikt innerhalb der CDU.
3.4 Die SPD-Opposition
Ähnlich wie bei der aktuellen Debatte um die Steuerreform, verbuchten die Oppositionsparteien BÜNDNIS ´90/ DIE GRÜNEN wie auch die PDS einen nur geringen Stellenwert. Aufgrund der Dominanz der SPD-regierten Länder im Bundesrat fielen den Stimmen der SPD in der "Sparpaket"-Debatte die tragende Oppositionsrolle zu.
Der größte Vorwurf der Koalitionsparteien, der an die SPD innerhalb des Entscheidungsprozesses bis zur Verabschiedung des "Sparpakets" gerichtet war, zielt auf die Konzeptionslosigkeit und Reformunfähigkeit der Opposition ab. Die Titulierung "Partei der Besitzstandswahrer" galt innerhalb der Diskussion als die griffigste Formel, um die SPD in die Ecke zu drängen.
Die SPD freilich bemühte sich, sich von diesen Vorwürfen zu befreien und präsentierte wenige Tage nach Bekanntgabe des "Giftpakets" ihr Alternativkonzept - mit dem Titel "Zukunft sichern - Zusammenhalt stärken". Ergänzende Forderungen stellte die SPD in Bundestags-Reden oder in Presseerklärungen:
Vergleicht man die Positionen der SPD mit denen der Regierungsparteien, so fallen einige gemeinsame Ansatzpunkte auf. Die gemeinsamen Ansatzpunkte lassen freilich den strikten Konfrontationskurs der SPD hinsichtlich der geforderten Maßnahmen des "Sparpakets" verblassen. Der Tenor ist, daßauch die Sozialdemokraten den Zwang zu Reformen anerkennen, die "rigide Sparpolitik" der Regierung aber ablehnen. Ähnlich wie der bayerische Ministerpräsident Stoiber fordern sie eine Neuverteilung der Lasten. Dabei greift die SPD zu keynesianischen Argumentationsmustern: Konsumintensive Einkommen, also die kleineren, sollen entlastet, die großen privaten Vermögen belastet werden.
Ein vereinfachtes Steuerrecht solle dafür sorgen, daßAbschreibungsvergünstigungen, Steuerbefreiungen, Freibeträge und Steuerbezüge abgebaut werden, um die Progression der Einkommenssteuer und damit die Steuergerechtigkeit wiederherzustellen.
Eine Öko-Steuer als neue Säule im Steuersystem würde die Ressourcen stärker belasten, den Faktor Arbeit entlasten und so die Lohnnebenkosten senken und den Dienstleistungssektor beleben.
Daneben tritt die SPD für die internationale Harmonisierung von Umwelt- und Sozialstandards ein, um den Verdrängungs- und Standortwettbewerb auszubremsen. Im Rahmen von WTO, G7 oder OECD solle die Bundesregierung dies vertreten und Kataloge mit sozialen Mindeststandards einfordern.
Innerhalb der Europäischen Union müsse Deutschland sich für die Einführung eines "Europäischen Bündnisses für neue Arbeitsplätze" stark machen. Der Aufbau transeuropäischer Netze zur Wettbewerbsverbesserung spiele dabei eine herausragende Rolle.
Eine weitere zentrale Forderung betrifft die Umverteilung der Arbeit. Weniger Überstunden und eine 30 Stunden-Woche würden die Arbeitslosigkeit beseitigen und die Sozialkassen entlasten.
Diese Taktik ist Teil eines Konzepts der SPD und gehört - nicht nur in diesem Fall - zum Reaktionsmuster einer Opposition. Dadurch nämlich, daßdie SPD kein Gesamtkonzept und nur ´unverbindliche´ Einzelpunkte propagiert, bietet sie auch keine direkte Angriffsfläche. Der Verzicht auf einen eigenen Gesetzentwurf zur Sanierung bzw. Entlastung des Sozialhaushalts, entlastet sie vor der Gesamtverantwortung. Durch den Verzicht auf ein allgemeingültiges Programm und konkrete Sparvorschläge, entzieht sich die Opposition elegant einer Verifikation. Durch einzelne populistische Forderungen (wie der vermehrten finanziellen Partizipation der ´Reichen´) ist der SPD in der heißen Phase des Entscheidungsprozesses die Rolle des Sympathieträgers zugekommen, und - umgekehrt - den Koalitionsparteien, die des "Buhmanns".
4. Das Gesetzespaket im Parlamentarischen Ablauf
4.1 Der Tag der Verabschiedung
Der 13. September 1996 stellte zugleich den Höhepunkt des Entscheidungsprozesses zum "Sparpaket" dar, und zum anderen das vorläufige parlamentarische Ende. Im Plenum des Deutschen Bundestages wurde ein letztes Mal über das Für und Wider gestritten, ein letztes Mal die "soziale Unausgewogenheit" oder die "Blockadepolitik" angeprangert.
In der Debatte wurde erwartungsgemäßan die Emotionen appelliert, lediglich der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Wolfgang Schäuble, erläuterte zu Beginn seiner Rede den legislativen Sachstand, um dann den Nutzen anzuführen.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rudolf Scharping, griff einzelne Gesetzesänderungen heraus, prüfte sie in seinem Sinne auf Sozialverträglichkeit und schloßmit einem Appell an den Sozialflügel der Koalition, gegen das Programm der Bundesregierung zu stimmen.
Die Fraktionssprecherin von BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN, Kerstin Müller, griff in ihrem Beitrag den angekündigten Widerstand der CDA auf, den der CDA nun in die Wirklichkeit umsetzen solle.
Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Hermann Otto Solms, erläuterte die Notwendigkeit zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und stellte an die SPD gewandt, das Vorbildmodell Schweden dar.
Der Gruppenvorsitzende der PDS, Gregor Gysi, der oppositionsübergreifenden Beifall erhielt, bediente nicht nur gängige Klassenkampfklischees, sondern verwies auch auf die Folgen für den Arbeitsmarkt insbesondere im Osten Deutschlands.
Neben dem üblichen Schlagabtausch der Fraktionen bot sich dem Betrachter auch Kurioses: Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fühlte sich jeder Abgeordnete verpflichtet, unabhängig von seiner Couleur, an der Abstimmung teilzunehmen. Um das vorgelegte Programm der Regierung sicher verabschieden zu können, sahen sich die frischoperierten CDU-Abgeordneten Jochen Borchert und Michael Glos gezwungen, zur Abstimmung zu erscheinen. Letzterer erschien trotz der Belastung durch vier Operationen und acht Narkosen. Dieser Umstand entfachte eine Diskussion zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages, an Abstimmungen künftig auch vom Krankenbett aus teilnehmen zu können.
Bei den sechs zur namentlichen Abstimmung vorliegenden Anträgen stimmten schließlich alle Abgeordneten der Koalitionsparteien dafür, die Opposition dagegen. Der FDP- Sozialpolitiker Burkhard Hirsch beantragte außerplanmäßig eine kurze Ausrede (§31, GOBT), worin er konstatierte, daßdas "Sparpaket" kein gewöhnliches Gesetz sei. Laut Hirsch wurde die Abstimmung als "Vertrauensfrage für oder gegen die Bundesregierung hochstilisiert". Vor diesem Hintergrund sei für ihn der Inhalt der Gesetze sekundär. Hirsch sprach damit auch für die übrigen Abgeordneten des Sozialflügels der Koalition. Eine Stimmenverweigerung zu dem "Sparpaket" der Bundesregierung kam in diesem angespannten Klima aber für keinen Abgeordneten der Koalition in Frage.
4.2 Die wichtigsten Regelungen
Im folgenden Teil werden die wichtigsten mit dem "Sparpaket" verbundenen Gesetze erläutert, die von der Regierung vorsorglich fragmentiert wurden, um das "Sparpaket" nicht gänzlich von der Zustimmung des Bundesrates abhängig zu machen. Durch diese Taktik konnten umstrittene Gesetze, wie bspw. das der eingeschränkten Lohnfortzahlung und der Erhöhung der Altersgrenze für Renten, durch den von den Regierungsparteien dominierten Bundestag, verabschiedet werden.
Arbeitsrechtliches Beschäftigungsförderungsgesetz
Zum zentralen Thema der Auseinandersetzung innerhalb des "Sparpakets" wurde das Gesetz zur eingeschränkten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die auf 80% reduziert werden sollte. Bestehende Tarifverträge sollten dieses Gesetz aber nicht tangieren.
Handlungsbedarf bestand, da deutsche Arbeitnehmer 1994 im Durchschnitt 16 Tage krank gewesen waren, im öffentlichen Dienst sogar 26. Laut dem CDU-Bundestagsabgeordneten Repnik wären in allen anderen Ländern in denen "die Lohnfortzahlung reformiert worden sei, [..] die Fehlzeiten zurückgegangen und die Arbeitsproduktivität gestiegen". Gleichzeitig sah das Gesetz die Lockerung des Kündigungsschutzes in kleineren Betrieben vor. Nunmehr wurde der Kündigungsschutz für Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern eingeschränkt.
Das Gesetz wurde am 13.September durch die sog. Kanzlermehrheit verabschiedet und am 1.Oktober 1996 in Kraft gesetzt.
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz
Ab 1997 wird die Altersgrenze für den vollen Rentenbezug stufenweise angehoben, d.h. die Lebensarbeitszeit von Frauen mit der der Männer nivelliert, und die anrechenbaren Ausbildungszeiten auf die Rente auf drei Jahre gesenkt.
Bei diesem Punkt vermied die SPD harsche Kritik, außerdem war dieses Gesetz nicht durch den Bundesrat zustimmungspflichtig und konnte so am 1. Januar 1997 in Kraft treten.
Beitragsentlastungsgesetz
Dieses Gesetz gehörte ebenfalls zu den sog. "nicht-zustimmungspflichtigen" Teilen des "Sparpakets". Das Gesetz regelt u.a. die erhöhte Arzneimittelzuzahlung, die vermehrte finanzielle Beteiligung bei Kuren, Brillen und Zahnersatz. Zudem gehört zu dem Gesetz die eingeschränkte Lohnfortzahlung von 80 auf 70% des Bruttolohns bei längerer Krankheit. Von der damit einhergehenden Senkung der Beitragssätze der Gesetzlichen Krankenversicherung versprach sich die Bundesregierung sich Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden D-Mark. Am 1. Januar 1997 trat das Gesetz in Kraft.
Gesetz zur Begrenzung der Bezügefortzahlung bei Krankheiten für Beamte
Hierin wurde die Kürzung des 13. Monatsgehalts um ein Prozent je krankheitsbedingten Fehltag oder einen Urlaubstag weniger pro 5 Tage Dienstunfähigkeit bestimmt. Trotz der inhaltlich eher bescheidenen Einschränkungen scheiterte es an der Zustimmung des Bundesrates.
Durch diesen Maßnahmekatalog sollten die Rentenkassen bis zum Jahr 2000 um 23,8 Milliarden D-Mark entlastet werden und die Bundesanstalt für Arbeit um ca. 5 Milliarden D- Mark. Wirtschaftspolitisch wird dieses "Sparpaket" als "angebotsorientiert" klassifiziert, die Standortattraktivität Deutschlands sollte damit erhöht werden.
4.3 Der Stellenwert des Bundesrates
Anfang 1996 setzte die Bundesregierung noch alle Hoffnungen auf das "Bündnis für Arbeit und Standortsicherung", an dem die Bundesregierung, Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften beteiligt waren (sog. Kanzlerrunden). Im Konsens wollte man dort Maßnahmen verabreden, die vordergründig zur Verbesserung der Erwerbslage in Deutschland führen sollten. Die letzte Kanzlerrunde am 23. April 1996 erzielte jedoch wiederholt keine Einigung. Somit wurden die Gespräche abgebrochen.
Damit wurde der Konfrontationskurs eingeleitet und laut Gewerkschaften und SPD der "soziale Konsens" aufgekündigt. Daraufhin beschlossen zwei Tage später, am 25. April, die beiden Koalitionsfraktionen das "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung" im Kabinett. Der Bundeskanzler stellte einen Tag später wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen im Deutschen Bundestag vor. Am 23. und 24. Mai erfolgte die erste Lesung der Gesetzentwürfe des "Sparpakets". Danach folgten die Ausschußberatungen, und am 28. Juni wurde die zweite und dritte Beratung über die Gesetze abgehalten.
Nach der Verabschiedung im Bundestag am 9. Juli befaßte sich am 19. Juli der Bundesrat mit den Gesetzen. Nun geschah neben den üblichen legislativen Formalia auch für Bonn ungewöhnliches: Der Widerstand, der sich kurz nach der Präsentation des "Sparpakets" formierte, beschränkte sich anfangs nämlich nicht nur auf die SPD-regierten Bundesländer. Für einen parteipolitischen Eklat sorgte dabei beinahe die Haltung Bayerns und Baden- Württembergs, die sich für kurze Zeit in die Ablehnungsfront der SPD-regierten Länder im Bundesrat einreihten. Nachdem also das "Sparpaket" bereits am 9.Juli 1996 von der Mehrheit des Bundestages verabschiedet wurde, hatte nur wenige Tage später der Bundesrat dessen Kürzungsvorschläge - auch mit den Stimmen einiger unionsgeführter Länder - verworfen. Dabei dienten nicht nur die CDU-Sozialausschüsse als "geistige Verbündete" des CSU- regierten Bayerns. Stoiber lehnte die Kürzungspläne der Regierung ab und verlangte eine neue Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern.
Die Haltung Stoibers sorgte auf der Seite der SPD-regierten Länder im Bundesrat zunächst für große Freude. Im Bundesrat rief ihm Lafontaine "Willkommen in der Blockadefront" zu. Zusätzlich hatte der saarländische Regierungschef ein Etappenziel erreicht: Die Ablehnungsfront der SPD-geführten Länder bröckelte nicht und Bayern und Baden- Württemberg stimmten beim ersten Teil des "Sparpakets" ebenfalls für den Antrag des Landes Rheinland-Pfalz, den Vermittlungsauschußanzurufen und die Gesetzesbeschlüsse zu überarbeiten .
Da die SPD auch im Vermittlungsausschußüber die Mehrheit verfügt, lehnte der Vermittlungsausschußdie Vorlagen der Bundesregierung wie erwartet ab, so daßfür den 29. August eine Sondersitzung im Bundestag einberufen wurde. In jener Sondersitzung wurde von den Koalitionsfraktionen das Votum des Vermittlungsausschusses zurückgewiesen. Die SPD-regierten Bundesländer legten dann am 12. September formell Einspruch gegen die "Spargesetze" ein. Dadurch wurde der Bundestag gezwungen, die Gesetze mit der Kanzlermehrheit am darauffolgenden Tag durchzusetzen. Soweit es sich um Gesetze handelte, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedurften, wies der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder diesen Einspruch zurück, sodaßjene Gesetze in Kraft treten konnten. Soweit die Gesetze der Zustimmung des Bundesrates bedurften, wurde entweder von der Regierungskoalition beantragt, das Vermittlungsverfahren erneut in Gang zu setzen oder die Gesetze zur gesetzlichen Krankenversicherung neu einbringen, um einen Teil zustimmungsfrei zu halten und bei einem anderen Teil zu versuchen, die Zustimmung zu bekommen.
Aufgrund der starren Haltung der SPD-regierten Bundesländer aber scheiterten auch die folgenden Verhandlungen am 12. Dezember im Vermittlungsausschuß. Die SPD begründete ihre ablehnende Haltung mit der grundsätzlichen Verweigerung gegenüber einer eingeschränkten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und stellte sie als Junktim heraus um ihrer "Konfrontationsstrategie" (Theo Waigel) mehr Gewicht zu verleihen.
Als Reaktion darauf führte Innenminister Kanther nichtzustimmungspflichtige (und abgeschwächte) Regelungen ein, um den hohen Krankenstand der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu verringern. So müssen künftig Bundesbeamte bei hohem Krankenstand mit Kontrollbesuchen rechnen; Landesbeamte in SPD-regierten Bundesländern werden davon jedoch verschont bleiben.
5. Ökonomische und Politische Konsequenzen
Am 10.Dezember 1996 titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung:"Ein Gesetz ohne Folgen". Der Bonner General-Anzeiger ging noch weiter und beschrieb das Gesetz zur eingeschränkten Lohnfortzahlung als "Unfriedenstifter und Streikzünder - und damit als Jobkiller. Verantwortlicher Umgang mit dem Standort Deutschland ist das nicht":
Während der überwiegende Teil des "Sparpakets" erfolgreich umgesetzt wurde, wurde das Gesetz zur eingeschränkten Lohnfortzahlung zunehmend zu Makulatur. Nach den heftigen "ideologischen Grabenkämpfen" (Norbert Blüm) um die Lohnfortzahlung erwartete die Politik nun von der Wirtschaft die Umsetzung. Da den Arbeitgeberverbänden aber entschlossene Gewerkschaften gegenüberstanden, die mit dem Einsatz aller legalen Arbeitskampfmittel drohten, (sollte die Lohnfortzahlung in künftigen Tarifverträgen nicht fortgeschrieben werden), lenkten die Arbeitgeber ein. Die Tarifabschlüsse in der Nahrungsmittel- und der Metallindustrie zeigten, daßdie Politik zwar die Rahmenbedingungen setzen konnte, für die Realisierung aber autonom die Tarifpartner verantwortlich sind. Die Uneinigkeit bei der Lohnfortzahlung nutzte die SPD auch prompt, indem sie einen Gesetzentwurf einbrachte, der die Wiedereinführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zum Ziel hat und die inzwischen gefundenen tarifvertraglichen Lösungen gesetzlich fixiert.
Dieses Umsetzungsfiasko desavouierte die Arbeitgeberverbände in der Öffentlichkeit und bescherte ihnen Ansehens- und Machtverlust. Forderungen Stumpfes - das Streikrecht bspw. einzuschränken, stießen parteiübergreifend auf Ablehnung. Konsterniert drohte die Bundesregierung dem "Kapital", von nun an "so schnell kein Gesetz mehr zu ändern". Wie Helmut Kohl betonte, habe die Regierung die Rahmenbedingungen verbessert, nun seien die Arbeitgeber an der Reihe sich zu revanchieren. Sie müßten ihrer Verantwortung gerecht werden, die Halbierung der Arbeitslosenquote in Angriff nehmen und neue Ausbildungsplätze schaffen, statt immer neue Forderungen aufzustellen.
Als politische Profiteure des "Sparpakets" hingegen gingen die Gewerkschaften daraus hervor, deren Mitgliederzahlen nach der vorrangegangenen rückläufigen Entwicklung wieder anstiegen. Der Status quo ante schien überwunden und ihr Stellenwert innerhalb der Gesellschaft wieder gefestigt.
Daßdie Halbierung der Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000 mit diesem "Sparpaket" nicht erreicht wird und weitere Reformen Not tun, ist wohl eine realpolitische Einschätzung. Dennoch wurden mit dem "angebotsorientierten" Gesetzespaket auch Anreize für die Unternehmer geschaffen. Die deutschen Betriebe haben bereits seit Inkrafttreten des "Programms für mehr Wachstum und Beschäftigung" eine zweistellige Milliardensumme eingespart, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Hörster, verkündete. Dem Jahreswirtschaftsbericht zufolge bringt das "Sparpaket" den Sozialversicherungen und den Arbeitgebern in den Jahren 1997 bis 2000 sogar eine Entlastung von mehr als 150 Milliarden DM. Auf die Sozialversicherungen würden Einsparungen in Höhe von 87 Milliarden D-Mark entfallen, die Arbeitgeber insgesamt mit 68 Milliarden entlastet.
Die Einsparungen im Kur- und Rehabilitationsbereich wirkten sich schon bald nach Verabschiedung des Sparprogramms aus. Durch die stärkere Eigenbeteiligung von Kurpatienten schwand die Attraktivität einer Kur. Bereits im November 1996 machten sich die Veränderungen bemerkbar: Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte kündigte rund 12.000 Betten in Rehabilitations- und Kurkliniken. Und wenige Tage später kündigte der stellvertretende Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger, Eberhard Schaub, die Schließung von 200 Kurkliniken an.
Die Dresdner Bank analysierte das Bonner "Sparpaket" und kam zu dem Ergebnis, daßdie Bundesbürger 1997 mit 7 Milliarden D-Mark belastet würden und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so um ein halbes Prozent gedämpft werde.
So schmerzhaft die Einschnitte für einzelne Sektoren sein mögen, sind sie doch notwendiger Teil einer neuen (Welt-) Marktwirtschaftslehre. Das globale Denken erfordert neues Handeln und beeinflußt nicht zuletzt vor allem die politischen Entscheidungsprozesse. Mit dem ersten "großen" "Sparpaket" wurde aber gleichzeitig das wirtschaftspolitische Bewußtsein der Bevölkerung sensibilisiert und trotz heftiger Abwehrreaktionen auch die Akzeptanz für notwendige Maßnahmen erhöht.
6. Exkurs: Schweden - Konsens statt Konfrontation
Einst galt Schweden als Vorbild für den perfekten Wohlfahrtsstaat, das mit üppigen Sozialleistungen beeindrucken konnte und dessen Motto es war, den Bürger "von der Wiege bis zur Bahre" zu versorgen. Die hohe Massenarbeitslosigkeit (13%) aber machte das System bald nicht mehr finanzierbar und zwang die politischen Eliten umzudenken. Zu jener Zeit gaben Schwedens politische Entscheidungsprozesse deutschen Gewerkschaftern, Politikern und Arbeitgebern Anlaß, den beispielhaften Umbau des Sozialstaats vor Ort zu erkunden. Das Land, einst das Ideal eines Sozialstaats, ist wieder ein Modell geworden - diesmal für eine rigide Sparpolitik.
Die neue Generation schwedischer Sozialdemokraten, die seit 1932 nahezu ununterbrochen die Regierung stellten, dachte um und reorganisierte den Sozialstaat. Gemeinsam ist Göran Persson, dem schwedischen Regierungschef, und der deutschen Regierung das Ziel: die avisierte Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000. Dabei kennt der Rotstift der schwedischen Minderheitsregierung kaum Tabus, das "Sparpaket" der Bundesregierung nimmt sich dabei eher schwach und zaghaft aus. Innerhalb von drei Jahren wurde das schwedische Sozialbudget um 22 Prozent zusammengestrichen:
So wurden bspw. das Renteneintrittsalter auf 67 erhöht, das Niveau der Rentenleistungen reduziert, ein Karenztag vor Beginn der (ebf. eingeschränkten) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeführt, vor Erhalt des Arbeitslosengeldes fünf Karenztage eingeführt (außerdem die Kürzung desselben), eine Gesundheitsreform durchgeführt, die Sozialabgaben der Betriebe eingeschränkt, das reale Einkommen zur Eindämmung der Inflation gesenkt, die Vermögenssteuer erhöht und Frühpensionierungen abgeschafft.
Als Julius Louven, CDU-Bundestagsabgeordneter, mit drei seiner Kollegen aus Schweden zurückkehrte, glaubte er, daßderart harte Maßnahmen in Deutschland nicht möglich seien: "Wenn wir so sparen wollten, würde bei uns die Republik in Flammen aufgehen". Genau das ist die Crux: Während die dänischen Gewerkschaften die eingeschränkte Lohnfortzahlung mit einem leisen Murren hinnahmen, wurden zum Erstaunen der schwedischen Bevölkerung in Deutschland binnen weniger Wochen hunderttausende Arbeitnehmer mobilisiert um gegen die Sparpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Doch die Ergebnisse von Perssons Politik sprechen für sich: Innerhalb von drei Jahren wurden die schwedischen Sozialleistungen um 22% reduziert, das Bruttosozialprodukt stieg um 4% und die Arbeitslosigkeit sank auf ein erträgliches Niveau von 7,7%.
Natürlich gibt es auch Gegner dieser Politik. Durch die Sparmaßnahmen spalteten sich die regierenden Sozialdemokraten in "Erneuerer" und "Traditionalisten", wobei letztere die Positionen der mit ihnen verbundenen Gewerkschaften einnahmen. Aber die große Auseinandersetzung blieb aus. Eine Polarisierung, die die deutsche Gesellschaft in zwei verfeindete Lager trennte, fand nicht statt. Der Göteborger Gewerkschaftssekretär Peter Schubert erläuterte seine Taktik: "Wir gehen nicht auf die Straße, wir reden mit der Partei und dem Minister".
Hat diese Form des innergesellschaftlichen Konsens mit der schwedischen Mentalität zu tun, mußman sich angesichts der ausbleibenden Konfrontation fragen. Das Sonntagsblatt hat dafür eine Antwort parat: in Schweden hat es weder einen Franz-Josef Straußgegeben, noch eine APO. Man war sich, gleich welcher politischen Couleur, immer ziemlich einig. Dieser Wunsch besteht weiterhin. Solidarität bezieht sich dort nicht nur auf die Hilfe für Schwache - sondern soll auch dem politischen Gegner zuteil werden.
Und auch die schonungslos ehrliche Politik, die das Aufzeigen unangenehmer Details nicht scheut, scheint symptomatisch für das Vertrauen in die Parteien zu sein. 1994, zur Wahl des Reichstages, kündigten die Sozialdemokraten im Falle des Regierungswechsels nicht etwa den Ausbau des Sozialsystems an, sondern weitere schmerzhafte Einschnitte, wie etwa Streichungen beim Erziehungs- und Kindergeld, Einführung einer Arbeitnehmerbeteiligung an der Krankenversicherung, Rentenkürzungen usf.. Trotz dieser Hiobsbotschaften gewann die Partei die Wahlen.
Seit dieser Legislatur vermochte der Regierungschef Persson alle politischen Lager von der Notwendigkeit weiterer Sparpakete zu überzeugen. Die "schwedischen Kanzlerrunden" fruchteten, riefen kaum Proteste hervor und ließen die Schweden die Sparpakete mit geradezu stoischer Ruhe aufnehmen. 1993, als die Konservativen mit der Konsolidierungspolitik begannen und erste rigide Einschnitte vorgenommen wurden, verhandelten Regierung und oppositionelle Sozialdemokraten gemeinsam. Die Einschnitte, die von einem parteiübergreifenden Konsens getragen wurden, begrenzte schließlich die Zahl der Demonstranten vor dem Reichstag auf lediglich 1000 Personen.
So mutierte der Wohlfahrtsstaat zum Wallfahrtsstaat für deutsche Arbeitgeberverbände und Politiker und genießt einen ähnlichen Vorzeige-Stellenwert wie England, die USA oder Singapur. Die sozialen Konflikte werden in Schweden präventiv durch Gespräche zwischen Gewerkschaften, Parteien und der Regierung vermieden. So wird die Einsicht zu Veränderungen und schmerzhaften Reformen durch einen breiten gesellschaftlichen Konsens, quer durch alle politischen Parteien, getragen. Gleichzeitig mußberücksichtigt werden, daßdie traditionell enge Bindung der Sozialdemokraten an die Gewerkschaften Kürzungen erleichtert. Und auch das Verhältnis der Schweden zu ihrem Staat unterscheidet sich von der Perzeption der Deutschen. Kein anderes Volk "liebt" seinen Staat so wie die Schweden; nicht von ungefähr gebraucht man im Schwedischen den Begriff "samhälle" für "Gesellschaft" und "Staat" synonym. Als wäre die Gesellschaft mit dem Staat identisch.
Vor diesem Hintergrund, den unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten, erscheinen die Bemühungen deutscher Politiker fragwürdig, schwedische Erfolge in Schablonenmanier nach Deutschland übertragen, zu wollen. Ohne eine überparteiliche Einsicht zum Sparen werden diese Bemühungen keinen fruchtbaren Boden finden und wird der Wunsch nach einem breiten Konsens ein Traum romantischer Politiker bleiben.
Ausblick
Der Entscheidungsprozeßzum "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung" hob sich von vielen anderen parlamentarischen Entscheidungsprozessen alleine durch seine Intensität und den Grad der Polarisierung ab. Er hielt über Monate hinweg die ganze Republik in Atem - sollte doch nahezu jeder Bürger von den avisierten Veränderungen betroffen sein. Dabei prallten zwei Lager aufeinander: die außer-/ parlamentarischen Oppositionskräfte auf der einen Seite, die Koalitionsparteien auf der anderen. Die Opposition befand sich dabei in einer qualitativ besseren Ausgangslage: Zum einen trug sie keine Regierungsverantwortung (kein Handlungszwang), zum anderen fallen kritische Bemerkungen leichter als die Verteidigung eines konkreten Programms. Die SPD verschaffte sich im Zuge des "Sparpakets" erstmals wieder Profil und klare Unterscheidungsmerkmale zur Regierung. Der Polarisierungseffekt, der der SPD wieder half sich politisch zu sammeln und abzugrenzen, tat der deutschen Demokratie nicht gut. Die beiden großen Volksparteien standen sich in den Debatten unversöhnlich gegenüber, unfähig zu einer konstruktiven Kompromißbereitschaft und somit zu einem nationalen Konsens, ähnlich dem Schwedens, zu finden.
Auch nach der Verabschiedung des "Sparpakets" schien die Debatte nicht abreißen zu wollen: Nahmen einzelne Arbeitgeberverbände das Gesetz zur eingeschränkten Lohnfortzahlung doch zum Anlaßdie laufenden Tarifverträge zu kündigen, um von der modifizierten Gesetzeslage zu profitieren. Aufgrund der starken Stellung der Gewerkschaften (oder "der Waffenungleichheit": Stumpfe) scheiterten die Bemühungen der Arbeitgeberseite die eingeschränkte Lohnfortzahlung durchzusetzen. Dadurch schien ein wesentlicher Teil des "Sparpakets" in Frage gestellt; die Reformbemühungen der Regierung waren zwar nicht unbedingt gescheitert, aber doch gebremst. Erika Martens pointierte diesen Vorgang in Der Zeit treffend: "Verloren haben auch die Sieger".
Dieser Umstand erscheint um so mehr alarmierend, da Deutschland laut OECD die bitteren Pillen erst noch schlucken muß. Die OECD empfahl der Bundesregierung bereits im September 1996 noch einschneidendere Kürzungen im Lohnbereich, eine Beendigung der Frühverrentung und weitere Reformen im Kündigungsschutz. So bleibt zu fragen, ob bei weiteren Reformpaketen mit dem ersten "Sparpaket" bereits die Weichen für weitere gestellt wurden, oder ob die Akzeptanz durch den "Pyrrhus"-Sieg der Gewerkschaften geschwunden ist.
DaßHandlungsbedarf besteht, wird keine politische Richtung ernsthaft bestreiten wollen. Die Sozialausgaben sind in den letzten 15 Jahren schließlich annähernd doppelt so stark gewachsen als das Bruttosozialprodukt. Ungeachtet dessen finden die den Bundestag und Bundesrat dominierenden Parteien CDU und SPD in diesen Fragen zu keinem Konsens, verzögern legislative Abläufe und verstimmen die breite Öffentlichkeit durch parteitaktisches Lavieren.
Kurz nach Verabschiedung des "Sparpakets" begann eine Debatte über eine große Koalition, die zur Lösung der anstehenden Probleme am besten geeignet sei und die Pattsituation im Bundestag/ Bundesrat beenden könnte. Doch auch hier scheinen die Stimmen zu verstummen: Mit den neuerlichen Schulterschlüssen der SPD mit der Kohle-Gewerkschaft rückt eine Einigung in ferne Sicht, und die Bundespolitik bleibt weiterhin von beinahe statischen Antagonismen regiert (sozusagen in der Kontinuität des "Sparpakets").
Theo Waigels Absicht, ein zweites "Sparpaket" zu verabschieden, läßt daher weitere und ähnliche Auseinandersetzungen erwarten. Aber mit der Zäsur, die die Regierung am 13.September 1996 setzte, werden künftige unpopuläre Reformen von der Bevölkerung sicherlich gelassener aufgenommen. Wenn freilich einzelne Gruppierungen oder "Besitzstandswahrer" dies zum Anlaßnehmen werden, den von der Regierung eingeschlagenen Weg zu korrigieren, ist dies im globalen Marktgefüge nicht vertretbar und wäre politisch unverantwortlich.
Die deutsche Politik ist nach dem entscheidungsprozessualen Hickhack des vergangenen "Sparpakets" gezwungen, parteien- und interessensübergreifende Schulterschlüsse zu üben und zu einem nationalen Konsens zu gelangen. Gelingt dies nicht, wird nicht nur die Gesellschaft im sich anbahnenden Verteilungskampf zerrieben, auch das Projekt der Währungsunion wird darunter leiden. Die Akzeptanz zur Währungsunion erhält man jedenfalls nicht, wenn Sparmaßnahmen mit europäischen Konvergenzkriterien gerechtfertigt werden. Eine direkte Verknüpfung der EWU mit Sozialkürungen wird auch dem Europa- Gedanken schließlich nicht dienlich sein, sondern verstärkte Abwehrreaktionen zur Folge haben.
(Stand: Januar 1997)
- Literaturverzeichnis -
Journalien
Bo Adam: Dem schwedischen Luftschloßgeht die Puste aus, Berliner Zeitung, 23.April 1993
Bonn: Sparpaket bringt 150 Milliarden Mark, Süddeutsche Zeitung, 28.Februar 1997
Bonn mußSparkurs noch verschärfen, Süddeutsche Zeitung, 6.September 1996
Ulrich Deupmann: Dünne Luft für Moralisten, Berliner Zeitung, 15.Oktober 1996
Lars-Martin Dude: Musterland ist abgebrannt, Die Woche, 15.März 1996
Einigung über Lohnfortzahlung, Die Welt, 20.Dezember 1996
Ferdos Forudastan: Koalition geschlossen für Sozialabbau, Frankfurter Rundschau, 14.September 1996
Harte Fronten bei Lohnfortzahlung, Die Welt, 25.September 1996
Soziales Gesundheitssystem totkrank, die tageszeitung, 16.November 1996
Gewerkschaften melden steigende Mitgliederzahlen, Bonner General-Anzeiger, 18.Dezember 1996
Rainer Hank: Für Blamagen geeignet, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 21.Dezember 1996
Rainer Hank: Ein Gesetz ohne Folgen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.Dezember 1996
Mehr als ein Hauch von Klassenkampf, Süddeutsche Zeitung, 28.November 1996
Gunter Hofmann: Wer ist die Straße?, Die Zeit, 21.Juni 1996
ipos-Umfrage, in: B. Bäumlisberger/ E.Grosskinsky: Die Schocktherapie, Focus, 11.November 1996
Werner Kaltefleiter: Dezentralsierung heißt mehr Eigenverantwortung, Bonner GeneralAnzeiger, 11.September 1996
Der Kanzler manhnt: Durch Festhalten an Besitzständen ist eine Wende nicht zu schaffen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.April 1996
Kurt Kieselbach: Sparpaket: DGB kündigt neue Proteste an, Die Welt, 28.August 1996
Keine Kontrollbesuche bei Beamten, Die Welt, 16. Januar 1997
Massive Kritik des Gewerkschaftsbundes, Handelsblatt, 29.April 1996
Bundesweite Lösung für Metall rückt näher, Frankfurter Rundschau, 13.Dezember 1996
Ulrich Lüke: Stumpfes Verantwortung, Bonner General-Anzeiger, 27.November 1996
Erika Martens: Lauter Scherben, Die Zeit, 13.Dezember 1996
Massenprotest zum Tag X, Die Welt, 28.Juni 1996
Bruno Meier-Johanns: Dicke Brocken, Das Sonntagsblatt, 6.September 1996
Mainhardt Graf Nayhauß: Kranke zur Abstimmung - mußdas sein?, Bild, 12.Dezember 1996
Christoph Neidhart: Immer mehr, nie genug, Die Weltwoche, Zürich, 2.Mai 1996
Werner A. Perger: Schweden und der Traum vom Glück, Die Zeit, 1.November 1996
Repnik sieht zum Sparkurs keine Alternative, Handelsblatt, 1.Oktober 1996
Ottmar Schreiner: Das Sparpaket der Bundesregierung, Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft, 3/96, (S.4-5), S.5
Schweden. Riesige Reserven, Wirtschaftswoche, 9.September 1993
"Von den Schweden lernen", Der Spiegel, 47/1996
Sparpaket, Frankfurter Rundschau, 12.Dezember 1996
Sparpaket wirkt als kleiner Dämpfer, Süddeutsche Zeitung, 17.Oktober 1996
SPD und DGB verbünden sich gegen Sparpläne, Die Welt, 30.April 1996
SPD will 100% Lohnfortzahlung per Gesetz, die tageszeitung, 11.Dezember 1996
SPD will mehr aktive Arbeitsmarktpolitik, Handelsblatt, 29.April 1996
Helmut Steuer: Der Sparkurs wird ohne viel Protest akzeptiert, Handelsblatt, 19.September 1996
Tarifeinigung für Metaller an Rhein und Ruhr, Süddeutsche Zeitung, 12.Dezember 1996
Kurzer Triumpf, Der Spiegel, 30/1996
Unternehmen sparen dank Sparpaket, die tageszeitung, 19.Februar 1997
Widerstand formiert sich, Handelsblatt, 29.April 1996
"Wir brauchen den Dialog", Der Spiegel, 50/1996
Rückläufige Zahlen bei Kurbewilligungen, die tageszeitung, 20.November 1996
Dokumente des Deutschen Bundestags
Bundesdrucksachen 13/1041, 13/4611, 13/4613, 13/5000, 13/5074, 13/5089, 13/5108, 13/5327, 13/5446, 13/5448, 13/5528, 13/5529, 13/5536, 13/5537, 13/5539, 13/5540, 13/6115, 13/6200
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Sparpaket", das in dem Text diskutiert wird?
Das "Sparpaket", offiziell bekannt als "Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung", war ein Gesetzespaket der Bundesregierung, das am 13. September 1996 verabschiedet wurde. Es sollte auf verschiedene ökonomische Zwänge reagieren und wurde von April bis September 1996 heftig diskutiert.
Wer prägte den Begriff "Sparpaket"?
Der Begriff "Sparpaket" wurde von den oppositionellen Kräften in Deutschland geprägt, um das Regierungsprogramm zu bezeichnen. Die Regierung sah diesen Begriff als entfremdend und sinnentstellend an.
Was waren die Hauptursachen und Motive für das "Sparpaket"?
Die Hauptmotive waren die schlechte konjunkturelle Lage, mangelnde Standortattraktivität im internationalen Wettbewerb, die Notwendigkeit zur Reduzierung der Staatsausgaben und Lohnnebenkosten sowie die angestrebte Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Ein weiterer Grund war der Beitritt zur Europäischen Währungsunion (EWU).
Welche politischen Kräfte waren an der Debatte um das "Sparpaket" beteiligt und welche Positionen vertraten sie?
Die wichtigsten politischen Kräfte waren die Arbeitgeberseite, die das Vorhaben unterstützte; die Gewerkschaften, die heftig dagegen protestierten; die Sozialpolitiker der Koalitionsparteien, von denen einige skeptisch waren; und die SPD-Opposition, die ein Alternativkonzept vorlegte.
Welche Rolle spielte der Bundesrat im parlamentarischen Ablauf des "Sparpakets"?
Der Bundesrat spielte eine bedeutende Rolle, da er die Gesetze entweder billigen oder ablehnen konnte. Die SPD-regierten Länder legten Einspruch gegen die Spargesetze ein, was den Bundestag zwang, die Gesetze mit der Kanzlermehrheit durchzusetzen.
Welche waren die wichtigsten Regelungen des "Sparpakets"?
Zu den wichtigsten Regelungen gehörten das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz (eingeschränkte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Lockerung des Kündigungsschutzes), das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz (stufenweise Anhebung der Altersgrenze für den Rentenbezug) und das Beitragsentlastungsgesetz (erhöhte Arzneimittelzuzahlung, vermehrte finanzielle Beteiligung bei Kuren, Brillen und Zahnersatz).
Was waren die ökonomischen und politischen Konsequenzen des "Sparpakets"?
Das Gesetz zur eingeschränkten Lohnfortzahlung wurde zunehmend zu Makulatur, da die Tarifpartner in der Regel die Lohnfortzahlung in ihren Verträgen fortschrieben. Die Gewerkschaften profitierten von der Debatte, da ihre Mitgliederzahlen wieder anstiegen. Die deutschen Betriebe sparten seit Inkrafttreten des Programms eine zweistellige Milliardensumme ein. Es wurde zudem eine Auswirkung auf die Kur- und Rehabilitationsbranche festgestellt.
Welche Lehren können aus dem schwedischen Beispiel gezogen werden, das in dem Text erwähnt wird?
Schweden, einst ein Vorbild für den Wohlfahrtsstaat, führte eine rigide Sparpolitik durch, die auf einem breiten öffentlichen Konsens beruhte. Dies ermöglichte es dem Land, sein Sozialbudget zu kürzen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit zu senken. Im Vergleich dazu war der Entscheidungsprozess in Deutschland durch Konfrontation und Polarisierung geprägt.
Was war der Ausblick nach der Verabschiedung des "Sparpakets"?
Es wurde erwartet, dass weitere Reformen notwendig sein würden und dass die deutsche Politik zu einem nationalen Konsens gelangen müsse, um die anstehenden Probleme zu lösen. Andernfalls drohten ein Verteilungskampf und eine Gefährdung des Projekts der Währungsunion.
- Quote paper
- Alex Gruhler (Author), 1997, Das "Sparpaket" der Bundesregierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95206