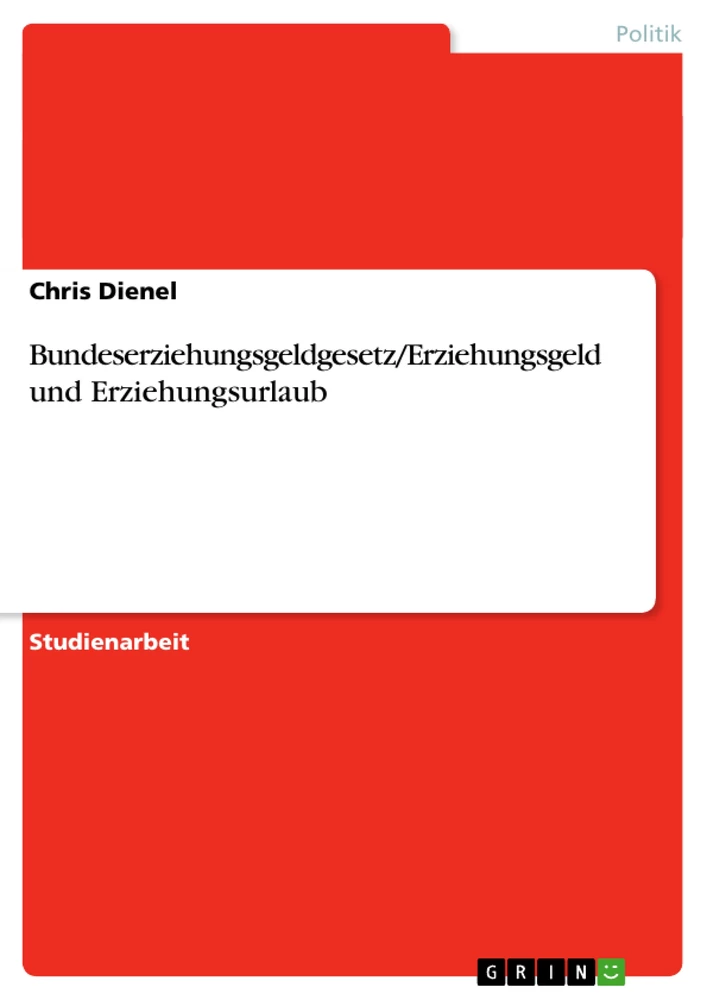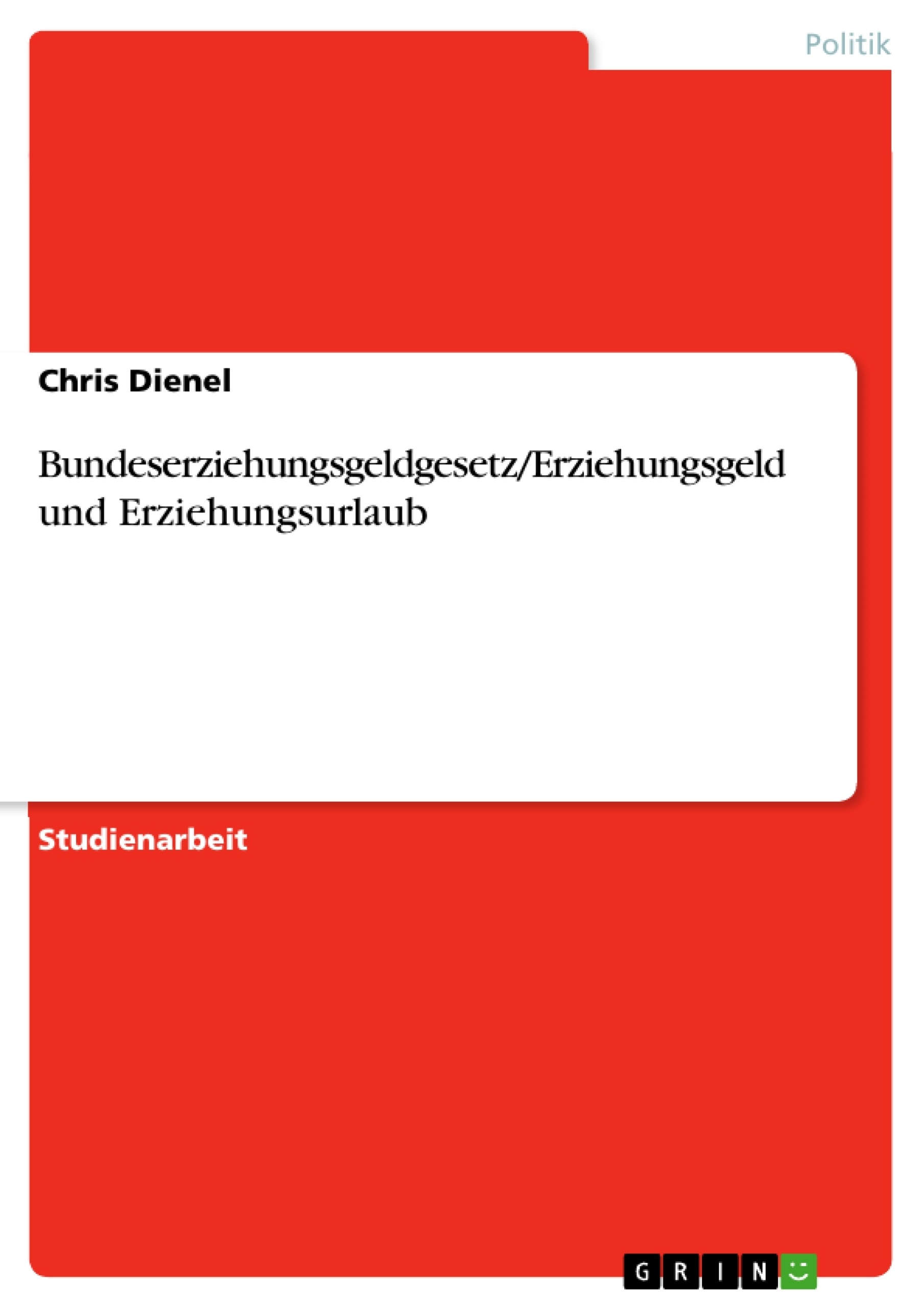Das Erziehungsgeld ist eine finanzielle Leistung an einen Elternteil oder eine andere berechtigte Person, die es ermöglichen soll sich ungestört durch eine Erwerbstätigkeit der Erziehung und Betreuung des Kindes in seiner ersten Lebensphase zu widmen. Durch das Erziehungsgeld wird die Erziehungsleistung des Betreuenden honoriert. Ein Anspruch auf Erziehungsgeld besteht ab dem Tag der Geburt des Kindes bis zur Vollendung des 24. Lebensmonats. Es wird einkommensabhängig gezahlt. Das heißt es gibt eine Einkommensgrenze, deren Überschreitung den Anspruch auf Erziehungsgeld ausschließen oder den Auszahlungsbetrag mindern kann. Diese Grenze ist ab dem 7. Lebensmonat niedriger als in den ersten 6 Lebensmonaten des Kindes. Das Erziehungsgeld kann monatlich höchstens 600 DM betragen. Sind mehrere Kinder zu betreuen, zum Beispiel bei Mehrlingsgeburtenoder im Falle der Geburt eines weiteren Kindes während des Erziehungsgeldbezuges, so wird gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BErzGG dieser Betrag für jedes Kind gezahlt.
Gliederung/Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeiner Überblick über die Leistungen Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
2. Berechtigte Personen
3. Voraussetzungen
3.1. Gemeinsame Voraussetzungen für den Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
3.2. Weitere Voraussetzungen für den Anspruch auf Erziehungsgeld
3.2.1. Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt
3.2.2. Voraussetzungen für andere ausländische Antragsteller
3.2.3. Bezug von Sozialleistungen
3.3. Weitere Voraussetzungen für einen Anspruch auf Erziehungsurlaub
3.3.1. Keine/keine volle Erwerbstätigkeit
3.3.2. Ausschlußgründe für einen Anspruch auf Erziehungsurlaub
4. Weitere Bestimmungen zum Erziehungsgeld und zum Erziehungsurlaub
4.1. Erziehungsgeld
4.1.1. Unterbrechung oder verzögerte Aufnahme aus wichtigem Grund
4.1.2. Vorliegen eines Härtefalls
4.1.3. Bedeutung des Einkommens für die Höhe des Erziehungsgeldes
4.1.4. Bestimmung zum Berechtigten
4.2. Erziehungsurlaub
4.2.1. Kündigungsschutz
4.2.2. Vorzeitige Beendung/ Verlängerung des Erziehungsurlaubs
5. Beantragung/ Kosten/ Zuständigkeit
5.1. Beantragung des Erziehungsgeldes
5.2. Verlangen (Beantragung) des Erziehungsurlaubes
5.3. Kostentragung
5.4. Zuständigkeit
Literaturliste
1. Allgemeiner Überblick über die Leistungen Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
Das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) enthält Regelungen zu zwei Leistungen: zum Erziehungsgeld und zum Erziehungsurlaub.
Das Erziehungsgeld ist eine finanzielle Leistung an einen Elternteil oder eine andere berechtigte Person, die es ermöglichen soll sich ungestört durch eine Erwerbstätigkeit der Erziehung und Betreuung des Kindes in seiner ersten Lebensphase zu widmen. Durch das Erziehungsgeld wird die Erziehungsleistung des Betreuenden honoriert.1 „Für Väter und Mütter wird mehr Wahlfreiheit zwischen der Tätigkeit für die Familie und der Erwerbstätigkeit geschaffen.(...)Die Erziehungskraft der Familie wird gestärkt, ihre Erziehungsleistung wird anerkannt (BT-Drucks. 10/3792 S.1).”2 Ein Anspruch auf Erziehungsgeld besteht ab dem Tag der Geburt des Kindes bis zur Vollendung des 24. Lebensmonats. Es wird einkommensabhängig gezahlt. Das heißt es gibt eine Einkommensgrenze, deren Überschreitung den Anspruch auf Erziehungsgeld ausschließen oder den Auszahlungsbetrag mindern kann. Diese Grenze ist ab dem 7. Lebensmonat niedriger als in den ersten 6 Lebensmonaten des Kindes. Das Erziehungsgeld kann monatlich höchstens 600 DM betragen. Sind mehrere Kinder zu betreuen, zum Beispiel bei Mehrlingsgeburtenoder im Falle der Geburt eines weiteren Kindes während des Erziehungsgeldbezuges, so wird gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BErzGG dieser Betrag für jedes Kind gezahlt. Damit soll der erhöhte Betreuungs- und Erziehungsaufwand angemessen berücksichtigt werden.3 Für Adoptivkinder und Kinder in Adoptionspflege kann 24 Monate ab dem Tag der Inobhutnahme Erziehungsgeld bezogen werden, bei Kindern die bis zum 31.12.92 geboren sind allerdings nur für eine Dauer von 18 Monaten. Ein Anspruch auf Erziehungsgeld besteht bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres des Adoptivkindes, falls dieses nicht sofort nach der Geburt in Obhut genommen wurde (§ 4 Abs. 1 BErzGG). Der Erziehungsurlaub ist die unbezahlte Freistellung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers in einem Beschäftigungsverhältnis, um die Betreuung und Erziehung eines Kindes zu ermöglichen beziehungsweise zu erleichtern. Erziehungsurlaub können Arbeitnehmer bis zu einer Dauer von 3 Jahren beziehungsweise bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes in Anspruch nehmen. Das Arbeitsverhältnis bleibt bestehen und der Arbeitnehmer ist in dieser Zeit vor Kündigung geschützt. Für adoptierte Kinder beziehungsweise Kinder in Adoptionspflege besteht ebenfalls ein Anspruch auf Erziehungsurlaub von insgesamt 3 Jahren, falls das Kind nicht sofort nach der Geburt in Obhut genommen wurde bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres (§ 15 Abs.1 Satz2 BErzGG).
2. Berechtigte Personen
Aus §§ 1 Abs. 3 und 15 Abs. 1 BErzGG ergibt sich das folgende Personen Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub haben können: die Mutter und der Vater eines Kindes, Stiefväter, Stiefmütter, Adoptiveltern, Personen die ein Kind mit der Absicht der Annahme in ihre Obhut genommen haben (Adoptionspflege), sowie nach § 1 Abs. 7 BErzGG im H ä rtefall andere Familienmitglieder oder deren Ehegatten.
Erziehungsurlaub steht jedoch ausschließlich Arbeitnehmern zu. Dazu zählen gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 BErzGG auch Auszubildende und zur Berufsbildung Beschäftigte.
Bei der Adoptionspflege handelt es sich um eine Vorstufe der Adoption. Das Kind wird bei den zukünftigen Adoptiveltern untergebracht um deren Eignung, nicht nur für die Pflege sondern vor allem für die Adoption selbst, zu prüfen.1
Ein H ä rtefall liegt vor bei Tod, schwerer Krankheit oder schwerer Behinderung eines Elternteils des Kindes. Andere Familienmitglieder die in einem solchen Härtefall Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub haben sind Verwandte 2. oder 3. Grades also Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister, Neffen oder Nichten des Kindes. Deren Ehepartner können ebenfalls einen Anspruch haben.2
Auch Ausländerinnen und Ausländer können Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub haben. Voraussetzung dafür ist, daß sie im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltberechtigung sind (§ 1 Abs. 1a Satz 1 BErzGG).
Ausländer ist wer keine deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne von Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz (GG) hat. Um einen Anspruch auf Erziehungsurlaub zu erlangen ist außerdem eine Arbeitserlaubnis (nach § 285 Sozialgesetzbuch (SGB) III) oder eine Arbeitsberechtigung (nach § 286 SGB III) und ein Arbeitsvertrag nach deutschem Arbeitsrecht notwendig.3 Eine Aufenthaltsberechtigung bedeutet ein zeitlich und räumlich unbegrenztes
Daueraufenthaltsrecht (nach § 27 Ausländergesetz (AuslG)), eine Aufenthalterlaubnis ein allgemeines Aufenthaltsrecht ohne Bindung an einen bestimmten Aufenthaltszweck (nach §§ 15, 17 AuslG). Asylbewerber haben keinen Anspruch auf Erziehungsgeld, da sie keine Aufenthaltserlaubnis erhalten. „Gemäß § 55 Asylverfahrensgesetz ist ihnen zur Durchführung des Asylverfahrens der Aufenthalt lediglich zu gestatten (Aufenthaltsgestattung).Darin kommt Zum Ausdruck, daß dieser Aufenthalt zeitlich begrenzt der Prüfung der Voraussetzungen für eine Asylberechtigung dient, ”4
Auch Minderjährige können gemäß § 36 Abs. 1 SGB I ab dem 15. Lebensjahr einen Antrag auf Erziehungsgeld stellen. Allerdings ist die Handlungsfähigkeit des Minderjährigen eingeschränkt, das heißt er ist von der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, dem Sorgeberechtigten, abhängig. Dieser wird von der zuständigen Behörde über den Eingang des Antrags informiert und kann innerhalb einer Frist Einwände erheben.5
3. Voraussetzungen
3.1. Gemeinsame Voraussetzung für den Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
Personen die grundsätzlich berechtigt sein können Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub zu erhalten, müssen darüber hinaus einige Voraussetzungen erfüllen. Das sind sowohl im Fall des Anspruchs auf Erziehungsgeld als auch des Anspruchs auf Erziehungsurlaub: das Innehaben der Personensorge für das Kind, das Leben mit ihm in einem Haushalt, die Betreuung und Erziehung des Kindes durch den Antragsteller selbst und das keine oder keine volle Erwerbst ä tigkeit vorliegt.
Die Personensorge als Teil der elterlichen Sorge nach § 1626 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist die Aufgabe der Mutter und des Vaters, für die Person des minderjährigen Kindes Sorge zu tragen. „Die Personensorge hat zum wesentlichen Inhalt das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.”6 Dies ist festgelegt in § 1631 Abs. 1 BGB. Für ein nichteheliches Kind steht die Personensorge Grundsätzlich der Mutter zu (nach § 1705 BGB). Der Vater ist nur dann personensorgeberechtigt, wenn ihm dieses Recht ausdrücklich durch das Familiengericht (vorher Vormundschaftsgericht) übertragen wird. Eine Ausnahme liegt vor bei einer Adoption, einer Heirat der Mutter oder einer Ehelicherklärung des Kindes durch den Vater des Kindes. In diesen Fällen ist keine Übertragung des Personensorgerechts durch das Familiengericht nötig. Auch falls der sorgeberechtigte Elternteil einem Bezug von Erziehungsgeld, der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub oder der Betreuung und Erziehung des Kindes durch den nicht sorgeberechtigten Elternteil zustimmt, ist eine Übertragung des Personensorgerechts nicht notwendig. Außer dem Vater eines nicht ehelichen Kindes kann die Personensorge auch Großeltern oder Pflegeeltern durch eine Entscheidung des Familiengericht zugesprochen werden.1
In Fällen besonderer Härte (nach § 1 Abs. 7 BErzGG) kann von der Erfordernis der Personensorge abgesehen werden, wenn die restlichen Voraussetzungen des § 1 erfüllt sind. Da die Maßgabe Leben in einem Haushalt und der Begriff Haushalt selbst vielseitig interpretierbar sind wurden die folgenden Definitionen getroffen. Das Leben in einem Haushalt mit dem Kind ist das Zusammenleben bezogen auf gemeinsame Räume, materielle Versorgung und persönliche Zuwendung. Dabei kommt es nicht darauf an aus welchen und wievielen Personen der Haushalt besteht.2 Der Begriff Haushalt (Famlienhaushalt) ist in § 9 Mutterschutzgesetz (MuSchG) folgendermaßen definiert: Er ist der Mittelpunkt der privaten Lebensführung zur Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse einer Familie oder einer einzelnen Person (BT-Drucks. IV/3652 S. 5).3 Entscheident ist ein auf Dauer angelegtes Zusammenleben mit dem Kind, also die Bildung einer häuslichen Gemeinschaft.4 Handelt es sich um ein nicht leibliches Kind, also zum Beispiel um ein Stiefkind, das in den Haushalt des Antragstellers aufgenommen werden soll, muß außerdem eine familienähnliche Dauerbindung angenommen werden können.5 Das Zusammenleben in einem Haushalt mit dem Kind ist ausdrückliche Voraussetzung, wenn der Erziehungsgeldempfänger oder Erziehungsurlauber ein nicht sorgeberechtigter Elternteil ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BErzGG). Für die Begriffe Betreuung und Erziehung gibt es keine gesetzliche Definition. Nach allgemeinem Verständnis wird jedoch Folgendes angenommen: Mit der Betreuung ist vordergründig die Versorgung und Pflege, mit der Erziehung die Einwirkung auf die Entwicklung des Kindes durch pädagogische Maßnahmen gemeint. Inhaltliche Vorgaben von staatlicher Seite sind dabei nicht möglich, da die Eltern nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG hierfür allein verantwortlich sind. Im Sozialversicherungsrecht wird ein Verhalten der Eltern als ausreichend erachtet, das „nach dem Verständnis und den Vorstellungen der Eltern dazu bestimmt und darauf gerichtet ist, die körperliche, geistige, seeliche, sittliche und charakterliche Entwicklung des Kindes zu beeinflussen.”6 Da das Erbringen von Erziehungsmaßnahmen schwer zu kontrollieren ist, wird es grundsätzlich angenommen, wenn eine Haushaltsgemeinschaft besteht.7
Die Voraussetzung ‘Betreuung und Erziehung erfolgen durch den Antragsteller selbst ‘ bedeutet das der überwiegende Teil der Erziehungsleistung durch ihn Persönlich erbracht werden soll. Das heißt jedoch nicht das er sich ununterbrochen und vollkommen allein um das Kind kümmern muß. Kurze Krankenhausaufenthalte sind ebenso unerheblich wie ein angemessener Erholungsurlaub, eine Kur oder der Besuch einer Fortbildungsveranstaltung. Auch können andere Personen, zum Beispiel Angehörige, zur Unterstützung bei der Kinderziehung herangezogen werden oder das Kind bis zu halbtägig in eine öffentliche beziehungsweise private Einrichtung gegeben werden. Unzulässig ist dagegen die ganztägige Betreuung des Kindes in einer Einrichtung, sowie die regelmäßige Abwesentheit des Antragstellers für mehrere Tage pro Woche vom Haushalt in dem er mit dem Kind lebt.1 Als weitere Bedingung die eingehalten werden muß um Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld zu erhalten nennen § 1 Abs. 1 Nr. 4 und § 15 Abs. 4 Satz 1 BErzGG, daß keine oder keine volle Erwerbst ä tigkeit vorliegt. „Dadurch soll sichergestellt werden, daß der ’Pflege und Betreuung des Kindes Vorrang vor vor der Erwerbstätigkeit eingeräumt’ wird (BT-Drucks. 10/3792 S. 14).”2 „Eine Erwerbstätigkeit ist jede auf Gewinn oder Einkommen gerichtete Tätigkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder als Selbständiger. ”3 Eine nicht volle Erwerbstätigkeit ist laut § 2 Abs. 1 Nr. 1 BErzGG eine Beschäftigung die nicht nach SGB III versicherungspflichtig ist oder eine wöchentliche Arbeitszeit von 19 Stunden nicht überschreitet. Gelegentliche jedoch nicht regelmäßige Abweichungen beziehungsweise Überschreitungen von geringer Dauer sind dabei unerheblich. Auch eine Beschäftigung zur Berufsbildung stellt gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 BErzGG keine volle Erwerbstätigkeit dar. Dies soll es Auszubildenden ersparen, sich entweder für eine ungestörte Ausbildung oder ausschließlich für die Erziehung des Kindes entscheiden zu müssen.4
3.2. Weitere Voraussetzungen für den Anspruch auf Erziehungsgeld
3.2.1. Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt
Die wichtigste Grundvoraussetzung um einen Anspruch auf Erziehungsgeld zu erlangen ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BErzGG der Wohnsitz oder gew ö hnliche Aufenthalt in Deutschland. Die Begriffe Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sind definiert in § 30 Abs. 3 SGB I . Danach befindet sich der Wohnsitz dort wo jemand eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen das er die Wohnung benutzen und beibehalten wird. Dabei kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse an und nicht darauf, daß der Betreffende polizeilich gemeldet ist. Als Wohnung gelten alle Räumlichkeiten die für einen längeren Aufenthalt geeignet sind. Sie müssen so ausgestattet sein das eine regelmäßige Nutzung erwartet werden kann. Die Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse muß möglich sein.5 Die Wohnung wird benutzt, wenn sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse in Anspruch genommen wird. Beibehalten wird sie, wenn sie für unbestimmte Zeit genutzt werden soll, also kein baldiger Auszug absehbar ist.6 Bei einem Auslandsaufenthalt unter Beibehaltung der Wohnung wird von ihrer Aufrechterhaltung ausgegangen, wenn der Aufenthalt voraussichtlich 2 Jahre nicht überschreiten wird und einer Wiederbenutzung keine tatsächlichen Hinderungsgründe entgegenstehen.7
Den gew ö hnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort beziehungsweise in diesen Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Der gewöhnliche Aufenthalt kann anders als anders als die Wohnung zu einem Zeitpunkt nur an einem Ort sein. Es wird ein Schwerpunkt der Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands vorausgesetzt um die Bedingung als erfüllt betrachten zu können.8
Ausnahmem
Von der Voraussetzung eines festen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts innerhalb Deutschlands ausgenommen sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BErzGG Arbeitnehmer deutscher Unternehmen, die von ihrem Arbeitgeber zur vor ü bergehenden Dienstleistung ins Ausland entsandt wurden. Es ist in jedem Fall erforderlich das der Arbeitgeber in Deutschland ansässig ist und vor der Entsendung ins Ausland eine Beschäftigung im Inland bestand. Es darf kein Arbeitsvertrag ausschließlich für eine Auslandsbeschäftigung geschlossen worden sein.1 Eine Entsendung liegt nach den Grundsätzen des Sozialversicherungsrecht dann vor, wenn der Beschäftigung im Ausland ein in Deutschland bestehender Arbeitsvertrag zugrunde liegt und die Tätigkeit von vornherein als zeitlich begrenzt festgelegt wird.
Auch Beamte und andere Angehörige des öffentlichen Dienstes die vorübergehend zur Arbeitsleistung ins Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert wurden, sind gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 BErzGG eine Ausnahme. Hier geht man stets von einer zeitlich begrenzten Tätigkeit im Ausland aus.2
Gemäß § 1 Abs. 4 BErzGG haben weiteren Anspruch auf Erziehungsgeld Grenzgänger aus den an Deutschland angrenzenten Staaten und Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft, die innerhalb Deutschlands einer Beschäftigung nachgehen, welche die Wochenarbeitszeit von unter 15 Stunden für geringfügige Beschäftigungen übersteigt. Für sie ist kein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt innerhalb Deutschlands notwendig. Ein Grenzgänger ist eine Person die ihren Beschäftigungsort innerhalb Deutschlands aber ihren Wohnort im an Deutschland angrenzenden Ausland hat und „in der Regel täglich, mindestens aber einmal wöchentlich an seinen Wohnort zurückkehrt.”3
3.2.2. Voraussetzungen für andere ausländische Antragsteller
Ein Anspruch auf Erziehungsgeld (und auch auf Erziehungsurlaub) ist für ausländische Antragsteller geknüpft an einen gesicherten ausländerrechtlichen Status. Er ist Voraussetzung für das Erhalten einer Arbeitserlaubnis, die die Teilnahme am Arbeitsmarkt ermöglicht. Erst dann kann das Erziehungsgeld seinen Zweck erfüllen: Wahlfreiheit zwischen Kinderziehung und Berufstätigkeit.4 Wie schon unter dem Punkt ’Berechtigte Personen’ angesprochen, wird von einem ausländischen Antragsteller eine Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis benötigt, um einenAnspruch auf Erziehungsgeld zu erlangen. Dabei ist die Rechtswirksamkeit der Genehmigung ausschlaggebend.5 „Hält sich der Ausländer länger als ein halbes Jahr ununterbrochen und erlaubterweise in der Bundesrepublik auf, so geht die Verwaltung davon aus, daß er von Anfang an seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland begründet hat (vgl. Grüner/Dalichau § 1 BErzGG III 2).”6
Ist allerdings ein ausländischer Arbeitnehmer zur vorübergehenden Dienstleistung von seinem im Ausland ansässigen Arbeitgeber nach Deutschland entsandt, haben er und sein Ehepartner grundsätzlich keinenAnspruch auf Erziehungsgeld. Dabei spielt die aufenthaltsrechtliche Stellung keine Rolle.7 Mitglieder der NATO-Streitkräfte die in Deutschland stationiert sind haben keinen Anspruch auf Erziehungsgeld. Das gilt auch für Angehörige des zivilen Gefolges und deren Familienangehörige. Eine Ausnahme ist festgelegt in § 1 Abs. 6 BErzGG. Demnach hat der nicht erwerbstätige Ehegatte eines Mitglieds der Truppe oder des zivilen Gefolges einen Anspruch auf Erziehungsgeld, wenn er die deutsche Staatsangehörigkeit oder Die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt. Desweiteren muß er nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BerzGG den NATO-Angehörigen erst nach dessen Einreise in die Bundesrepublik geheiratet haben. Obwohl in Verbindung mit dieser Bedingung gesetzlich keine weiteren Einschränkungen festgelegt sind, wird in der Praxis zusätzlich ein zuvor bestehender Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland vorausgesetzt.1 Ein Anspruch kann auch für Personen möglich sein die als Ehepartner eines NATO-Angehörigen eingereist sind, wenn bereits in den letzten 2 Jahren vor Einreise ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt innerhalb Deutschlands bestand. Auf die Dauer kommt es dabei nicht an, auch muß der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt in dieser Zeit nicht ununterbrochen vorgelegen haben.2
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BErzGG kann der Ehegatte eines NATO-Angehörigen unabhängig von seiner Staatsangehörikeit Anspruch auf Erziehungsgeld haben, wenn er einer nach SGB III versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, in einem öffentlich-rechtlichen Dienst oder Amtsverhältnis steht oder bis zur Geburt des Kindes Sozialleistungen bezogen hat. Dies sind Arbeitslosengeld beziehungsweise Arbeitslosenhilfe, Mutterschaftsgeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld oder Eingliederungsgeld.
3.2.3. Bezug von Sozialleistungen
In § 2 Abs. 2 BErzGG wird der Bezug von Sozialleistungen einer vollen Erwerbstätigkeit, die ja einen Bezug von Erziehungsgeld ausschließt, gleichgestellt. Dies wurde festgelegt, um eine Besserstellung von Sozialleistungsbeziehern gegenüber voll Beschäftigten zu vermeiden.3 „Voraussetzung ist, daß diese Sozialleistungen die Verluste ersetzen sollen, die infolge eines aus bestimmten Gründen hervorgerufenen Erwerbsausfalls entstehen, meist als Folge des Eintritts eines Versicherungsfalls.”4 Solche Lohnersatzleistungen sind: Arbeitslosengeld, Arbeitslosenbeihilfe (nicht zu verwechseln mit Arbeitslosenhilfe) und Eingliederungsgeld ( § 2 Abs. 2 Nr. 1 BErzGG); sowie Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld und Unterhaltsgeld, wenn sie Ersatz für eine Beschäftigung von mehr als 19 Stunden pro Woche sind (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 BErzGG). Der Bezug von Arbeitslosenhilfe schließt den gleichzeitigen Bezug von Erziehungsgeld nicht aus, denn „Die neben dem Erziehunggeld gezahlte Arbeitslosenhilfe ist keine Lohnersatzleistung im Sinne von § 107 Satz 1 Nr. 5 Buchst. c Arbeitsförderungsgesetz (AFG).”5
In einem Ausnahmefall kann nach § 2 Abs. 3 BErzGG auch ein Anspruch auf Erziehungsgeld bestehen obwohl ein Bezug von Arbeitslosengeld vorliegt. Nämlich dann wenn einem Arbeitnehmer nach der Geburt des Kindes aus Gründen gekündigt wird, die er nicht selbst zu vertreten hat. Das ist der Fall wenn Umstände die Kündigung verursachen auf die der Betroffene keinen Einfluß nehmen kann, zum Beispiel bei einer betriebsbedingten Kündigung. Ein Anspruch auf Erziehungsgeld besteht auch falls die erfolgte Kündigung trotz Kündigungsschutz nach § 9 MuSchG oder § 18 BErzGG zulässig war oder der Wegfall des Erziehungsgeldes für den Betreffenden eine unbillige Härte in der Form bedeuten würde, daß er für seinen und den Unterhalt des Kindes nicht mehr selbst aufkommen könnte.6
3.3.Weitere Voraussetzungen für einen Anspruch auf Erziehungsurlaub
3.3.1. Keine/keine volle Erwerbstätigkeit
Während des Erziehungsurlaubs kann ein Arbeitnehmer bis zu 19 Stunden pro Woche in Teilzeit arbeiten (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BErzGG). Die Teilzeit kann gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 BErzGG beim eigenen Arbeitgeber desr den Erziehungsurlaub gewährt oder mit dessen Erlaubnis Zustimmung auch bei einem anderen Arbeitgeber verrichtet werden. Eine Ablehnung dieser Zustimmung kann der Arbeitgeber des Erziehungsurlaubers nur mit entgegenstehenden betrieblichen Interessen begründen (§ 15 Abs. 4 Satz 3 BErzGG). Eine wöchentliche Arbeitszeit von 19 Stunden darf jedoch nicht überschritten werden.1
3.3.2. Ausschlußgründe für einen Anspruch auf Erziehungsurlaub
Gilt ein Besch ä ftigungsverbot im Rahmen der Mutterschutzfrist nach § 6 MuSchG, besteht gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 BErzGG währenddessen kein Anspruch auf Erziehungsurlaub. Dieses Verbot hat eine Dauer von 8 Wochen nach der Geburt des Kindes. Für Mütter von Früh- und Mehrlingsgeburten besteht es verlängert für 12 Wochen. Da es der Mutter in dieser Zeit möglich ist, das Kind selbst zu betreuen und zu erziehen bedarf es keiner zusätzlichen Freistellung in Form von Erziehungsurlaub. Auch eine andere Person als die Mutter kann in dieser Zeit keinen Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen. Eine Ausnahme besteht für den Fall das die Mutter des Kindes selbständig tätig ist, dann kann ihr Ehemann sofort nach der Geburt Erziehungsurlaub nehmen.2
Lebt der Arbeitnehmer mit dem anderen Elternteil in einem Haushalt und ist dieser nicht erwerbst ä tig, so besteht für ihn gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 2 BErzGG ebenfalls kein Anspruch auf Erziehungsurlaub. Unter diesen Umständen wird davon ausgegangen das die Betreuung und Erziehung des Kindes bereits sichergestellt ist.3 „Erwerbstätig ist ein Elternteil dann, wenn er gegen Entgelt Tätigkeiten verrichtet, ”4 Personen die einer Ausbildung nachgehen, zum Beispiel Lehrlinge, Praktikanten und Umschüler sind grundsätzlich in diesem Sinne erwerbstätig. Ist der andere Elternteil arbeitslos gemeldet, muß es ihm jederzeit möglich sein eine Beschäftigung aufzunehmen. Dann ist durch ihn die Betreuung und Erziehung des Kindes nicht mehr dauerhaft gewährleistet. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer berechtigt Erziehugsurlaub in Anspruch zu nehmen.5
Der Arbeitnehmer hat nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 BErzGG ebenfalls keinen Anspruch auf Erziehungsurlaub solange sich der andere Elternteil bereits in Erziehungsurlaub befindet. Eine Ausnahme von dengenannten Ausschlußgründen besteht, wenn die Betreuung des Kindes durch den anderen Elternteil nicht sichergestellt ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein bei einer lange andauernden Erkrankung oder bei einem längerfristigen Verlassen des Haushalts. Dabei spielt es keine Rolle ob die Betreuung des Kindes durch Dritte erfolgen kann, zum Beispiel durch die Großeltern. Entscheident ist nur das der andere Elternteil verhindert ist.6
4. Weitere Bestimmungen zum Erziehungsgeld und zum Erziehungsurlaub
4.1. Erziehungsgeld
4.1.1. Unterbrechung oder verzögerte Aufnahme aus wichtigem Grund
Gemäß § 1 Abs. 5 BErzGG wird der Anspruch auf Erziehungsgeld durch eine verzögerte Aufnahme oder Unterbrechung der Betreuung und Erziehung des Kindes aus wichtigem Grund nicht negativ beeinflußt. Die Aufnahme wird dann verzögert, wenn es dem Berechtigten nicht möglich ist das Kind sofort ab dem Tag der Geburt zu betreuen und zu erziehen, jedoch voraussehbar ist das ihm dies später möglich sein wird. Es ist also wie auch bei einer Unterbrechung notwendig, daß es sich lediglich um eine vorübergehende Verhinderung handelt. Die unterbrechung oder verzögerte Aufnahme wird erst rechlich relevant, wenn über einen längeren Zeitraum die Betreuung des Kindes nicht mehr gewährt werden kann oder auf seine Erziehung überhaupt kein Einfluß mehr ausgeübt wird. Als längerer Zeitraum kann ein über einen Monat hinausgehender angesehen werden. Eine konkrete Zeitgrenze ist jedoch gesetzlich nicht festgelegt. Die Unterbrechung muß in jedem Fall in Relation zumBezugszeitraum des Erziehungsgeldes von untergeordneter Bedeutung bleiben.1 In der Verwaltungspraxis beträgt die Obergrenze der Verzögerungsdauer zur Aufnahme der Erziehung beziehungsweise die Obergrenze der Dauwer der Unterbrechung 2 Monate.2 Ist die Verzögerung oder Unterbrechung vom Betreffenden allerdings nicht zu beeinflussen, kann auch eine längere Dauer zulässig sein.3
Es muß ein wichtiger Grund für die Unterbrechung vorliegen. Das „soll die Maßgeblichkeit objektiver Verhältnisse sicherstellen (BT-Drucks. 10/4212 S. 5); auf ein Verschulden kommt es nicht an.”4 Der wichtige Grund muß ein Umstand sein der sich unmittelbar auf die Möglichkeit zur Betreuung und Erziehung des Kindes auswirkt. So können keine Umstände ein wichtiger Grund sein, die zum Beispiel in der Person des nichterziehenden Ehegatten brgründet liegen.5 „In Betracht kommen als wichtige Gründe vor allem Krankheit, aber auch die Ableistung von Wehr- oder Zivildienst (ThürLSG v. 29. 8. 1995, L 3 Eg 274/94). ”6
4.1.2. Vorliegen eines Härtefalles
In Fällen besonderer Härte kann gemäß § 1 Abs. 7 Satz 1 BErzGG von der Bedingung der Betreuung und Erziehung des Kindes und vom Verzicht auf eine volle Erwerbstätigkeit abgesehen werden. Auch der Bezug von Lohnersatzleistungen ist dann möglich, da diese ja einer vollen Erwerbstätigkeit gleichgestellt sind. Fälle besonderer Härte sind zum Beispiel die in § 1 Abs. 7 Satz 2 BErzGG genannten: Tod, schwere Krankheit oder Behinderung eines Elternteils. Darüberhinaus kann aber auch eine Scheidung beziehungsweise Trennung oder eine wirtschaftliche Notsituation, wie sie häufig bei Alleinerziehenden vorkommt, einen Härtefall darstellen. Liegt einer der in § 1 Abs. 7 Satz 2 BErzGG genannten Umstände vor, kann auf die Erfordernis der Personensorge verzichtet werden, wenn die restlichen Voraussetzungen des § 1 erfüllt sind und das Kind mit dem Antragsteller, der ein Verwandter zweiten oder dritten Grades sein muß, in einem Haushalt lebt. Desweiteren darf nicht bereits ein Personensorgeberechtigter Erziehungsgeld für das Kind beziehen. Ein Härtefall muß, am Vergleichsmaßstab einer vom Gesetzgeber als normal angesehenen Situation gemessen, immer eine Sondersituation sein.1
4.1.3. Bedeutung des Einkommens für die Höhe des Erziehungsgeldes
Das Erziehungsgeld bträgt 600 DM monatlich ( § 5 Abs. 1 BErzGG). Da es einkommensabhängig gezahlt wird kann trotz grundsätzlichen Anspruches das Erziehungsgeld ganz wegfallen oder sich der Betrag ab dem 7. Lebensmonat des Kindes vermindern. Das Erziehungsgeld entfällt gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 BErzGG, wenn das gemeinsame Einkommen zusammenlebender Ehegatten jährlich mehr als 100 000 DM beträgt und das anderer Berechtigter jährlich mehr als 75 000 DM.2 Ab Beginn des 7. Lebensmonats des Kindes vermindert sich das Erziehungsgeld oder entfällt ganz, wenn das Jährliche Einkommen nicht dauernd getrennt lebender Ehepartner 29 400 DM und das anderer Berechtigter 23 700 DM übersteigt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 BErzGG). Die genannten Einkommensgrenzen erhöhen sich nach § 5 Abs. 2 Satz 3 BErzGG für jedes weitere Kind, für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht um 4200 DM.3
Übersteigt das Einkommen die genannten, ab dem 7. Lebensmonat gültigen Einkommensgrenzen, dann werden 40 % des die Grenze übersteigenden Betrages angerechnet und ein Zwölftel von diesen 40 % jeweils pro Monat vom Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM abgezogen (§ 5 Abs. 3 BErzGG). Ergibt sich dann ein noch zu zahlender Betrag von weniger als 40 DM, so wird dieser nicht gezahlt (§ 5 Abs. 4 Satz 2 BErzGG).4 Ehepartnern die nicht dauernd getrennt leben sind Eltern gleichgestellt die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben. Das ist der Fall, wenn die Beziehung zwischen den Partnern so eng ist, daß man davon ausgehen kann das sie füreinander einstehen.5 Da sich der Zeitpunkt der Betragsminderung an der Lebenszeit des Kindes orientiert und dahingehend für den Fall der Inobhutnahme eines Kindes im BErzGG keine Regelung getroffen wurde, stellt die Praxis die Inobhutnahme der Geburt gleich.6
Der Begriff Einkommen ist in § 6 Abs. 1 BErzGG folgendermaßen definiert: Das Einkommen ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Einkommenssteuergesetz (EstG). Positive Einkünfte sind zum Beispiel Überschüsse aus nicht selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung etc. oder Gewinn aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land und Forstwirtschaft.7 Von der Summe der Positiven Einkünfte wird gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BErzGG ein Pauschalbetrag von 27 % abgezogen, bei Personen nach § 10 c Abs. 3 EstG, zum Beispiel Beamten, Richtern und Zeitsoldaten nur ein Betrag von 22 %. Desweiteren werden Unterhaltsleistungen an Kinder für dieder kindbezogene Einkommensfreibetrag von 420 DM nicht berücksichtigt wurde und andere Unterhaltsleistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BErzGG abgezogen.8 Auch für ein behindertes Kind wird gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 BErzGG ein Pauschalbetrag abgezogen.
4.1.4. Bestimmung zum Berechtigten
In § 3 Abs. 2 Satz 1 BErzGG ist festgelegt, daß in dem Fall das beide Ehepartner die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Erziehungsgeld erfüllen, derjenige Erziehungsgeld erhält der zum Berechtigten bestimmt wurde, ansonsten ist die Mutter die Berechtigte (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BErzGG). Nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BErzGG kann eine Änderung der Bestimmung zum Berechtigten später nur erfolgen, wenn die Betreuung und Erziehung des Kindes nicht mehr gesichert ist, also eine oder mehrere Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Der wechsel erfolgt jeweils zu Beginn des nächsten Lebensmonats des Kindes (§ 3 Abs. 4 BErzGG). Gemäß § 3 Abs. 3 BErzGG kann ein Elternteil ist er nicht sorgeberechtigt nur Erziehungsgeld beziehen, wenn der andere sorgeberechtigte Elternteil dem zustimmt.
4.2. Erziehungsurlaub
4.2.1. Kündigungsschutz
„Nach § 18 Abs. 1 BErzGG darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis während und kurz vor Beginn des Erziehungsurlaubes nicht kündigen. In besonderen Fällen kann durch eine behördliche Erlaubnis vor Ausspruch der Kündigung diese für zulässig erklärt werden.” 1 ‘Kurz vor Beginn des Erziehungsurlaubs‘ bedeudet gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 BErzGG das der Kündigungsschutz ab dem Zeitpunkt des Erziehungsurlaubsverlangens, frühestens aber 6 Wochen vor Antritt des Erziehungsurlaubes besteht. Dies spielt vor allem für Väter eine Rolle, da sie als einzige Anspruchsberechtigte nicht bereits durch andere Gesetze vor einer Kündigung vor Antrii des Erziehungsurlaubes geschützt sind.2 Der Kündigungsschutz nach § 18 Abs. 1 BErzGG besteht auch für Arbeitnehmer die in Teilzeit bei ihrem Arbeitgeber tätig sind (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BErzGG). Auch hier darf die Wochenarbeitszeit höchstens 19 Stunden betragen. Hat der in Teilzeit Beschäftigte einen Anspruch auf Erziehungsgeld oder hat er ihn nur deshalb nicht, weil sein Einkommen die Einkommensgrenze übersteigt und erfüllt er die Voraussetzungen nach § 15 für einen Anspruch auf Erziehungsurlaub ohne ihn in Anspruch zu nehmen, so besteht auch für ihn der Kündigungsschutz nach§ 18 Abs. 1 BErzGG (§ 18 Abs.2 Satz 2 BErzGG).3 Nach dem Ende des Erziehungsurlaubes kann der Arbeitnehmer gemäß § 19 BErzGG mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen.
4.2.2. Vorzeitige Beendigung /Verlängerung des Erziehungsurlaubs
Der Erziehungsurlaub kann gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 BErzGG vorzeitig beendet oder unter Einhaltung der in § 15 Abs. 1 festgelegten Bedingungen verlängert werden. Grundlegende Voraussetzung ist in beiden Fällen allerdings die Zustimmung des Arbeitgebers. Eine Ausnahme nach § 16 Abs. 3 Satz 2 BErzGG liegt vor, falls ein vorgesehener Wechsel zwischen Berechtigten aus wichtigem Grund nicht erfolgen kann. Ist der wichtige Grund so schwerwiegend das die Betreuung des Kindes nicht mehr sichergestellt ist, entfällt die Zustimmungserfordernis. Unabhängig von der Zustimmung des Arbeitgebers hat der Arbeitnehmer das Recht das Arbeitverhältnis zu kündigen.4
5. Beantragung/Kosten/Zuständigkeit
5.1. Beantragung des Erziehungsgeldes
Das Erziehungsgeld muß gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1BErzGG schriftlich beantragt werden und zwar für jeweils 1 Lebensjahr des Kindes. Dies ist notwendig, da sich die Höhe des Erziehungsgeldes am aktuellen Einkommen orientiert.5 Für das 2. Lebensjahr kann ein Antrag erst frühestens ab dem 9. Lebensmonat gestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 2 BErzGG). Dem Antrag auf Erziehungsgeld sollten beigefügt werden: die Geburtsurkunde des Kindes, Nachweise über die Höhe des Einkommens und gegebenenfalls ein Nachweis der Krankenkasse über Höhe und Bezugsdauer des Mutterschaftsgeldes.1
Erziehungsgeld wird auch rückwirkend gezahlt, höchstens für 6 Monate vor Eingangsdatum des Antrags (§ 4 Abs. 2 Satz 3 BErzGG). Falls sich das voraussichtliche Einkommen des Antragstellers für das Kalenderjahr der Geburt noch nicht endgültig eindeutig bestimmen läßt, kann für die ersten 6 Lebensmonate des Kindes das Erziehungsgeld unter dem Vorbehalt der Rückforderung genehmigt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BErzGG).
5.2. Verlangen (Beantragung) von Erziehungsurlaub
Der Arbeitnehmer muß den Erziehungsurlaub gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 BErzGG bereits mindestens 4 Wochen bevor er ihn anzutreten beabsichtigt vom Arbeitgeber verlangen und erklären, für welchen Zeitraum beziehungsweise für welche Zeiträume er ihn in Anspruch nehmen möchte. Eine Aufteilung des Erziehungsurlaubs in 3 Zeitabschnitte ist möglich, gibt es mehrere Berechtigte können sie sich dreimal abwechseln (§ 16 Abs. 1 Satz 2 BErzGG). Für die Erklärung des Erziehungsurlaubverlangens gibt es keine Formvorschrift. Sie kann sowohl mündlich als auch Schriftlich erfolgen. Aus Beweisgründen ist es jedoch ratsam die Schriftliche Form vorzuziehen.2 Ist es einem Arbeitgeber aus Gründen die er nicht selbst zu vertreten hat, also nicht selbst direkt beeinflussen kann, nicht möglich einen sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist anschließenden Erziehungsurlaub fristgerecht zu verlangen, hat er nach Wegfall des Grundes eine Woche lang Zeit dies nachzuholen (§ 16 Abs. 2 BErzGG).
5.3. Kostentragung
Gemäß § 11 BErzGG trägt der Bund die durch das Erziehungsgeld entstehenden Ausgaben. Er erstattet den Ländern die von den zuständigen Landesbehörden ausgezahlten Gelder. Die den Ländern in Verbindung mit der Durchführung des BErzGG entstehenden Verwaltungsosten muß der Bund den Ländern nach Art 104 a Abs. 5 GG nicht erstatten.3
5.4. Zuständigkeit
Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 BErzGG bestmmen die Länderregierungen welche Behörde für die Ausführung des BErzGGs zuständig ist. Die gleiche Behörde führt die Beratung zum Erziehungsurlaub durch. Den Ländern steht auch das Recht zu die mit der Durchführung des Gesetzes verbundenen Verwaltungsanweisungen zu erlassen.
Die Aufgaben der zuständigen Behörde sind die Beratung, die Entgegennahme von Anträgen, die Erteilung von Bescheiden, die gesetzmäßige Bewilligung und die Auszahlung des Erziehungsgeldes. „Örtlich zuständig für den Antrag ist das Amt, in dessen Bezirk der Erziehungsgeldberechtigte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.”4
Literaturverzeichnis
Böttcher, Inge / Graue Bettina (1999): Eltern- und Mutterschutzrecht, Basiskommentar; 1. Auflage; Bund-Verlag/Frankfurt am Main
Buchner, Herbert / Becker, Ulrich (1998): Kommentar zum Mutterschutzgesetz und Bundeserziehungsgeldgesetz (Beck'sche Kommentare zum Arbeitsrecht Band 4); 6. Auflage; Beck/München
Meisel, Peter G. / Sowka, Hans-Harald (1995): Mutterschutz und Erziehungsurlaub; Kommentar zum Mutterschutzgesetz, zu den Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach Reichsversicherungsordnung und zum Bundeserziehungsgeldgesetz; 4. Auflage; Vahlen/München
Sowka, Hans-Harald (1997): Handbuch zum Erziehungsurlaub; Hrsg.:Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Kohlhammer/Stuttgart, Berlin, Köln
Marburger, Horst (1999): Werdende Mütter brauchen Geld; Mutterschutz, Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub, Sozialleistungen für junge Familien; Walhalla- Fachverlag/Regensburg/ Bonn
Sowka, Hans-Harald: Streitfragen des Erziehungsurlaubs, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA), 1994, Seite 102-106
[...]
1 Meisel/Sowka, Einleitung Rn. 2
2 Buchner/Becker, Einführung Rn. 1
3 Böttcher, § 3 Rn. 3
1 Sowka (1997), Seite 40 Rn. 100
2 Sowka (1997), Seite 42 Rn. 106/107
3 Sowka (1997), Seite 34 Rn. 80
4 Buchner/Becker, § 1 Rn. 38
5 Böttcher, § 4 Rn. 4
6 Buchner/Becker, § 1 Rn. 48
1 Meisel/Sowka, § 1 Rn. 9
2 Buchner/Becker, § 1 Rn. 46
3 Böttcher, § 1 Rn. 14
4 Sowka (1997), Seite 43 Rn. 109
5 Meisel/Sowka, § 1 Rn. 14
6 BSG,Buchner/Becker, S.662
7 Buchner/Becker, § 1 Rn. 53
1 Buchner/Becker, § 1 Rn.54; Sowka (1997), Seite 43 f. Rn. 111
2 Buchner/Becker, § 1 Rn.57
3 Böttcher, § 1 Rn. 18
4 Meisel/Sowka, § 1 Rn. 13
5 Buchner/Becker, § 1 Rn. 4 und 5
6 Buchner/Becker, § 1 Rn. 6
7 Böttcher, § 1 Rn. 8
8 Buchner/Becker, § 1 Rn. 9
1 Buchner/Becker, § 1 Rn. 14
2 Böttcher, § 1 Rn. 10 und 11
3 Buchner/Becker, § 1 Rn. 26
4 Buchner/Becker, § 1 Rn. 35
5 Buchner/Becker, § 1 Rn. 36
6 Meisel/Sowka, § 1 Rn.3
7 Buchner/Becker, § 1 Rn. 42
1 Buchner/Becker, § 1 Rn. 42
2 Buchner/Becker, § 1 Rn. 44
3 Meisel/Sowka, Einleitung Rn. 2
4 Buchner/Becker, § 2 Rn. 10
5 BSG,NZS 1996, Seite 189
6 Buchner/Becker, § 2 Rn. 23
1 Sowka (1997), Seite 48 Rn. 129; Sowka, NZA 1994, Seite 104
2 Sowka (1997), Seite 44/45 Rn. 116-118
3 Sowka (1997), Seite 47 Rn. 126
4 Böttcher, § 15 Rn. 7
5 Böttcher, § 15 Rn. 6 und 7
6 Sowka (1997), Seite 47/48 Rn. 126/127
1 Buchner/Becker, §1 Rn. 55
2 Meisel/Sowka, § 1 Rn. 17
3 Buchner/Becker, §1 Rn. 55
4 Buchner/Becker, §1 Rn. 56
5 Meisel/Sowka, § 1 Rn. 16
6 Buchner/Becker, §1 Rn. 56
1 Böttcher, § 1 Rn. 61
2 Böttcher § 5 Rn. 1
3 Böttcher § 5 Rn. 2
4 Böttcher § 5 Rn. 8
5 Böttcher § 5 Rn. 4; BverfG, NJW 1993, S. 643
6 Buchner/Becker, § 5 Rn. 11
7 Böttcher, § 6 Rn. 2
8 Böttcher, § 6 Rn. 5
1 Sowka, NZA 1994, Seite 105
2 Sowka, NZA 1994, Seite 105
3 Böttcher, § 18 Rn. 11-13
4 Böttcher § 16 Rn. 12-14
5 Böttcher § 4 Rn. 3
1 Böttcher, § 10 Rn. 6
2 Böttcher, § 16 Rn. 5
3 Böttcher, § 1 Rn. 1 und 2
Häufig gestellte Fragen zu Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
Was sind Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub?
Das Erziehungsgeld ist eine finanzielle Leistung, die Eltern während der ersten Lebensphase ihres Kindes erhalten können, um die Betreuung und Erziehung des Kindes zu ermöglichen. Der Erziehungsurlaub ist eine unbezahlte Freistellung vom Arbeitsverhältnis, um sich der Betreuung und Erziehung des Kindes zu widmen.
Wer hat Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub?
Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub haben Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern, Personen in Adoptionspflege und in Härtefällen andere Familienmitglieder oder deren Ehegatten. Erziehungsurlaub steht ausschließlich Arbeitnehmern zu.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub zu erhalten?
Zu den gemeinsamen Voraussetzungen gehören: Personensorge für das Kind, Leben mit dem Kind in einem Haushalt, Betreuung und Erziehung des Kindes durch den Antragsteller selbst und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit.
Welche weiteren Voraussetzungen gelten speziell für den Anspruch auf Erziehungsgeld?
Zusätzlich zu den gemeinsamen Voraussetzungen muss der Antragsteller einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Es gibt Ausnahmen für entsandte Arbeitnehmer und Grenzgänger.
Welche weiteren Voraussetzungen gelten speziell für den Anspruch auf Erziehungsurlaub?
Während des Erziehungsurlaubs darf eine Teilzeitbeschäftigung von bis zu 19 Stunden pro Woche ausgeübt werden. Es gibt Ausschlussgründe, z.B. während der Mutterschutzfrist oder wenn der andere Elternteil nicht erwerbstätig ist.
Welche Bestimmungen gelten bezüglich der Höhe des Erziehungsgeldes?
Das Erziehungsgeld beträgt monatlich 600 DM. Es ist einkommensabhängig und kann bei Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen reduziert oder ganz entfallen.
Was ist bei der Beantragung von Erziehungsgeld zu beachten?
Das Erziehungsgeld muss schriftlich beantragt werden, und zwar für jeweils 1 Lebensjahr des Kindes. Es wird auch rückwirkend gezahlt, höchstens für 6 Monate vor Eingangsdatum des Antrags.
Wie verlangt man Erziehungsurlaub vom Arbeitgeber?
Der Erziehungsurlaub muss mindestens 4 Wochen bevor er angetreten werden soll, vom Arbeitgeber verlangt werden. Dabei muss erklärt werden, für welchen Zeitraum der Urlaub in Anspruch genommen werden möchte. Eine Aufteilung ist möglich.
Welchen Kündigungsschutz genießt man während des Erziehungsurlaubs?
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis während und kurz vor Beginn des Erziehungsurlaubes nicht kündigen. In besonderen Fällen kann die Kündigung durch eine behördliche Erlaubnis für zulässig erklärt werden.
Kann der Erziehungsurlaub vorzeitig beendet oder verlängert werden?
Der Erziehungsurlaub kann vorzeitig beendet oder verlängert werden, grundsätzlich aber nur mit Zustimmung des Arbeitgebers. Es gibt Ausnahmen, wenn die Betreuung des Kindes nicht mehr sichergestellt ist.
Wer trägt die Kosten für das Erziehungsgeld?
Der Bund trägt die durch das Erziehungsgeld entstehenden Ausgaben und erstattet den Ländern die ausgezahlten Gelder.
Welche Behörde ist für die Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes zuständig?
Die Länderregierungen bestimmen, welche Behörde für die Ausführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes zuständig ist. Die gleiche Behörde führt die Beratung zum Erziehungsurlaub durch.
- Arbeit zitieren
- Chris Dienel (Autor:in), 2000, Bundeserziehungsgeldgesetz/Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95169