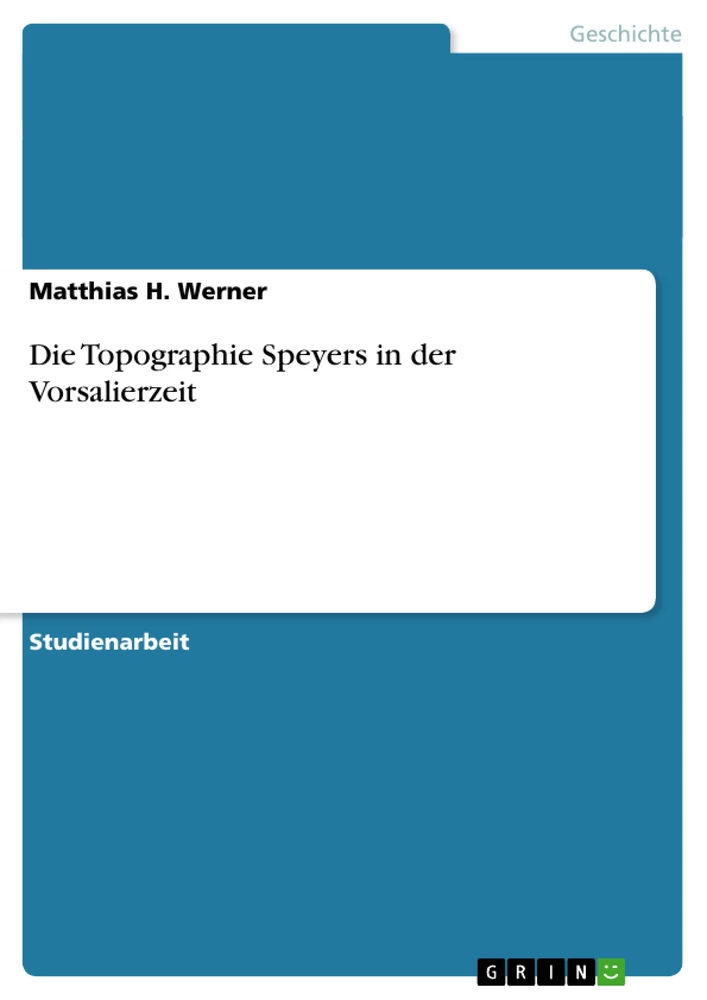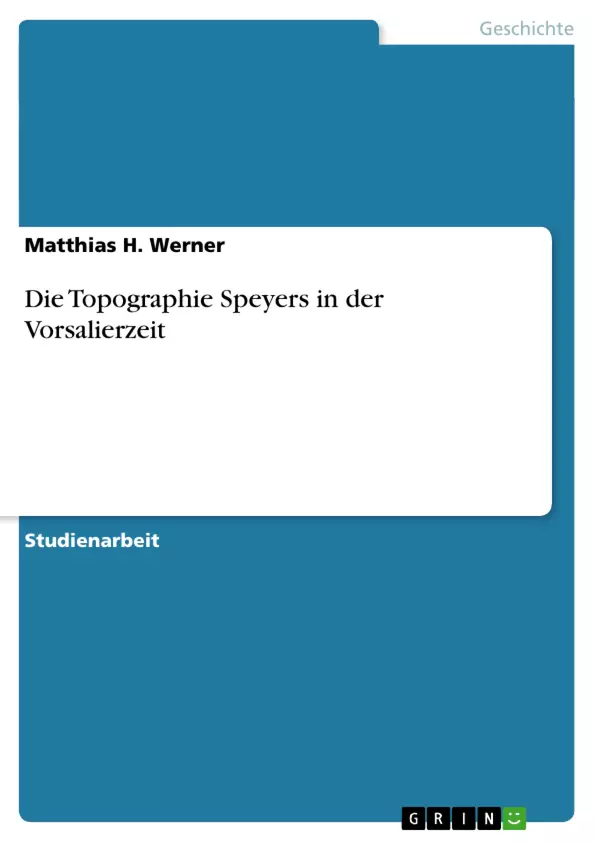Inhalt
1.) Einleitung
2.) Quellenlage
3.) Geografische Lage und räumliche Gegebenheiten
4.) Die Siedlungsentwicklung vor der Inthronisation der Salier
a.) Die Periode vor 10 v. Chr.
b.) Die Militärperiode
c.) Das zivile Noviomagus
d.) Aus dem Vorort Noviomagus wird die Festung Nemetae
e.) Spira in der Merowinger- und Karolingerzeit f.) Die ottonische und frühsalische Stadt g.) Die weitere Stadtentwicklung
5.) Schlußbemerkung
Quellenangaben
1.) Einleitung
Die Forschung um die Geschichte der Stadt Speyer, die Suche nach den frühen Wurzeln in vorzeitlichen Siedlungen und den Weg der heutigen Domstadt durch den wechselvollen Gang der Weltgeschichte war Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in der Vergangenheit.
Die aus den nur spärlich vorhandenen Funden zu ziehenden Schlüsse mußten immer wieder verworfen werden, oftmals endet die Betrachtung bestimmter Aspekte mit einem ratlosen Stirnrunzeln oder einem vorsichtigen ,,man vermutet, daß...".
Mit jedem Fund, der bei Bauarbeiten in und um die alte Kaisergrablege aufgenommen wird, kann das bisherige Gebäude der Theorien und das gewonnene Bild der Entwicklungsgeschichte Speyers grundlegend erschüttert werden.
Gegenstand dieser Arbeit soll ein Aufriß über die Entwicklung der Stadt bis zur Bestimmung zur Kaisergrablege durch die Salier sein.
Dabei sollen vorrangig die topografischen Vorgänge und Prozesse betrachtet werden - wenngleich man dabei um eine generellere Sicht auf die historischen Entwicklungen selbstverständlich nicht umhin kommt.
Die Behandlung des Themas soll eng an die epochalen Ereignisse der Weltgeschichte angelehnt sein und dabei einen Überblick über den Forschungsstand unserer Tage geben, bisweilen aber auch über die Hinentwicklung zu diesem und über verworfene Thesen und revidierte Meinungen aufklären.
2.) Quellenlage
Bereits um 1500 setzt die Beschäftigung mit antiken Funden im Speyerer Boden ein. Dabei wurden Erwähnungen eines Venus- und eines Merkurtempels (Wolfgang Baur, kurz nach 1500), Zeichnungen von Inschriften (Wynand Pighius), eines Sarkophages mit Beigaben (Georg Christoph Lehmann, 1612) und von "Todten-Töpffen" (Georg Litzel, 1749) überliefert.
Allerdings wurden die wirklich bemerkenswert großen Funde hauptsächlich durch die zunehmende Bautätigkeit ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ermöglicht: Die ersten Kanalarbeiten 1927 eröffneten die Möglichkeit, den Speyerer Untergrund in größerem Stile zu erforschen. Auf Museumsdirektor Friedrich Sprater, der diese Forschungen leitete, gehen auch die Entdeckung der ersten Militäranlagen und die Einschätzung der Ausdehnung der frühen Siedlungen zurück. Aber nicht nur die Bauarbeiten förderten die Forscher in ihrem Tun: Die weitgehend ausgebliebene Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg - in vielen stark zerstörten Gebieten machte die überlebensnotwendige rasche Bautätigkeit die Beachtung archäologische Schätze in nicht unerheblichem Umfang zumeist unmöglich, wenn nicht durch den schnellen Wiederaufbau archäologische Relikte gar gänzlich zerstört worden sind - und die erst sehr spät einsetzende Stadtsanierung erwiesen sich für die Archäologen als ein Segen. In den vergangenen vierzig Jahren konnten mehrere aufschlußreiche Funde gemacht werden: Im Gebiet Judenbad, am
Domhügel, beim Bau des Stiftungskrankenhauses, in der Heydenreichstraße, am Kornmarkt, am Königsplatz, am Alten Markt, beim Neubau der Sparkasse am Siebertplatz und zum letzten Mal 1987/88 bei den Bauarbeiten auf dem Domvorplatz.1 Dennoch sind die Belege für die frühe Zeit der Siedlungsgeschichte äußerst dürftig. Einer der Gründe ist die starke Rheinaktivität, die erst mit der 1817 begonnenen Rheinregulierung endgültig gestoppt wurde.
Schriftliche Quellen sind für die frühe Siedlungsgeschichte überhaupt nicht, für die spätere nur sehr fragmentarisch vorhanden.
3.) Geografische Lage und räumliche Gegebenheiten
Die Lage der Stadt Speyer wird auch heute charakterisiert von einem weit vorgeschobenen erhöhten Sporn. Diese Niederterrasse ist durch die sich ändernde Strömung des Rheins, der sein Bett im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verlegt hat, entstanden.2 Allerdings läßt die extreme Spitze des Dorns auf spätere Aufschüttungen schließen. Ansonsten sind die Ränder der Niederterrasse in den vergangenen zweitausend Jahren weitgehend unverändert geblieben. Die Südost- und die Nordostflanke sind deutlich als Prallhang für den Rhein ausgebildet; die beachtliche Geländestufe, insbesondere entlang des Domhügels, erscheint uns als deutliches Zeichen für vormalige Erosion. In Wirklichkeit aber haben Grabungen gezeigt, daß die Kante im Verlauf der Jahrhunderte immer schärfer wurde, weil Mauern und Befestigungen am Terrassenrand eine höhere Aufschüttung des Siedlungsschutts erlaubten.3
Die Niederterrasse erhebt sich heute etwa 103 m über Normalnull (NN); da man wie bereits erwähnt Aufschüttungen in zurückliegender Zeit annehmen darf, ist von einer ursprünglichen Höhe von etwas unter 100 m über NN auszugehen.4
Diese Formation, die in der letzten Eiszeit entstanden ist, bot zu allen Zeiten - und bietet dies bis heute - einen relativ guten Schutz vor Hochwassern: Ein Anschwellen der Wassermassen über den Wert von 98 m über NN ist in diesem Gebiet nur äußerst selten5. Der mittelalterliche Kern der Stadt lag auf dem nördlichen Teil dieser Niederterrasse, die dem eigentlichen Hochufer vorgelagert war und ist. Das Hochufer selbst war nicht besiedelt, da dort die alltäglichen Verrichtungen schwieriger gewesen wären6 und - wie bereits erwähnt - der Hochwasserschutz auch schon auf der Niederterrasse gegeben war. Nördlich und südlich der alten Siedlungsfläche sind jeweils zwei Altwassersysteme aus Schriftquellen, älteren Plänen und noch vorhandenen Resten zu erschließen, die als ältere Rheinläufe gedeutet werden können.7
4.) Die Siedlungsentwicklung vor der Inthronisation der Salier
a.) Die Periode vor 10 v. Chr.
Erste Funde aus dem Gebiet um Speyer stammen aus dem Jungpaläolithikum8. ,,Im Verlauf des 5. Jahrtausends v. Chr. wanderte aus dem Donaugebiet eine bäuerlich strukturierte Bevölkerung ein"9, die sich aber immer wieder mit verschiedenen Kleingruppen im Raum abwechselte. Während diese ersten Siedler durch archäologische Funde nicht wirklich nachgewiesen werden können, belegt eine Abfallgrube aus der älteren Eisenzeit eine Siedlung, die spätestens im 4. und 3. Jh. v. Chr. in eine keltische Siedlung überging.10
Die Siedlungen, aus denen das heutige Speyer entstanden ist, trugen mehrere voneinander recht verschiedene Namen.
Die Bezeichnung Noviomagus war ein keltischer Begriff, der übersetzt ,,Neufeld" bedeutet. Aus diesem Grund nahmen ältere Forschergenerationen immer wieder an, ,,daß der römischen Siedlung eine große keltische Bebauung, vielleicht sogar eine stadtartige Anlage vorausgegangen ist"11, deren Gründung zumeist auf die Jahre um 70 v. Chr. datiert wird12. Die Funde sprechen aber eine ganz andere Sprache: Da aus dieser Zeit ein Gräberfeld recht gut erhalten ist, müßten sich, wäre eine nennenswert große Besiedelung vorhanden gewesen, auch davon Überreste finden lassen. Nach neuesten Erkenntnissen haben allerdings ausschließlich zwei kleinere Höfe auf der Nordseite der Terrassenkante bestanden; ein Grab, das auf die Zeit zwischen 50 und 10 v. Chr. datiert wird, legt die Vermutung nahe, daß im Bereich der heutigen Stadt durchaus ein Hof bis zur Ankunft der Römer bestanden haben könnte.13
b.) Die Militärperiode
Die Zeit, in der die Römer das Gebiet des heutigen Speyer hauptsächlich militärisch nutzten. Zunächst spielte der mittlere Oberrhein keine besondere militärische Rolle: Nach dem Ende des Gallischen Krieges 50 v. Chr. war der Rhein allenfalls eine juristische Grenze des Reiches und vollkommen außerhalb des militärischen Interesses.14 In der Okkupationsphase (um 10 v. Chr.) sollte lediglich eine Straßenverbindung von Basel nach Mainz gesichert werden. Von der ortsansässigen keltischen Bevölkerung ging keinerlei Gefahr aus, da sie sich bereits sehr stark dezimiert hatte; so waren nur sehr kleine Schanzanlagen nötig.
Die in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit ,,Lager A" bezeichneten Funde15 lassen den Schluß zu, daß zu dieser frühen Phase eine Befestigungsanlage mit einer Ausdehnung von nur wenig mehr als 100 m Seitenlänge bestand. Nach Norden erstreckte sie sich wahrscheinlich bis zur Terrassenkante. Die genaue Größe läßt sich allerdings bislang nicht ermitteln, weshalb wichtige Aufschlüsse über die Besatzungsstärke unmöglich sind. Ebenso ist eine genaue Datierung nicht vollkommen gesichert: Relativ wahrscheinlich ist schon in der Zeit des Drusus um 10 oder 9 v. Chr. diese frühe Militäranlage anzunehmen.16
,,Die Dauer der militärischen Besetzung von Lager A ist derzeit nicht erschließbar. Es ist aber wahrscheinlich, daß Lager B direkt anschloß."17 Diese erst aus spätaugusteischer Zeit18 stammende Kastellanlage ist weitaus besser belegt: Sie lag zwischen der südlichen Terrassenkante - heute Große Pfaffengasse - und der Kleinen Pfaffengasse. Es sind sowohl der nördliche Abschluß, als auch der Verlauf des östlichen Grabens rekonstruierbar. Die Fläche betrug etwa 2,5 ha, also genug, um eine 500 Mann starke Auxiliartruppe unterzubringen.19
In unmittelbarer Nähe dieses Kastells, gleichsam als zugehöriger Teil, war ein Vicus 20 entstanden, das auch Zivilisten Unterkunft bot; dieses erstreckte sich beidseits der westlichen Ausfallstraße und wurde von Händlern, Handwerkern, Soldatenfamilien und auch von der Vergnügungsbranche belebt21: ,,Entlang einer Straße waren Streifenhäuser aus Holz in dichter Reihe gebaut"22, im Süden befand sich ein Marktforum23. Gerade dieser Markt unterstreicht die besondere Bedeutung Speyers für die gesamte Region.
Sowohl Vicus, als auch die zugehörige Straße haben seit dieser Zeit fortbestanden und bilden so die eigentliche Keimzelle des antiken Speyer.
Bei Grabungen in der Heydenreichstraße, in der Schustergasse, in der Ludwigstraße und am Königsplatz fanden sich weitere Spuren eines ehemaligen Römerlagers: Man fand den Verlauf der Süd- und der Ostfront eines Kastells, die aus dem 1. Jahrhundert nach Christus stammen - künftig Lager C genannt24. Die ältesten Funde legen eine Gründung in tiberianischer Zeit nahe.25 Zum Lager C, das nach den Funden zu urteilen weitaus größer gewesen sein muß, als Lager B26, gehörte darüber hinaus ein in der Himmelsgasse ausgegrabenes Militärbad. Mit diesem Lager hängt wohl auch zusammen, daß sich zu dieser Zeit ein Abnehmen der Siedlungsintensität im gesamten bisherigen Vicus nachweisen läßt.
Nach den Funden reicht das Kastell mindestens bis in flavische Zeit27 ; die Auxiliartruppen zogen im Jahr 74 n. Chr. ab und eine weitere Verwendung beispielsweise als Nachschubstation ist nicht zu belegen.28
c.) Das zivile Noviomagus
Mit der Eroberung der rechtsrheinischen Gebiete durch die Römer war der Grenzcharakter der Rheins aufgehoben, die Gebiete wurden aus der Militärverwaltung entlassen. Zu einer Verleihung von Selbstverwaltungsrechten kam es wahrscheinlich im Zuge der Einrichtung der Provinz Germania superior in der Zeit um 83 n. Chr.29 Bis zu den einschneidenden Ereignissen, die 270 n. Chr. eine Zäsur in der Entwicklungsgeschichte darstellten, hat sich die Siedlung von dörflichem Gepräge in eine ,,kleinstädtische Metropole der Region"30 verwandelt; daran konnten auch die Germaneneinfälle31 von 233 und besonders 260 n. Chr., die den erneuten Verlust der rechtsrheinischen Gebiete zwischen Limes und Rhein brachten, nichts ändern, obschon die damit verbundenen Flüchtlingsströme von Menschen, die aus ihren bisherigen Siedlungsgebieten auf rechtsrheinischer Seite über den Fluß strömten und deren Eingliederung auch dieser Civitas größere Probleme bereitet haben dürfte.
Die innere Entwicklung ging rasch von statten: Nachdem die Militärs 74 n. Chr. abgezogen waren, blieb eine etwa 3ha große Fläche auf der Niederterrasse frei, an der bislang das Kastell C gestanden hatte. Diese Fläche wurde rasch besiedelt. Es kam zur Anlage einer großen Straße als Hauptachse in Ost-West-Richtung, die bereits von Anfang an als ,,Prachtstraße" ausgelegt war.32 Des weiteren beherbergte das antike Noviomagus als Vorort der Civitas Nemetum einen repräsentativen Bau für die Ratsherren als Sitz der Verwaltung.33 Sicherlich sind aber auch andere öffentliche Bauten wie Thermen, Theater und religiöse Kultstätten anzunehmen.
Der verheerende Germaneneinfall 275 n. Chr. nach dem Tod Aurelians 34 führte zu einer verheerenden, nahezu vollständigen Zerstörung der Stadt und beendete die Siedlungsgeschichte vorläufig.35 Die mutige Neuordnung der römischen Verhältnisse unter Diokletian 36 ermöglicht auch Noviomagus einen raschen Wiederaufstieg: Noch vor 300 n. Chr. wurde zumindest um die Hauptstraße mit dem Wiederaufbau begonnen, zu Beginn des 4. Jahrhunderts blühte die Stadt bereits wieder auf.37 Allerdings konnte an die alte Bedeutung als Handelsstadt nicht mehr angeschlossen werden, da die Straßenverbindung in das Neckargebiet mit den Alamanneneinfällen weggefallen war, eine wichtige Route nach Westen aber nie bestanden hat; so blieb man ausschließlich auf die Rheinuferstraße bezogen.38
Aus spätrömischer Zeit sind kaum Funde vorhanden, allerdings ist davon auszugehen, daß das Siedlungsareal bis in spätantike Zeit stark verkleinert wurde und sich in einer einfachen Straßensiedlung erschöpfte.39
Das Gebiet des heutigen Speyer fiel zusammen mit einem breiten linksrheinischen Streifen 352 n. Chr. nach der Ursurpation des weströmischen Kaiserthrons durch Magnentius 40 und dessen Niederlage gegen die mit den oströmischen Reich verbündeten Alamannen in die Hände des Germanenstammes. Erst Julian 41 konnte die Civitas Nemetum 357 n. Chr. wieder befreien. Die fünf Jahre germanischer Besatzungszeit bedeuteten für Speyer einen noch stärkeren Einschnitt, als die Zerstörungen von 275 n. Chr.: ,,Im Civitas - Vorort waren die Zerstörungen so gravierend, daß in der Folgezeit die ausgedehnte Straßensiedlung nicht mehr aufgebaut wurde".42
d.) Aus dem Vorort Noviomagus wird die Festung Nemetae
Ab 368 n. Chr. baute Julians Nachfolger Valentinian I.43 zum Schutz des Reiches Festungen, Wachtürme und Schiffsländen an Rhein und Donau und in diesem Zuge auch eine Festung auf dem Speyerer Domhügel.44 Spätestens 369 n. Chr. war Speyer - nun unter dem Namen Nemetae - zum Garnisonsort geworden. Bei den Ausmaßen der Festung - die Längenausdehung dürfte bei etwa 230 m, die Ost- Westausdehnung bei gut 150 m gelegen haben - hatte neben der Besatzung auch die Zivilbevölkerung genügend Platz. Bei den großen Germanen- und Alaneneinfällen der Neujahrsnacht 406/407 kam es in Speyer wieder zu Zerstörungen, die allerdings nicht allzu gravierend gewesen sein dürften45: Die Bevölkerung konnte ihre Unterkünfte wieder herrichten.46 Allerdings spielt Speyer in der Zeit des 5. und bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts kaum eine Rolle: Die Siedlung war zwar nicht verlassen - was erneut Grabfunde belegen -, aber die gebildete römische Schicht dürfte relativ dünn gewesen sein.
e.) Spira in der Merowinger- und Karolingerzeit
In der Zeit um das Jahr 500 dürfte es - nachdem das Gebiet um Speyer zunächst in alamannischer, spätestens ab 50647 in fränkischer Hand war - zu germanischen Besiedlungen gekommen sein. Als Beispiel dafür sei die ,, Villa Spira" angeführt: ,,Altspeyer", das etwa um 500 gegründet wurde und als Siedlung bis heute an gleicher Stelle im Norden Speyers erhalten blieb. Daneben existierten aber weitere Siedlungen, die im Laufe der Zeit wieder aufgegeben wurden. Dennoch war die römische Festung um die gleiche Zeit noch von Romanen besiedelt48, obgleich es durch den engen Kontakt mit der neuen germanischen Siedlung zu einem raschen Ausdünnen der romanischen Kultur kam: Die lateinisch sprechende Bevölkerung war nicht einmal in der Lage, ihren antiken Siedlungsnamen zu erhalten - bereits im frühen 7. Jh. wird Nemetae Spira genannt.49
Durch die Übernahme der Herrschaft durch die Merowinger entstand nicht nur neue militärische Sicherheit, sondern auch eine Wiederherstellung des alten, nach allen Seiten unbeschränkten Handelsraumes für Speyer.50 Auch die stark an die keltisch-römische Tradition angelehnte Verwaltungsstruktur, die die Merowinger einführten, machte Speyer wieder zu einem Zentrum seiner Region, dem wahrscheinlich schon im 6. Jahrhundert eingerichteten, wenngleich erst im 8. und 9. Jh. explizit belegten ,,Speyergau".51
Es kommt frühestens in der Mitte des 6., eventuell aber auch erst in der Zeit zwischen 623 und 639 zur Wiederbegründung der Diözese Speyer.52 Die Kirche hatte bekanntermaßen in der nachfolgenden Zeit einen beschleunigenden Einfluß auf die Speyerer Entwicklung. Ein Sinnbild für den ,,Sieg" des Christentums über das Heidentum darf in dem an der Stelle des ehemaligen Merkurtempels errichteten Adelskloster St. German gesehen werden, das sich bereits 550 archäologisch nachweisen läßt.
Datiert man den ersten Bischof auf das 6. Jh., dann muß auch die Errichtung einer Bischofskathedrale angenommen werden. Der gesamte Bischofssitz befand sich wahrscheinlich innerhalb der noch weitgehend unzerstörten Mauern aus römischer Zeit, so daß eine Neuanlage einer Wallanlage nicht angenommen werden muß.53 Die Patrone dieses frühen Doms waren Maria und Stephan - das darf aber nicht dazu verleiten, in einer weiteren Kirche, die in Speyer bestand, St. Stephan, den vorsalischen Dom zu vermuten.54 Die Architekturfragmente der Stephanskirche, die beim heutigen Landesarchiv gefunden wurden, können relativ eindeutig auf die Zeit des späten 8. Jahrhunderts datiert werden - zu dieser Zeit muß ein Neu- oder Ausbau erfolgt sein.55 Der Dom dagegen wurde nach diesem Termin, spätestens 858 begonnen, 865 wird davon gesprochen, der Dom sei erbaut, 891 geweiht worden.56 Die Lage des Domes ist nach heutigem Wissensstand unbekannt; eine Lage auf dem Gebiet des heutigen Nachfolgebaus kann nicht ausgeschlossen werden.
Um 650 wurde Speyer das Privileg Sigiberts III. zuteil, das der Speyerer Kirche den Zehnten des königlichen Besitzes im Speyergau zusicherte, nur 14 Jahre später folgte die Immunität, die Childerich II. dem Bischof zugestand.
Den ursprünglich recht umfangreichen Besitzung des Bischofs von Speyer steht im 8. und 9. Jahrhundert eine auffällige Bedeutungslosigkeit gegenüber: Kein merowingischer oder karolingischer König hielt sich länger in der Stadt auf, allein die Durchreise wird vereinzelt gemeldet.57 Dennoch: Auch wenn der Verlust der Abtei Weißenburg, die - ursprünglich zur Wahrung und Mehrung des bischöflichen Besitzes im Speyergau gegründet - in dieser Zeit ihre Eigenständigkeit erhielt, sich nachteilig für den Sitz des Oberhirten auswirkte, hatte Speyer entgegen dem durch die allgemeine Quellenlage suggerierten Eindruck recht große Bedeutung; zahlreiche Besitzungen in der Stadt gehörten zwar entweder dem Graf und seinen Hörigen, oder aber dem Bischof und seinen Hörigen. Doch ,,daß die Speyerer ihre Häuser und Gärten nicht an Auswärtige veräußern konnten, war eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit, nicht notwendigerweise ihres Reichtums".58 Weiterhin ist anzunehmen, daß die Keimzelle der Stadt sich zunächst am Osthang des Domhügels befunden hat und von dort aus die Ausbreitung stattfand.59
Eine eigene Kaufleutesiedlung, die bereits vor 94660 bestanden haben könnten, ist anzunehmen: Erst zu diesem Datum wurden die Kaufleute den übrigen Stadtbewohnern rechtlich gleichgestellt; aus der rechtlichen Sonderstellung und aufgrund von Beispielen in anderen Städten ist auch eine eigene Siedlung anzunehmen.61
Insgesamt darf festgehalten werden, daß Speyer sowohl von den Hunneneinfällen, denen andere Städte zum Opfer fielen, als auch von den Ungarn-Raubzügen, die in Italien wüteten, verschont blieb: Die Entwicklung der Stadt konnte verhältnismäßig ruhig voranschreiten.62
f.) Die ottonische und fr Ühsalische Stadt
Vermutlich hatte die Besiedlung bereits in der karolingischen Zeit auch im Norden die spätantike Befestigung überschritten.63 Allerdings ist die genaue Ausdehnung der ottonischen Stadt noch völlig unklar64. So wäre es möglich, daß im Bereich des östlichen Teils des Domhügels - wo bislang eine Ausweitung des Siedlungsgebietes durch Aufschüttungen angenommen wurde - sogar Fläche zurückgenommen werden mußte. Auch der innere Aufbau der Stadt ist nicht gesichert; er dürfte allerdings noch stark dörflichen Charakter gehabt haben: In einigen Quellen wird die Stadt jener Zeit als vaccina, also ,,Kuhdorf" bezeichnet. Eine ähnliche Anspielung findet sich in der Lebensbeschreibung des Benno von Osnabrück65. Allerdings war der bereits angesprochene Markt eine wichtige Voraussetzung für die topografische Weiterentwicklung der Stadt.
Als wichtiger Verkehrsweg darf die römische Rheinuferstraße angenommen werden, die westlich an der Stadt vorbeizog. Zum endgültig rasenden Verlauf der Stadtentwicklung kommt es durch die Errichtung des Domes und der damit verbundenen Fürsorge durch die Salier um 1030: Bereits nach weniger als 200 Jahren war die Grundfläche der Stadt um ein Vielfaches angewachsen. Dabei vollzog sich in frühsalischer Zeit zunächst ein tiefgreifender Strukturwandel: Die Übersiedlung der Domgeistlichen in den Stift, Ausbildung und Niederlassung einer breiten bischöflichen Ministerialenschicht, Ansiedlung einer Judengruppe im Bereich Kleine Pfaffengasse: Die ursprünglich hier ansässige Bevölkerung wurde fast zwangsläufig in die neu entstehenden Außenbezirke verdrängt, in die - auch im Zuge der Dombaumaßnahmen - weitere Gewerbetreibende drängten.66
g.) Die weitere Stadtentwicklung
In der Folgezeit kommt es zu einer raschen Siedlungsausdehnung:
Unter den Saliern und Staufern wurde Speyer stark ausgebaut und hatte eine wichtige Rolle in der Reichspolitik. Speyer konnte sich 1294 von der bischöflichen Herrschaft befreien und in der Folge zur freien Reichsstadt entwickeln (bis 1797). Im 16. Jahrhundert fanden mehrere Reichstage dort statt - unter anderem die Protestation der evangelischen Reichsstände im Jahr 152967. Von 1527 bis 1688 war die Stadt Sitz des Reichskammergerichts. 1689 Zerstörung durch die Franzosen im pfälzischen Erbfolgekrieg68, der Wiederaufbau im 18. Jh. gibt der Stadt ein vorwiegend barockes Gepräge. Von 1797 war Speyer Hauptstadt des französischen Arrondisements, bevor sie 1816 an Bayern fiel und Hauptstadt des bayrischen Regierungsbezirks Pfalz wurde. Im Jahr 1923/24 war die Domstadt kurze Zeit Sitz der Seperatistenbewegung. Heute hat die kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz 48400 Einwohner.
5.) Schlußbemerkung
Die Auseinandersetzung mit der Topografie Speyers in der Zeit vor dem 11. Jh. konnte einige bisher angenommene Thesen, die durchaus auch in neueren Werken nach wie vor propagiert werden, widerlegen und ein teilweise recht deutliches Bild über die Entwicklungsschritte der Stadt zeichnen.
Es wurde dabei deutlich, daß man keinesfalls von einer ungebrochenen Entwicklung seit der Frühzeit ausgehen darf; zumindest zwischen der römischen und der merowingischen Besiedelung ist ein deutlicher Bruch erkennbar.
Speyer war von den politischen Umbrüchen seiner Zeit unterschiedlich stark betroffen - entsprechend verlief die Entwicklung der Stadtgeschichte.
Die Ausdehnung der Stadt verlief nicht in den von Sprater noch angenommenen Schritten, sondern weitaus uneinheitlicher.
Durch neue Funde, aber auch durch eine Neuinterpretation des bislang zu Tage geförderten archäologischen Gutes und eine fortschreitende Verknüpfung dieser Funde mit schriftlichen Zeugnissen scheint eine weitere Beschäftigung mit der topografischen Entwicklung ein lohnendes und aussichtsreiches Tun.
Quellenangabe
Helmut Bernhard, Speyer in der Vor- und Frühzeit, in: Wolfgang Eger (Red.), Geschichte der Stadt Speyer Bd. 1, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1982.
Helmut Bernhard, Von der Spätantike zum frühen Mittelalter in Speyer, in: Pirmin Spieß (Hg.), Palatia Historica, Mainz 1994.
Roland Berthold, Speyer - Bilder aus der Vergangenheit, Bad Honnef 1961.
Wolfgang Eger, Speyerer Straßennamen, Speyer 1985. Caspar Ehlers, Metropolis Germaniae, Göttingen 1996.
Renate Engels, Zur Topographie der Stadt Speyer vor 1689,
in: Wolfgang Eger (Red.), Geschichte der Stadt Speyer Bd. 3, Stuttgart, Berlin, Köln 1989.
Renate Engels, Zur Topografie Speyers im hohen Mittelalter, in Horst Wolfgang Böhme (Hg.), Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit Teil 2, Sigmaringen 1991.
Karl Rudolf Müller, Die Mauern der freien Reichsstadt Speyer als Rahmen der Stadtgeschichte, Speyer 1994.
Hansmartin Schwarzmaier, Von Speyer nach Rom, Sigmaringen 1991.
Franz Staab, Speyer im Frankenreich, in: Wolfgang Eger (Red.), Geschichte der Stadt Speyer Bd. 1, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1982.
Stadt Speyer (Hg.), Unter dem Pflaster von Speyer, Speyer 1989.
[...]
1 Cüppers, Römer 557f.
2 Die gravierenden Änderungen, die der Rheinlauf teilweise in stetiger Manier, teilweise aber auch in dramatischen Wechseln des Zopfmusters genommen hat, dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn der Hauptarm ein neues, von den vorhergehenden Hochwassern vorbereitetes Bett einnahm, konnte es vorkommen, daß sich eine Stadt nach dem Ablauf eines Hochwassers plötzlich auf der anderen Rheinseite befand. Das war für Speyer durch die Lage am Rand des Hochufers selbstverständlich ausgeschlossen, trifft aber auf andere Gebiete durchaus zu und soll die Kraft, die in diesem Fluß steckte, veranschaulichen. Müller 77.
3 Müller 86.
4 Bernhard, Speyer 15.
5 Ebd. 17.
6 Ein Brunnen hätte auf dem Hochufer mit etwa 14 m doppelt so tief sein müssen, als auf der Niederterrasse. Müller 86.
7 Engels, Topographie im hohen Mittelalter 153.
8 Der sogenannte ,,Binsfeld-Fund". Bernhard, Speyer 17.
9 Ebd. 19.
10 Ebd. 27f.
11 Ebd. 30.
12 Cüppers, Römer 558f.
13 Ebd. 559. Ähnlich sieht es auch Bernhard, Speyer 31: Ein später Grabfund (Nekropole in der Johannesstraße) zeigt, daß die Kelten nicht schon in den Wirren um 50 v. Chr. abgewandert sind, wie dies ansonsten in der Vorderpfalz üblich war, sondern eventuell sogar bis zur Ankunft der Römer blieben.
14 Bernhard, Speyer 31.
15 Friedrich Sprater konnte diese laut Cüppers, Römer 559, 1927 machen (Kleine Pfaffengasse).
16 Bernhard, Speyer 33: Die Funde Spraters konnten durch neuerliche Grabungen 1977 (Alter Markt) bestätigt werden. Die Annahme, daß eine massive Befestigung der Rheinlinie unter Drusus mit 50 Kastellen vorgenommen worden sei, ist dennoch wenig stichhaltig. Die Zahl bezieht sich nach neuen Erkenntnissen auf das gesamte Siedlungsgebiet vom gallischen Hinterland bis zur Elbe.
17 Bernhard, Speyer 39f.
18 Gaius Octavius bzw. Gaius Iulius Cäsar Octavianus auch Oktavian regierte als römischer Kaiser bis zu seinem Tod im Jahr 14 n. Chr. Für die Errichtung bereits im Jahr 9 n. Chr. spricht in diesem Zusammenhang, daß Augustus, nachdem er bis dahin das Römische Reich mit dem Ziel, natürliche Grenzen und gesicherte Verbindungswege zu erreichen, beträchtlich ausgedehnt und abgerundet hatte, nach der Niederlage des Varus im Teutoburger Wald in eben diesem Jahr zunächst gezwungen war, die rechtsrheinischen Gebiete aufzugeben; der Sicherung der Rheingrenze fiel in dieser Zeit wachsende Bedeutung zu.
19 Cüppers, Römer 559, ebenso Bernhard, Speyer 41.
20 Lateinisch Dorf, Gehöft.
21 Bernhard, Speyer 42. Funde aus dem Jahr 1977 (Städtisches Krankenhaus) belegen diese Annahme.
22 Cüppers, Römer 560. Diese Funde werden auf die Zeit um 15 n. Chr. datiert, allerdings wurde der Platz bereits zehn bis fünfzehn Jahre später wieder freigestellt.
23 Das Forum wurde allerdings erst bei einer Bauveränderung um 30 n. Chr. im westlichen Vicus errichtet.
24 Laut Bernhard, Speyer 45 habe Sprater angenommen, daß dieses dritte Lager errichtet wurde, weil Lager B vom seinen Lauf ändernden Rhein unterspült worden sei. Dafür sind allerdings keine Belege vorhanden und aus diesem Grund durchaus auch andere Gründe denkbar.
25 Tiberius Caesar Augustus regierte seit Augustus Tod im Jahr 14 n. Chr. bis zu seinem eigenen Ableben im Jahre 37 n. Chr. als römischer Kaiser. Bernhard schlägt in Speyer 46 die Zeit zwischen 30 und 35 n. Chr. Zeit der Lagerverlegung vor.
26 Bernhard, Speyer 46.
27 Beginnt mit der Kaiserkrönung Vespasians im Jahre 69 n. Chr. und endet mit Kaiser Domitians Ermordung 96 n.Chr. (1. flavische Dynastie). Die 2. flavische Dynastie reichte von Kaiser Konstantin I. (306) bis Kaiser Julian (363).
28 Bernhard, Speyer 48.
29 Ebd. 50.
30 Bernhard, Speyer 51.
31 213 n. Chr. traten erstmals die Alamannen, ein Verband verschiedener elbgermansicher Stämme, als Hauptgegner in Erscheinung. Immer wieder organisierten diese Einfälle, die schließlich im Jahr 450 n. Chr. die römische Präsenz am Oberrhein beendeten. Bereits 259/260 n. Chr. ging das gesamte Limesgebiet bis zum Rhein verloren.
32 Bernhard, Speyer 52.
33 Ebd. 63.
34 Lucius Domitius Aurelianus, *)in Dakien oder Sirmium (Pannonien, heute Sremska Mitrovica) 214, _)bei Byzanz 275 (ermordet), römischer Kaiser (seit 270). Anfängliche Niederlagen gegen die Germanen führten zur Aufgabe Dakiens und veranlaßten die Befestigung Roms durch die Aurelianische Mauer. 272 Zerschlagung des Reichs von Palmyra.
35 Bernhard, Speyer 120.
36 Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, *)in Dalmatien um 240, _)Salona = Solin bei Split) 313/316, römischer Kaiser (284-305). Suchte das Reich zu stabilisieren; u.a.: 293 Bildung der Tetrarchie; Steuer-, Münz-, Heeres-, Verwaltungsreform (Teilung der Provinzen); Festsetzung von Höchstpreisen; Verbot des Christentums (303); dankte 305 ab.
37 Bernhard, Speyer 120f. Ders. belegt in Spätantike 9, daß insbesondere die westlichen Bezirke nicht mehr aufgebaut wurden.
38 Bernhard, Speyer 121.
39 Diese Straßensiedlung bestand beidseits der wiederhergestellten römischen Hauptstraße. Bernhard, Speyer 124.
40 Magnentius , Flavius Magnus, *)wohl Ambianum (heute Amiens) um 303, _)Lugdunum (heute Lyon) 353 (Selbstmord), röm. Gegenkaiser (seit 350). Von britisch-fränkischer Herkunft; riß die westliche Reichshälfte und Illyrien an sich (Ermordung Konstans' I.); von Konstantius II. 351 bei Mursa besiegt.
41 Flavius Claudius Julianus, *)Konstantinopel 331, _)Maranga am Tigris 363, römischer Kaiser (360 Augustus, 361 Alleinherrscher). 355 Caesar; in Gallien Konsolidierung der Ostgrenze; führte 363 den Perserkrieg fort, fiel auf dem Rückzug. Philosophisch hochgebildet, verlor früh den christlichen Glauben (Beiname Apostata,,Abtrünniger") und wurde Anhänger der neuplatonischen Lehre, die er zu einer neuen Reichsreligion umzugestalten suchte.
42 Bernhard, Speyer 127.
43 Flavius Valentinianus, *)Cibalae (heute Vinkovci) 321, _)Brigetio (Pannonien) 375, Kaiser (seit 364). Ernannte seinen Bruder Valens und 367 seinen Sohn Gratian zu Augusti; kämpfte als Kaiser des westlichen Reichsteils ab 365 u.a. erfolgreich gegen die Alamannen; sicherte 368-370 die Grenzen Britanniens.
44 Eine etwa 2,5 m dicke Wehrmauer konnte bei Grabungen 1967 nachgewiesen werden. Bernhard, Speyer 128f.
45 Im Gegensatz zur Darstellung des Heiligen Hieronymus aus dem Jahr 409 in einem Brief an Ageruchiam, in dem er behauptete, die Städte am Rhein, darunter auch Speyer, seien durch den Feind vernichtet worden. Hieronymus war kein Augenzeuge und saß 406 in Betlehem, weshalb man von einer gehörigen Übertreibung ausgehen muß.
46 Bernhard, Speyer 136.
47 Der Alamannensieg Chlodwigs von 496/497 bei Zülpich ist umstritten, daß die rheinischen
Städte aber spätestens bei der Alamannenniederlage 506 an Chlodwig fielen aber sicher.
48 Allerdings weist Staab 169ff. darauf hin, daß Speyer offenbar unter dem starken Einfluß der angesiedelten Barbaren nicht mehr an der Spätblüte des römischen Reiches teilhaben konnte; erst nachdem Chlodwig, der dem katholischen Glauben beigetreten war - was selbstverständlich auch der durch die Alamannen unterdrückten Christianisierung der Gegend um Speyer Vorschub leistete -, die Herrschaft übernommen hatte, konnte Speyer wieder prosperieren und auch kulturell den Anschluß wieder erlangen.
49 Bernhard, Speyer 143f. Staab 173 nennt als erste Datierung für die Bezeichnung Spira gar die Zeit um 496/506; er weist darauf hin, daß es für die Merowinger gerade ein Problem gewesen sei, daß sie aufgrund dieser frühen Umbenennung nicht mehr nahtlos an die alten römischen Traditionen anknüpfen konnten.
50 Dieser wurde durch die Rheinstraße, den Anschluß an die Straßen Worms-Metz-Verdun- Reims und Bingen-Trier- Reims und fünf Rheinfähren erschlossen. Staab 172.
51 Staab 174.
52 Die Zahlen sind strittig: In der älteren Geschichtsschreibung findet man die Datierung aus dem 7. Jahrhundert, es taucht allerdings bereits um 614 ein gewisser Bischof Hilderich von Speyer auf, der am Pariser Nationalkonzil teilnahm und nach neuesten Erkenntnissen der vierte Speyerer Bischof nach Jesse, Anatharius und Taito war. Staab 176ff. Der Datierung auf 614 schließt sich auch Engels in Topographie vor 1689 494 an.
53 Engels, Topographie vor 1689 495.
54 St. Stephan lag wohl vor der älteren Stadtmauer und kann so nicht der Bischofsdom gewesen sein. Vielmehr dürfte in dieser Kirche ein Friedhofsbasilika für die gefundenen fränkischen und spätrömischen Gräber, wegen der engen liturgischen Verbindung zum Dom, die sich nachweisen läßt, eventuell sogar als bischöfliche Grablege angesehen werden. Staab 177.
55 Staab 209. Engels, Topographie vor 1689 496 - übrigens die neuere Literatur - widerspricht dem vehement: Die Lage der Stephanskirche sei keinesfalls geklärt.
56 Staab 209.
57 Staab 206.
58 Staab geht sogar davon aus, daß in Speyer ein ganz beachtlicher Reichtum bestand. Staab 208.
59 Engels, Topographie vor 1689 495.
60 Zu diesem Datum gibt Konrad der Rote dem Bischof eine ganze Reihe von Rechten und Besitzungen in die Hand. Eine entsprechend gelungene Übersetzung der Urkunde findet sich in Schwarzmaier 20f. Diese Urkunde läßt uns noch einiges Interessantes über das Speyer der damaligen Zeit erfahren: Es gab eine Schiffsläde und einen Stapelplatz am Rhein, Kaufleute von Außerhalb schlugen hier ihre Waren um, wobei Wein eine wichtige Rolle spielte. Die Urkunde läßt vermuten, daß der Handel blühte.
61 Engels, Topographie vor 1689 496. Die Lage ist allerdings nicht geklärt.
62 Staab 213.
63 Engels, Topographie vor 1689 497. Die Aufgabe oder Vernachlässigung von Festungsmauern war zunächst durchaus üblich und wurde erst in spätkarolingischer und frühottonischer Zeit durch das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Menschen von einer neuen Bauwelle abgelöst.
64 Engels merkt in Topographie im hohen Mittelalter 154 an, daß zwar die Lage der Mauern durch L.A. Doll nach Norden, Westen und Süden hinreichend gesichert, die Ausdehnung nach Osten dagegen vollkommen offen ist.
65 Engels merkt in Topographie im hohen Mittelalter 154 allerdings richtig an, daß diese Aussage aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ganz objektiv sein konnte, weil sie vorrangig der Herausstellung der Leistungen in der Salierzeit gedient hat. Dennoch ist sie - betrachtet man die relative geringe Bedeutung der Stadt in vorsalischer Zeit - mehr als nur eine topische Wendung.
66 Engels, Topographie vor 1689 500.
67 Einspruch der evangelischen Reichsstände gegen den Beschluß der altkirchlichen Mehrheit auf dem Reichstag von Speyer, am Wormser Edikt von 1521 festzuhalten. Der Reichstagsabschied setzte sich über die Protestation hinweg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit über die Geschichte Speyers?
Gegenstand dieser Arbeit soll ein Aufriß über die Entwicklung der Stadt Speyer bis zur Bestimmung zur Kaisergrablege durch die Salier sein. Dabei sollen vorrangig die topografischen Vorgänge und Prozesse betrachtet werden, wenngleich man dabei um eine generellere Sicht auf die historischen Entwicklungen selbstverständlich nicht umhin kommt.
Wann beginnt die Beschäftigung mit antiken Funden im Speyerer Boden?
Bereits um 1500 setzt die Beschäftigung mit antiken Funden im Speyerer Boden ein.
Welche geographischen Gegebenheiten prägen die Lage Speyers?
Die Lage der Stadt Speyer wird auch heute charakterisiert von einem weit vorgeschobenen erhöhten Sporn, einer Niederterrasse, die durch die sich ändernde Strömung des Rheins entstanden ist. Diese Formation bot zu allen Zeiten einen relativ guten Schutz vor Hochwassern.
Welche archäologischen Funde belegen die Siedlungsentwicklung vor 10 v. Chr. im Raum Speyer?
Erste Funde aus dem Gebiet um Speyer stammen aus dem Jungpaläolithikum. Eine Abfallgrube aus der älteren Eisenzeit belegt eine Siedlung, die spätestens im 4. und 3. Jh. v. Chr. in eine keltische Siedlung überging.
Was bedeutet der Name "Noviomagus"?
Die Bezeichnung Noviomagus war ein keltischer Begriff, der übersetzt ,,Neufeld" bedeutet.
Welche Rolle spielte Speyer in der Römerzeit?
In der Okkupationsphase der Römer (um 10 v. Chr.) sollte lediglich eine Straßenverbindung von Basel nach Mainz gesichert werden. Später entstanden Militärlager (Lager A, B, C) und ein Vicus (Dorf) in der Nähe.
Was geschah mit Noviomagus nach dem Abzug der Militärs im Jahr 74 n. Chr.?
Nach dem Abzug der Militärs blieb eine etwa 3ha große Fläche frei, die rasch besiedelt wurde. Es entstand eine große Straße als Hauptachse, und Noviomagus entwickelte sich zu einer kleinstädtischen Metropole.
Welche Zerstörungen erlebte Speyer im 3. Jahrhundert n. Chr.?
Der Germaneneinfall 275 n. Chr. führte zu einer verheerenden, nahezu vollständigen Zerstörung der Stadt.
Wie erfolgte der Wiederaufstieg von Noviomagus unter Diokletian?
Noch vor 300 n. Chr. wurde zumindest um die Hauptstraße mit dem Wiederaufbau begonnen, zu Beginn des 4. Jahrhunderts blühte die Stadt bereits wieder auf.
Welche Bedeutung hatte Magnentius für Speyer?
Das Gebiet des heutigen Speyer fiel 352 n. Chr. nach der Ursurpation des weströmischen Kaiserthrons durch Magnentius in die Hände der Alamannen.
Wie wurde Noviomagus zur Festung Nemetae?
Ab 368 n. Chr. baute Valentinian I. zum Schutz des Reiches Festungen, Wachtürme und Schiffsländen an Rhein und Donau, wodurch Speyer (nun unter dem Namen Nemetae) zum Garnisonsort wurde.
Welche Rolle spielte die "Villa Spira" in der Merowingerzeit?
Um das Jahr 500 kam es zu germanischen Besiedlungen, wie die "Villa Spira" (Altspeyer), die als Siedlung bis heute an gleicher Stelle im Norden Speyers erhalten blieb.
Welche Veränderungen brachten die Merowinger für Speyer?
Durch die Übernahme der Herrschaft durch die Merowinger entstand nicht nur neue militärische Sicherheit, sondern auch eine Wiederherstellung des Handelsraumes für Speyer. Auch die Verwaltungsstruktur, die die Merowinger einführten, machte Speyer wieder zu einem Zentrum seiner Region.
Wann wurde die Diözese Speyer wiederbegründet?
Frühestens in der Mitte des 6., eventuell aber auch erst in der Zeit zwischen 623 und 639 kommt es zur Wiederbegründung der Diözese Speyer.
Welche Bedeutung hatte die Kirche für die Entwicklung Speyers?
Die Kirche hatte einen beschleunigenden Einfluß auf die Speyerer Entwicklung, symbolisiert durch das Adelskloster St. German an der Stelle des Merkurtempels.
Was geschah mit Speyer unter den Karolingern?
Im 8. und 9. Jahrhundert steht den ursprünglich umfangreichen Besitzungen des Bischofs von Speyer eine auffällige Bedeutungslosigkeit gegenüber. Kein merowingischer oder karolingischer König hielt sich länger in der Stadt auf.
Wie entwickelte sich die Stadt in ottonischer und frühsalischer Zeit?
Vermutlich hatte die Besiedlung bereits in der karolingischen Zeit auch im Norden die spätantike Befestigung überschritten. Der Markt war eine wichtige Voraussetzung für die topografische Weiterentwicklung der Stadt. Die Errichtung des Domes und die Fürsorge durch die Salier um 1030 beschleunigten die Entwicklung weiter.
- Arbeit zitieren
- Matthias H. Werner (Autor:in), 1997, Die Topographie Speyers in der Vorsalierzeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95144