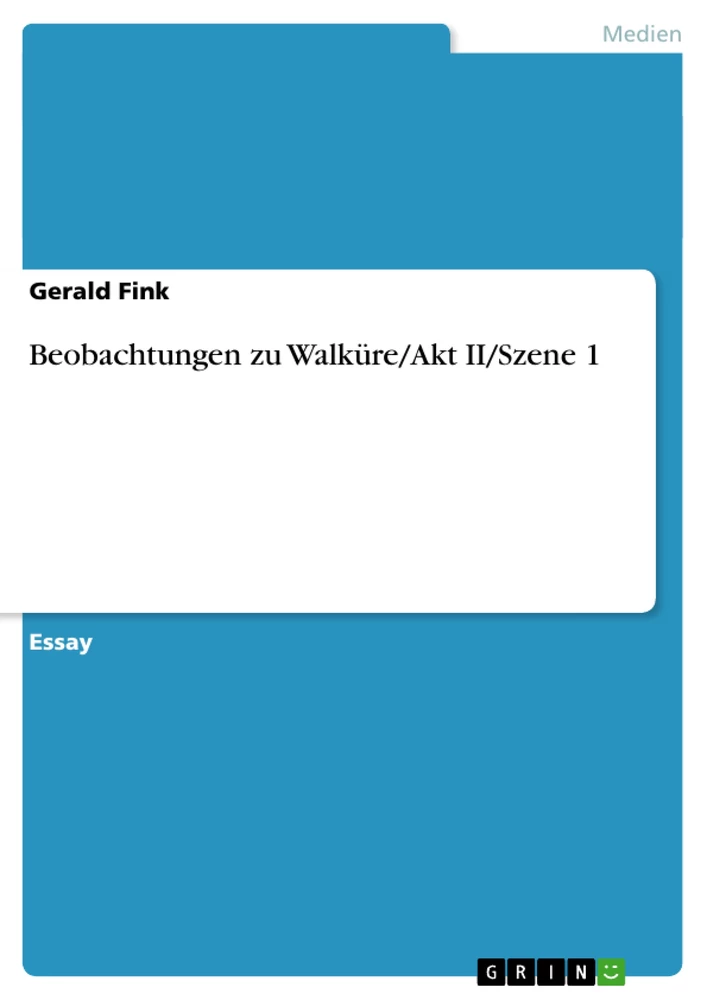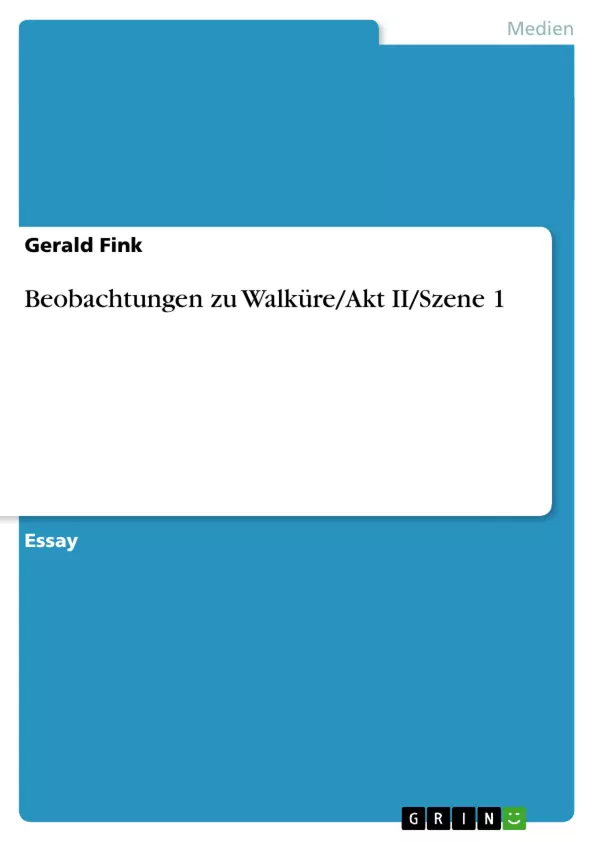Beobachtungen zum Beginn des zweiten Aufzuges der ,,Walküre" von Richard Wagner
Der Auftritt Wotans nach dem Vorspiel zum zweiten Aufzug zeigt ebenso wie der sich direkt anschließende Auftritt Brünnhildes mit seiner (für den Ring wohl einmaligen) ABA-Form ein gewisses Maß an ,,Geschlossenheit" im herkömmlichen kompositionstechnischen Sinn. Die Überschaubarkeit der Partien bietet zusätzlich an, gerade hier nach Prinzipien und Einzelheiten der Gestaltung zu fahnden, die die Konvention erfüllen oder aber brechen.
1. Wotans 18-taktiger Gesang wird von Akkorden gestützt, die die dynamisch vorwärtseilende Einleitungsmusik zügeln. Gemeinsam mit den eingeschobenen Skalenläufen erhält dieser Teil (wollte man nach einer klassischen Form suchen) den Charakter eines Accompagnato- Rezitativs.
Die Tonart d-moll ist deutlich befestigt. Die T. 1-4 zerfallen in ,,Vorder-und Nachsatz"(funktions-harmonisch endend auf s bzw. D-t). Die folgenden vier Takte rücken zweimal um einen Ganzton auf E7 und Fis7, dann wird über e-moll und den neapolitanischen Sextakkord im T. 15 die Ausgangstonika erreicht. An diesen tonal geschlossenen Komplex schließt sich die Ganztonrückung (aus T. 6-9 bekannt) an, die zum h-moll des ,,Hojotoho" hinüberleitet. Dem harmonischen Verlauf entspricht eine Gesangsführung, die diesen in ihrer Diastematik getreulich nachzeichnet und aus leitereigenen Dreiklangsbrechungen und Skalengängen gebildet ist.
Metrisch ist der Abschnitt in - oft zwei- bzw. viertaktige - Phrasen gegliedert, die primär musikalisch (und nicht textlich) motiviert erscheinen. Der Rhythmus fügt sich ganz dem 6/8- Schema.
2. Die Vorzeichnung nach h-moll und die sich ändernde Taktangabe einen neuen Abschnitt. Verschränkt mit Wotans letztem Wort ,,Wal" wird die dynamische Bewegung durch das Orchester wieder aufgenommen, der g´´- fis´´- Triller und die rasanten ZweiunddreißgstelPassagen der Bläser lassen hier aber ein sehr ,,flirrendes" Klangbild (im Bedeutungsfeld ,,unstet-unbestimmt") entstehen. Eine harmonische Deutung dieser beiden Takte als D scheint naheliegend, die Auflösung bleibt aber vorenthalten, da
3. Brünnhildes Auftritt mit einem auf dem übermäßigen G-Klang gesungenen ,,Hojotoho"-Ruf anhebt.
a) Mögliche funktionale Deutungen (s7 + oder [D [6]] S) scheinen den Charakter des Akkordes nur unzureichend zu treffen. Er hat in seinem Für-sich-Stehen eher Signalwert (die Person der Walküre anzeigend) und bedürfte ebensowenig der korrekten Auflösung wie der vorherige ,,flirrende" Trillerklang. Die Fortführung nach E-Dur in T. 3 der Brünnhilde-Passage ist m.E. weniger als Dominant-Tonikaverhältnis zu erklären; entscheidender sind eher die Halbtonbeziehungen dis-e und g-gis.
b) Einer funktionsharmonischen Deutung steht ein gewisses Changieren auch der übrigen Akkordfelder im Wege: Eine mediantische Erklärung der Wendung T. 3/4 (entsprechendes gilt für 7/8) erfaßt nicht das Wesen der Stelle, da die zu dieser Deutung notwendigen und die Gesangstimme zum C-Dur-Dreiklang ergänzenden Töne der Instrumente genau betrachtet nicht mehr als den Beginn einer chromatischen Quartsextakkord-Skala darstellen, an deren Ende wiederum der E-Dur-Klang steht.
c) Dieser wird im T. 5 (=6) nach F-Dur gerückt, das wiederum im Halbtonverhältnis zu T. 7 (bzw. Tritonusverhältnis C-Dur - Fis-Dur) steht. Für T. 7/8 siehe b).
d) T. 9/10 (zu T. 8 wiederum im Abstand der kleinen Sekund) wiederholen die beiden ersten Takte, emphatisch noch gesteigert. Die Fortführung zu T. 11 beinhaltet erneut zwei Halbtonschritte, diesmal aber dis-e und h-c.
e) Die Tritonusrückung nach Fis-Dur (vgl. c) bringt einen zweitaktigen klaren Dominantakkord, der das ausgeschriebene Tremolo der ,,Zwischentakte" (s. 2.) aufnimmt, durch einen Triller der Gesangsstimme ergänzt und mit einem deutlichen Grundton in den Bässen auf festen funktionalen Boden stellt.
f) Die Auflösung in die Tonika ist die erste ,,korrekte" in der Brünnhilden-Passage und schafft auch eine 16-taktigkeit, deren gezirkelter Aufbau schon allein durch die Aufnahme des Anfangsmotivs im T. 9 evident ist.
g) Nicht unwichtiger werden dadurch freilich die drei Schlußtakte (beim ,,Da-capo" sind es zwei), die mit der Dur-Variante der Tonika wieder Halbton-Beziehungen ins Spiel bringen, vor allem in den einzelnen Tönen der über zwei Oktaven hinabsteigenden Skalen.
Häufig gestellte Fragen zu Beobachtungen zum Beginn des zweiten Aufzuges der ,,Walküre" von Richard Wagner
Worum geht es in diesem Text?
Der Text analysiert den Beginn des zweiten Aufzugs der ,,Walküre" von Richard Wagner, insbesondere den Auftritt Wotans und Brünnhildes, hinsichtlich kompositionstechnischer Merkmale, die Konventionen erfüllen oder brechen.
Wie wird Wotans Auftritt beschrieben?
Wotans 18-taktiger Gesang wird als eine Art Accompagnato-Rezitativ beschrieben, gestützt von Akkorden, die die dynamische Einleitung zügeln. Die Tonart d-moll ist deutlich befestigt, wobei es zu Modulationen und Ganztonrückungen kommt. Die Gesangsführung folgt den harmonischen Wendungen und besteht aus Dreiklangsbrechungen und Skalengängen. Der Abschnitt ist in zwei- bzw. viertaktige Phrasen gegliedert.
Wie wird Brünnhildes Auftritt analysiert?
Brünnhildes Auftritt beginnt mit einem ,,Hojotoho"-Ruf auf einem übermäßigen G-Klang. Der Text diskutiert die funktionale Deutung dieses Akkords und argumentiert, dass er eher Signalwert hat. Es wird auf die Halbtonbeziehungen und das Changieren der Akkordfelder hingewiesen. Es wird auch die Bedeutung der Tritonusrückung nach Fis-Dur hervorgehoben. Die Analyse betont die 16-taktigkeit des Abschnitts und die abschließenden Halbton-Beziehungen.
Was wird über die harmonische Deutung gesagt?
Der Text argumentiert, dass eine rein funktionsharmonische Deutung einiger Passagen unzureichend ist, da bestimmte Akkorde und Wendungen eher Signalwert haben oder auf Halbtonbeziehungen basieren als auf klassischen Dominant-Tonika-Verhältnissen. Das Changieren der Akkordfelder wird als ein Hindernis für eine rein funktionsharmonische Erklärung angeführt.
Welche Rolle spielen Halbtonbeziehungen?
Halbtonbeziehungen werden als ein wichtiges Element der musikalischen Gestaltung hervorgehoben, insbesondere in Brünnhildes Auftritt. Sie treten in verschiedenen Akkordverbindungen und in den Skalen der Schlußtakte auf.
Welche Bedeutung hat der übermäßige G-Klang zu Beginn von Brünnhildes Auftritt?
Der übermäßige G-Klang wird nicht nur als harmonische Funktion betrachtet, sondern auch als Signal, der die Walküre (Brünnhilde) ankündigt. Seine Auflösung wird als weniger wichtig angesehen als seine Signalwirkung.
Welche Besonderheiten werden bezüglich der Taktarten erwähnt?
Nach Wotans erstem Abschnitt, der mit einem 6/8-Schema konform geht, ändert sich die Taktangabe zu Beginn von Brünnhildes Auftritt. Dies markiert einen neuen Abschnitt und geht einher mit einer dynamischen Bewegung im Orchester.
Was wird über Tremolo und Triller gesagt?
Das ausgeschriebene Tremolo in den ,,Zwischentakten" wird durch einen Triller der Gesangsstimme in Brünnhildes Auftritt ergänzt, was zur dynamischen und klanglichen Gestaltung beiträgt.
- Quote paper
- Gerald Fink (Author), 1997, Beobachtungen zu Walküre/Akt II/Szene 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94939