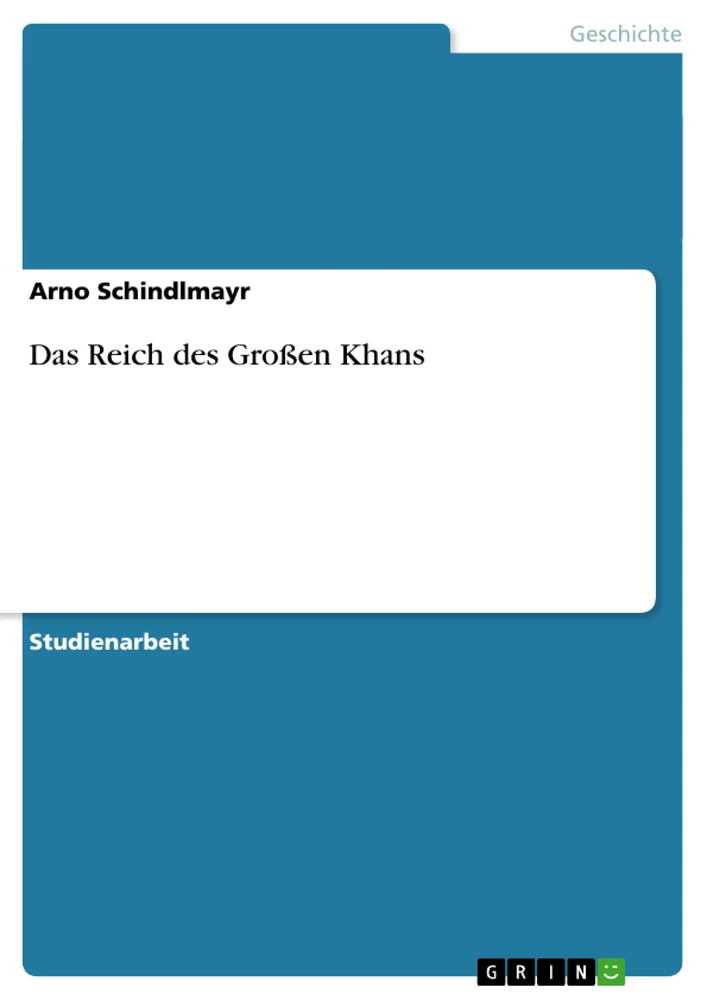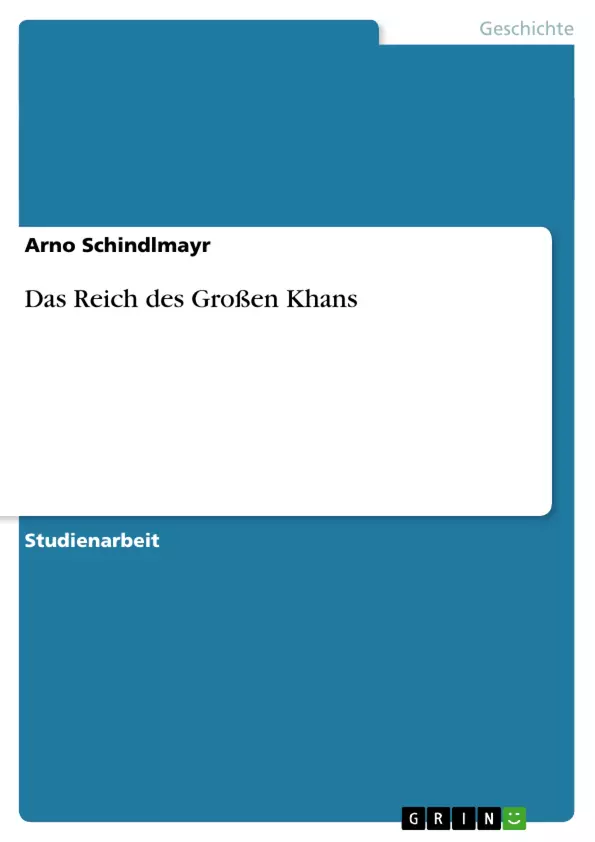Autor: Arno Schindlmayr
Der Mongoleneinfall des 13. Jahrhunderts konfrontierte das Abendland zum erstenmal seit dem Vorstoß Alexanders des Großen nach Indien 1500 Jahre zuvor wieder direkt mit den Völkern Asiens und stellt damit einen bedeutenden Einschnitt in der geistesgeschichtlichen Entwicklung Europas dar. War die Beschäftigung mit dem Fremden in Gestalt der Mongolen zunächst ganz der biblisch geprägten Vorstellungswelt verhaftet, erzwang der unmittelbare Kontakt eine zunehmende Entmythologisierung, die in den Reisebeschreibungen Marco Polos ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Damit deutete sich erstmals jener Umbruch des mittelalterlichen Weltbilds an, der später das sogenannte Zeitalter der Entdeckungen einläutete. Auf der anderen Seite lassen das Verkennen der Gefahr und die Voreingenommenheit, mit der das Abendland diesem Eindringen feindlich gesinnter Völker lange begegnete, umgekehrt auch die Haltung der amerikanischen Indianer gegenüber den europäischen Eroberern verständlicher erscheinen.
Vorgeplänkel
Die überlieferte Geschichte der Mongolen beginnt mit dem Aufstieg Tschingis Khans*, der die nomadischen Völker im Gebiet der heutigen Mongolei erstmals einigte und unter Auflösung ihrer traditionellen Stammesstrukturen zu einer gewaltigen Militärmacht verschmolz. Seiner Ausrufung zum Großkhan im Jahr 1206 folgten schon bald erste Vorstöße in die umliegenden Länder, auf denen weite Gebiete Zentralasiens sowie Nordchinas geplündert und tributpflichtig gemacht wurden. Die innere Konsolidierung der unterworfenen Regionen sollte ebenso wie die Konzentration auf die weitere Expansion in China durch ein Abkommen mit Persien, bis zu dessen Grenzen Tschingis Khans Imperium bereits angewachsen war, gewährleistet werden. Dieses Abkommen brach jedoch als Folge der Hinrichtung einer Gruppe mongolischer Händler unter dem (vermutlich durchaus korrekten) Vorwurf der Spionage schnell zusammen, so daß eine Stammesversammlung schließlich die Aussendung einer militärischen Strafexpedition beschloß, die im Jahr 1219 begann.
Die disziplinierten und durch die nomadische Lebensweise bestens ausgebildeten mongolischen Reiterheere zählten zweifellos zu den hervorragendsten Streitmächten ihrer Zeit. Vor allem die rationale, grausame Behandlung ihrer Gegner sorgte jedoch dafür, daß ihnen wie später beim Einfall in Europa bald Angst und Schrecken vorauseilten. Während die Mongolen Siedlungen, die sich freiwillig unterwarfen, lediglich plünderten und tributpflichtig machten, wurden andere Städte dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung gleichsam entweder massakriert oder zwangsweise an vorderster Front in das weiterziehende Heer eingegliedert. Die in zeitgenössischen persischen Chroniken genannte Zahl von mehreren Millionen Toten wird realistisch, wenn die Folgen zerstörter Ernten und der Verwüstung des Bewässerungssystems, das viele Regionen erst landwirtschaftlich nutzbar machte, mitberücksichtigt werden. Der Schah, dem es nicht gelang, seine Armee gegen den mongolischen Vormarsch zu mobilisieren, floh und rettete sich auf eine Insel im Kaspischen Meer. Während Tschingis Khan selbst nach der Eingliederung Persiens in das Imperium und der Einsetzung örtlicher Vizekönige wieder in die Mongolei zurückkehrte, nahm ein Teilheer unter dem Kommando seines Generals Sübodei die Verfolgung des geflohenen Schahs auf und zog weiter nach Westen. Damit erreichten mongolische Verbände erstmals die Grenzen des abendländischen Kulturraums.
Erste Berührung und Legendenbildung
Zur gleichen Zeit, als der mongolische Vormarsch nach Persien begann, hatte ein unter der Führung des päpstlichen Legaten Pelagius stehendes Kreuzfahrerheer mit Damiette einen ersten Stützpunkt in Ägypten erobert. Uneinigkeit über die Verteilung der Beute sowie über die weitere Strategie führten jedoch schnell zu einer zunehmenden Demoralisierung, bis in dieser Situation im Kreuzfahrerlager verschiedene Prophezeiungen bekannt wurden, die vom bevorstehenden Ende des Islam und der Befreiung Jerusalems durch zwei Könige, je einer aus dem Orient und dem Okzident, kündigten. Während diese Prophezeiungen noch nicht mit dem mongolischen Vormarsch in Zusammenhang standen, verbreitete sich bald schon die Kunde von der Unterwerfung Persiens durch ein von Osten heranrückendes Heer. Entscheidend für die weiteren Ereignisse war dabei jedoch, daß dessen Natur völlig verkannt wurde und die Berichte als Heerführer die Gestalt eines christlichen Königs David benannten, dessen Ziel die Vernichtung des Islam und die Bekehrung der Ungläubigen sei. Natürlich verband sich dieser Bericht sehr schnell mit den vorher verkündeten Prophezeiungen, so daß an der Identifikation Tschingis Khans mit dem vorhergesagten, aus dem Orient erscheinenden Christenkönig, die zusätzliche Glaubwürdigkeit noch aus der weitverbreiteten Legende vom Priesterkönig Johannes bezog, bald kein Zweifel mehr bestand. Diese unmittelbare Einbindung in ein enges Netz von Weissagungen und Wunschvorstellungen macht es verständlich, daß alle alarmierenden Zeichen wie die später bekanntgewordene große Zahl der Ungläubigen in dem heranrückenden Heer oder die Unterwerfung des christlichen Georgiens ignoriert wurden. Im Vertrauen auf den sich entwickelnden Plan Gottes schlug Pelagius gar ein Friedensangebot des sich nun von zwei Seiten bedroht sehenden ägyptischen Sultans aus und befahl den Angriff auf Kairo, der jedoch auf katastrophale Weise in der Nilschwemme endete und schließlich zum vollständigen Rückzug der Kreuzfahrer führte.
Zur großen Verwunderung des Abendlands wandte sich jedoch auch die Streitmacht des angeblichen Königs David von Jerusalem ab und zog stattdessen nördlich durch den Kaukasus ins Wolgagebiet, wo die Mongolen 1223 an der Kalka ein gemeinsames Heer der nomadischen Kumanen und der zu Hilfe gerufenen Russen vernichteten. Diese Niederlage sowie die darauf folgenden Plünderungen ließen jenseits der katholisch-orthodoxen Glaubensgrenze ein gänzlich anderes Mongolenbild entstehen, dem freilich ein ebenso biblisches Weltbild zugrundelag: Ausgehend vom Buch der Richter des Alten Testaments wurden die Mongolen hier mit den von Gideon vertriebenen Midianitern identifiziert, die einer russischen Tradition zufolge von Alexander dem Großen noch einmal besiegt und hinter den Kaspischen Bergen eingeschlossen wurden, um am Ende aller Zeiten erneut hervorzubrechen und zum Endkampf gegen die Christenheit anzutreten. Die so erfolgte erste Verbindung mit den biblischen Endzeitvölkern schlug sich auch in der bald überall verbreiteten Bezeichnung "Tartaren" nieder, die sich vom Teilstamm der Tataren ableitet und die Mongolen als Heerscharen der Hölle (griech. Tartaros) charakterisiert. Das Auftauchen Tschingis Khans wurde somit als göttliche Mahnung vor dem bevorstehenden Weltende verstanden, der folgende Rückmarsch in die Mongolei als Gottes Annahme eines erneuerten christlichen Gelöbnisses. Diese Interpretation führte zwangsläufig zu einer folgenreichen Verharmlosung der drohenden Gefahr aus den asiatischen Steppen.
In den katholischen Ländern Westeuropas ließen selbst diese neuen Ereignisse immer noch keine Zweifel an der Integrität des angeblichen König Davids aufkommen, da man die Russen als Orthodoxe ja ebenfalls zu den nicht rechtgläubigen Völkern zählte, deren Bestrafung damit genauso ihre Erklärung fand wie die der Georgier zuvor. Der trotz päpstlicher Intervention und seiner Exkommunizierung erfolgreiche Kreuzzug des deutschen Stauferkaisers Friedrich II sowie die auf die Einnahme Jerusalems folgende Annäherung mit den Ostkirchen trugen weiter zu einer Welle des Optimismus bei, so daß auch hier keinerlei militärische Vorbereitungen für eine mögliche neue Angriffswelle der Mongolen getroffen wurden.
Die Schreckenszeit
In der fernen Mongolei war Tschingis Khan im Jahr 1227 an den Folgen eines Jagdunfalls gestorben. Seinem Willen entsprechend wurde das Reich nach mongolischer Steppetradition so unter seinen vier Söhnen aufgeteilt, daß der jüngste das Stammland und der älteste die am weitesten entfernt liegenden Gebiete "so weit sie Hufe mongolischer Pferde betreten hatten" zugesprochen bekam. Tschingis Khans dritter Sohn, Ögädei, wurde außerdem als Großkhan zum Nachfolger seines Vaters bestimmt. Nachdem unter Ögädei Khans Herrschaft zunächst die Eroberung des nordchinesischen Kin-Reiches abgeschlossen und die innere Konsolidierung des mongolischen Imperiums durch die Gründung einer Hauptstadt, Karakorum, vorangetrieben worden war, beschloß eine Stammesversammlung, nun die dem ältestem Sohn zugesprochenen und nach dessen Tod an Tschingis Khans Enkel Batu gefallenen Gebiete auch tatsächlich militärisch in Besitz zu nehmen. So setzte sich im Jahr 1237 unter dem Kommando Batus und des Veteranen Sübodei erneut ein gewaltiges mongolisches Heer nach Westen in Bewegung.
Die ersten Informationen über den bevorstehenden Angriff wurden dem Abendland durch die vom ungarischen König Bela IV ins Wolgagebiet ausgesandten Dominikanermissionen überbracht. Vor allem der eindringliche Bericht Bruder Julians, der vor dem heranrückenden Heer fliehen mußte und als erster Europäer auch den mongolischen Weltherrschaftsanspruch klar erfaßte, hätte eine deutliche Warnung sein müssen, wurde aber weitgehend ignoriert. Ein Teil der Kumanen floh vor einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung mit den Mongolen und erhielt von Bela IV gegen die Zusicherung von Taufe und militärischer Gefolgschaft neue Siedlungsgebiete in Ungarn. Diese Stärkung der Krone wurde vom ungarischen Adel jedoch hintertrieben, und der auf die Ermordung mehrerer ihrer Stammesführer folgende Abzug der Kumanen schwächte so die Verteidigungskraft Ungarns, des äußersten Vorpostens des katholischen Europas, noch zusätzlich. Das mongolische Heer rückte derweil immer weiter nach Westen vor. Am Dnjepr wurden schließlich zwei Späher festgenommen und verrieten im Verhör durch einen ungarischen Bischof den unmittelbar bevorstehenden Angriff auf Kiew. Aber auch dieses letzte Warnsignal wurde ignoriert.
Als Kiew, Moskau und die übrigen russischen Fürstentümer innerhalb kürzester Zeit überrannt wurden und die Mongolen plötzlich in Mitteleuropa einfielen, trafen sie daher auf keinen geordneten Widerstand. In einer Schlacht am Sajó wurde so das ungarische, beim schlesischen Liegnitz ein hastig aufgestelltes deutsch-polnisches Heer vernichtet, und die Kolonnen schoben sich stetig immer noch weiter nach Westen vor. Wie vorher in Rußland brach aufgrund dieser verheerenden Niederlagen und der darauf folgenden Plünderungen und Verwüstungen nun auch in Westeuropa eine fatalistische Weltuntergangsstimmung aus, die die Mongolen ebenfalls mit den biblischen Armageddonvölkern identifizierte, nämlich mit den im Buch Ezechiel und der Apokalypse des Johannes beschriebenen Völkern Gog und Magog. Der Traum vom König David war endgültig ausgeträumt.
Trotz der übermächtigen Bedrohung zeigten sich die europäischen Herrscher unfähig, interne Konflikte zugunsten einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie beiseitezulegen. Papst Gregor IX im fernen Rom sah in den Mongolen zwar durchaus eine Gefahr für die Christenheit, aber keine größere als die Araber im Heiligen Land, die Ketzer oder gar Kaiser Friedrich II, gegen den er noch Monate zuvor das Kreuz hatte predigen lassen. Da sich die Kreuzzugsidee durch diese Wandlung zum reinen kurialen Machtinstrument somit längst diskreditiert hatte, blieben die bereits zur Routine verkommenen Aufrufe auch diesmal erwartungsgemäß ohne Resonanz. Friedrich II dagegen erkannte in den Mongolen durchaus eine ganz besondere Bedrohung und fühlte sich in seiner kaiserliche Rolle der Abwehr dieser Gefahr zutiefst verpflichtet. Der anhaltende Konflikt mit der Kurie hatte seine Autorität jedoch so untergraben, daß er beschloß, unter Ausnutzung dieser Situation nun endlich den Papst gewaltsam zur Rücknahme seiner Exkommunizierung zu zwingen. Diese Entwicklung führte zur schlechtesten aller denkbaren Konstellationen, da das kaiserliche Heer abseits in Italien vorrückte, während die Mongolen über Europa herfielen. Die Situation wurde endgültig zur Farce, als Gregor IX beim Eintreffen des Kaisers in Rom bereits verstorben war. Der ungelöste Konflikt zwischen Kaiser und Kurie verbreitete einen Fatalismus, in dem die Anrufung göttlicher Hilfe als letzter Ausweg erschien.
Als sich die Mongolen ohne militärische Not bald wirklich aus Mitteleuropa zurückzogen, fühlten sich die Prediger durch den Lauf der Ereignisse bestätigt. Tatsächlich war im Jahr 1241 Ögädei Khan gestorben. Wegen des Fehlens eines automatischen dynastischen Prinzips mußte Batu wie alle Stammesführer, die ihren Einfluß bei der Wahl eines neuen Großkhans geltend machen wollten, nach Karakorum zurückkehren und zog seine Truppen daher in die asiatischen Steppen zurück. Daß Mitteleuropa einer längeren Besetzung durch die Mongolen entging, ist somit vor allem historischen Zufällen zuzuschreiben.
Erste Vorstöße zu den Mongolen
Nach Bekanntwerden des vollen Ausmaßes der Zerstörung wurde an der römischen Kurie die Notwendigkeit erkannt, durch neue außenpolitische Initiativen den päpstlichen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der neugewählte Innozenz IV bereitete daher auf dem Konzil von Lyon 1245 die Aussendung mehrerer diplomatischer Missionen nach Osten vor, deren Hauptaufgabe in der Sammlung strategischen Aufklärungsmaterials anhand eines vorbereiteten Fragenkatalogs bestand. Die bedeutendsten Missionen waren die des Franziskaners Johannes von Pian del Carpine, der über Osteuropa das Heerlager Batus erreichte und von dort aus als erster Europäer zum Hof des Großkhans in Karakorum gelangte, und die des Dominikaners Ascelin, der über Persien reiste, durch seine diplomatische Unfähigkeit innerhalb kürzester Zeit das gesamte dortige Mongolenlager gegen sich aufbrachte und mit seinen Gefährten nur knapp dem christlichen Märtyrertod entging. Trotz der von den jeweils unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen beeinflußten Berichte leiteten diese Missionen die rationale Auseinandersetzung und damit auch die Entmythologisierung der Mongolen ein. Bei allen Unterschieden kamen die Berichte doch auch zu den gleichen strategischen Schlußfolgerungen, nämlich daß die Gefahr keineswegs gebannt und ein erneuter Angriff zu befürchten sei, ihr Weltherrschaftsanspruch Verträge mit den Mongolen unmöglich mache, jedoch die fortgesetzte Sammlung strategischer Informationen durch diplomatische Missionen sicher erschien. So folgten eine Reihe weiterer Missionen, von denen die des in französischem Auftrag reisenden Franziskaners Wilhelm von Rubruk das bis dato differenzierteste Bild der Mongolen ergab und ihnen durch Bezug zu den Hunnen und Ungarn erstmals auch die Einzigartigkeit absprach.
Alle diese Aufklärungsarbeit nützte nichts, als sich 1251 nach einem längeren Interregnum Möngke Khan, ein Enkel Tschingis Khans aus der Linie dessen jüngsten Sohns, als Großkhan durchsetzte und mongolische Kolonnen wieder in alle Himmelsrichtungen marschierten. Die Invasion des südchinesischen Sung-Reichs wurde in Angriff genommen und die mongolische Herrschaft im Nahen Osten durch die Zerschlagung des Assassinenordens und der Eroberung Syriens sowie des Kalifats von Bagdad weiter ausgedehnt. In Osteuropa verbreitete dieser zweite Mongolensturm ebenso wie der erste fünfzehn Jahre vorher wieder apokalyptische Vorstellungen, über die russische Westgrenze kam dieser neue Vorstoß jedoch nicht hinaus. Dies kann sich das Abendland jedoch nicht als Verdienst anrechnen, da sich die bisherigen Erkenntnisse nach wie vor nicht in entsprechenden Verteidigungsstrategien niedergeschlagen hatten. Vielmehr gestatteten Partikularinteressen und das zunehmende Auseinanderdriften des riesigen mongolischen Imperiums die Aufstellung einer ausreichend großen Heeresmacht zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr.
Mit der Festigung der äußeren Grenzen öffnete sich das mongolische Reich, das Europa ja erstmalig unter einem geeinten Herrschaftsgebiet mit dem Fernen Osten verband, zunehmend auch für reisende Händler, deren Erlebnisberichte die der christlichen Missionare ergänzten, da sie die fremden Länder aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachteten. Hierzu zählt vor allem die von 1271 bis 1295 währende Asienreise Marco Polos an den Hof Kubilai Khans, der als Nachfolger seines Bruders Möngke die mongolische Yüan-Dynastie in China begründet und die Hauptstadt von Karakorum nach Peking verlegt hatte. Mit Marco Polos Reiseberichten erreichte die ethnographische Beschreibung fremder Völker wieder ein Niveau, das es im Abendland seit der Antike, etwa in Gestalt der Germanenbeschreibungen Cäsars, nicht mehr gegeben hatte. Einen echten Wandel des Weltbildes bewirkte diese Auseinandersetzung mit den asiatischen Zivilisationen zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht; auch auf Marco Polos Weltkarten sind die Endzeitvölker Gog und Magog weiterhin verzeichnet, sie werden nur nicht mehr mit den Mongolen identifiziert und sind stattdessen noch weiter östlich angesiedelt. Und obwohl die Wundergeschichten eines John Mandeville noch für lange Zeit mehr Leser fanden, wurden in dieser Zeit doch wertvolle Erkenntnisse über fremde Länder gesammelt, auf die man später im Zeitalter der Entdeckungen zurückgreifen konnte. Christoph Kolumbus´ Berechnung des westlichen Seewegs nach Indien beruhte sogar explizit auf den von Marco Polo gegebenen Entfernungsangaben. Ironischerweise waren diese jedoch nicht korrekt, sonst wäre Kolumbus vom Erfolg seines Unterfangens wohl weniger überzeugt gewesen.
Literatur
1. Gian Andri Bezzola: Die Mongolen in abendl ä ndischer Sicht, Bern: Francke, 1974.
2. David Morgan: The Mongols, Oxford: Blackwell, 1986.
- Anmerkung: Die Umschrift mongolischer Namen ist nicht einheitlich geregelt und variiert erheblich in der Fachliteratur; die hier gewählte Schreibweise entspricht weitgehend der intuitiven deutschen Phonetik.
Arno Schindlmayr
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Arno Schindlmayrs Text über die Mongolen?
Der Text behandelt den Mongoleneinfall des 13. Jahrhunderts in Europa und dessen Auswirkungen auf das abendländische Weltbild. Er analysiert, wie die Begegnung mit den Mongolen zunächst durch biblische Vorstellungen geprägt war, aber durch direkten Kontakt allmählich entmythologisiert wurde. Der Text beleuchtet auch das Versäumnis des Abendlandes, die von den Mongolen ausgehende Gefahr rechtzeitig zu erkennen.
Wer war Tschingis Khan und welche Rolle spielte er?
Tschingis Khan war der Gründer und Großkhan des Mongolischen Reiches. Er einte die nomadischen Völker der Mongolei und schuf eine mächtige Militärmacht. Unter seiner Führung und der seiner Nachfolger wurden große Teile Asiens und Europas erobert.
Wie wurde der Mongoleneinfall im Abendland zunächst wahrgenommen?
Anfangs wurde der mongolische Vormarsch von vielen im Abendland als ein Werk des christlichen Königs David interpretiert, der den Islam besiegen und die Ungläubigen bekehren sollte. Diese Vorstellung basierte auf Prophezeiungen und der Legende vom Priesterkönig Johannes.
Wie änderte sich das Bild der Mongolen im Laufe der Zeit?
Nach der Niederlage der Russen an der Kalka und den Plünderungen wurde ein negativeres Bild der Mongolen verbreitet. Sie wurden nun mit den biblischen Endzeitvölkern Gog und Magog identifiziert und als "Tartaren" (Heerscharen der Hölle) bezeichnet.
Was geschah nach dem Tod Tschingis Khans?
Nach Tschingis Khans Tod wurde das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt, wobei Ögädei Khan zum Großkhan ernannt wurde. Unter seiner Herrschaft wurde die Expansion des Reiches fortgesetzt, unter anderem durch einen erneuten Vorstoß nach Westen unter dem Kommando von Batu und Sübodei.
Welche Rolle spielte Bruder Julian bei der Warnung vor den Mongolen?
Bruder Julian, ein Dominikaner, der vom ungarischen König Bela IV ins Wolgagebiet gesandt wurde, überbrachte dem Abendland erste Informationen über den bevorstehenden mongolischen Angriff. Sein eindringlicher Bericht, der auch den mongolischen Weltherrschaftsanspruch umfasste, wurde jedoch weitgehend ignoriert.
Warum zogen sich die Mongolen 1241 aus Mitteleuropa zurück?
Der Rückzug der Mongolen aus Mitteleuropa im Jahr 1241 war vor allem dem Tod Ögädei Khans geschuldet. Batu musste nach Karakorum zurückkehren, um an der Wahl eines neuen Großkhans teilzunehmen.
Welche diplomatischen Missionen wurden zu den Mongolen entsandt?
Nach dem Mongoleneinfall entsandte Papst Innozenz IV mehrere diplomatische Missionen nach Osten, darunter die von Johannes von Pian del Carpine und Ascelin. Diese Missionen hatten das Ziel, strategische Informationen zu sammeln und die Mongolen besser zu verstehen.
Wer war Marco Polo und welche Bedeutung hatten seine Reiseberichte?
Marco Polo war ein venezianischer Händler, der von 1271 bis 1295 nach Asien reiste und am Hof Kubilai Khans weilte. Seine Reiseberichte lieferten detaillierte Beschreibungen fremder Völker und trugen zur Entmythologisierung des Orients bei. Sie waren später eine wichtige Grundlage für die Entdeckungsreisen.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Mongoleneinfall für das Verständnis historischer Ereignisse ziehen?
Der Mongoleneinfall zeigt, wie Voreingenommenheit und das Verkennen von Gefahren zu Fehlentscheidungen führen können. Umgekehrt erhellt die abendländische Haltung gegenüber den Mongolen auch das Verhalten der amerikanischen Indianer gegenüber den europäischen Eroberern.
- Arbeit zitieren
- Arno Schindlmayr (Autor:in), 1997, Das Reich des Großen Khans, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94833