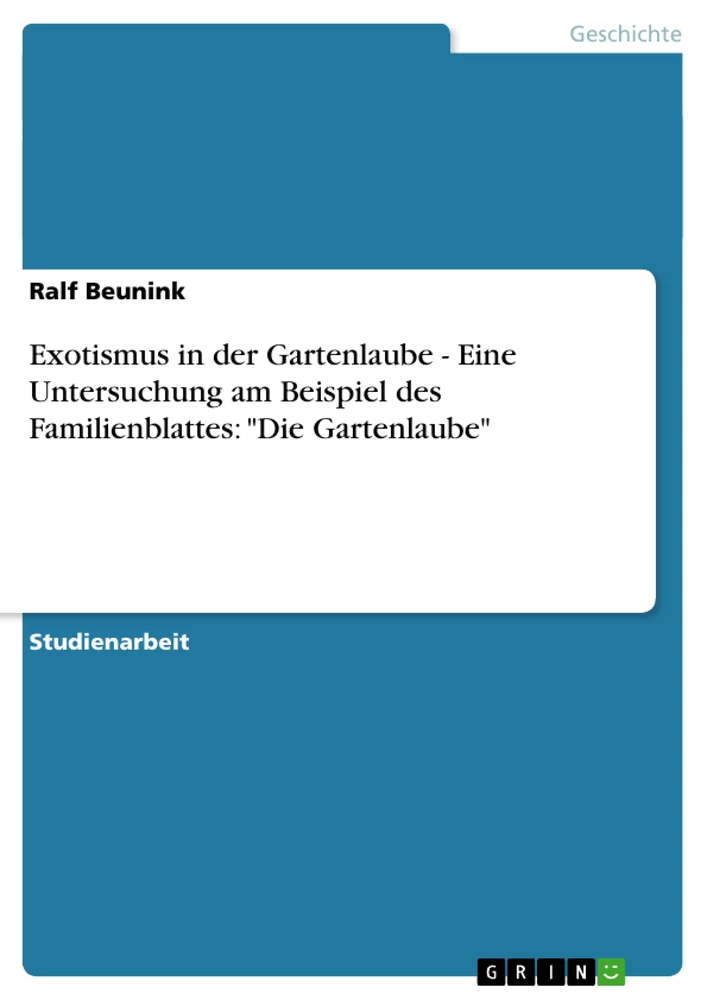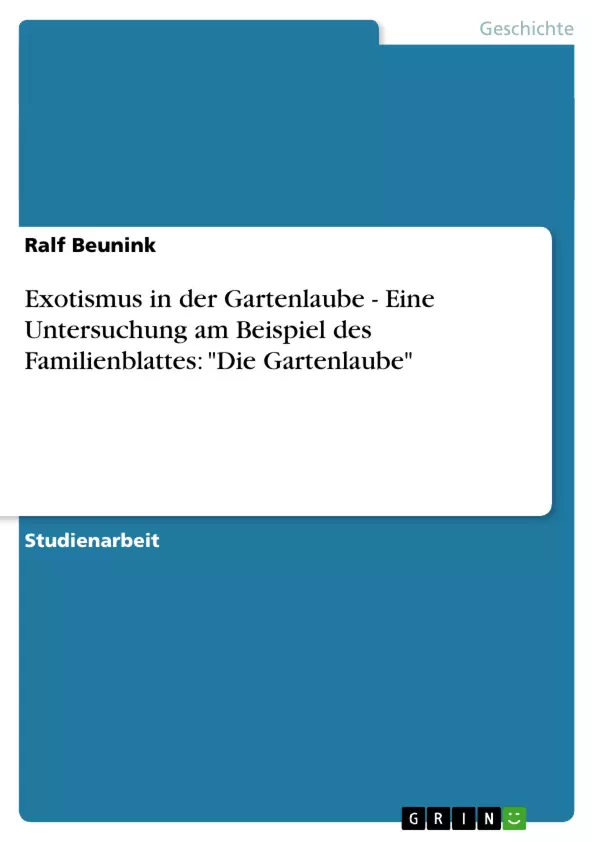`.
Here's a breakdown of the changes applied:
1. **Overall Structure:** The entire main content is wrapped in `` for semantic clarity. The initial "Inhalt" heading is kept in a `` for the document.
2. **Table of Contents (Inhalt):**
* The TOC itself is enclosed in a `
Excerpt out of 37 pages
- scroll top
- Quote paper
- Ralf Beunink (Author), 1998, Exotismus in der Gartenlaube - Eine Untersuchung am Beispiel des Familienblattes: "Die Gartenlaube", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94812
Look inside the ebook