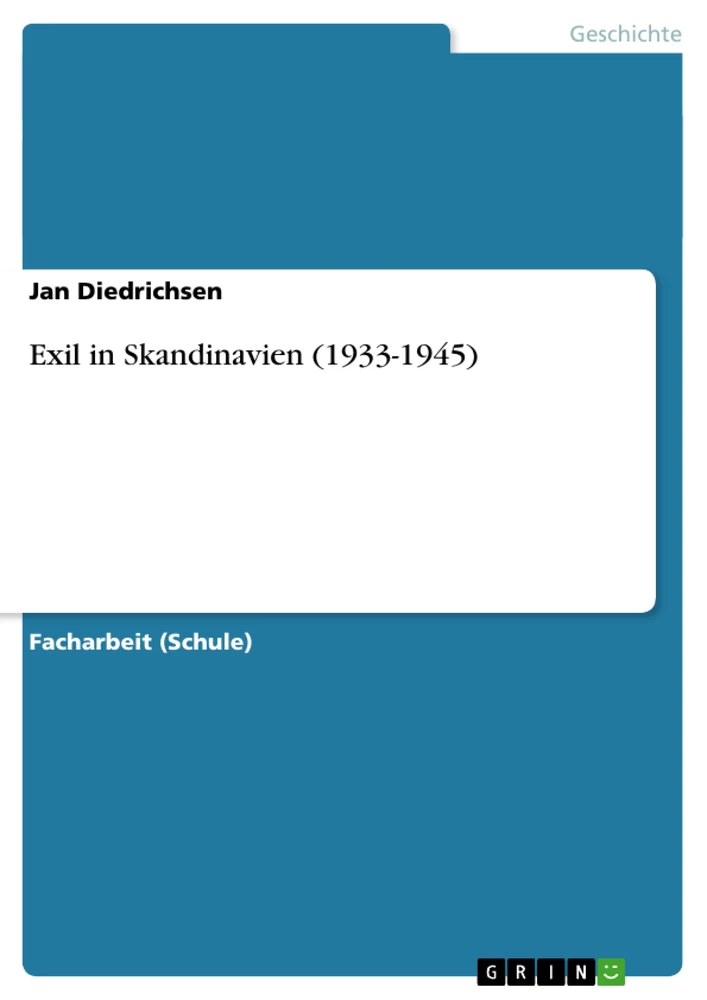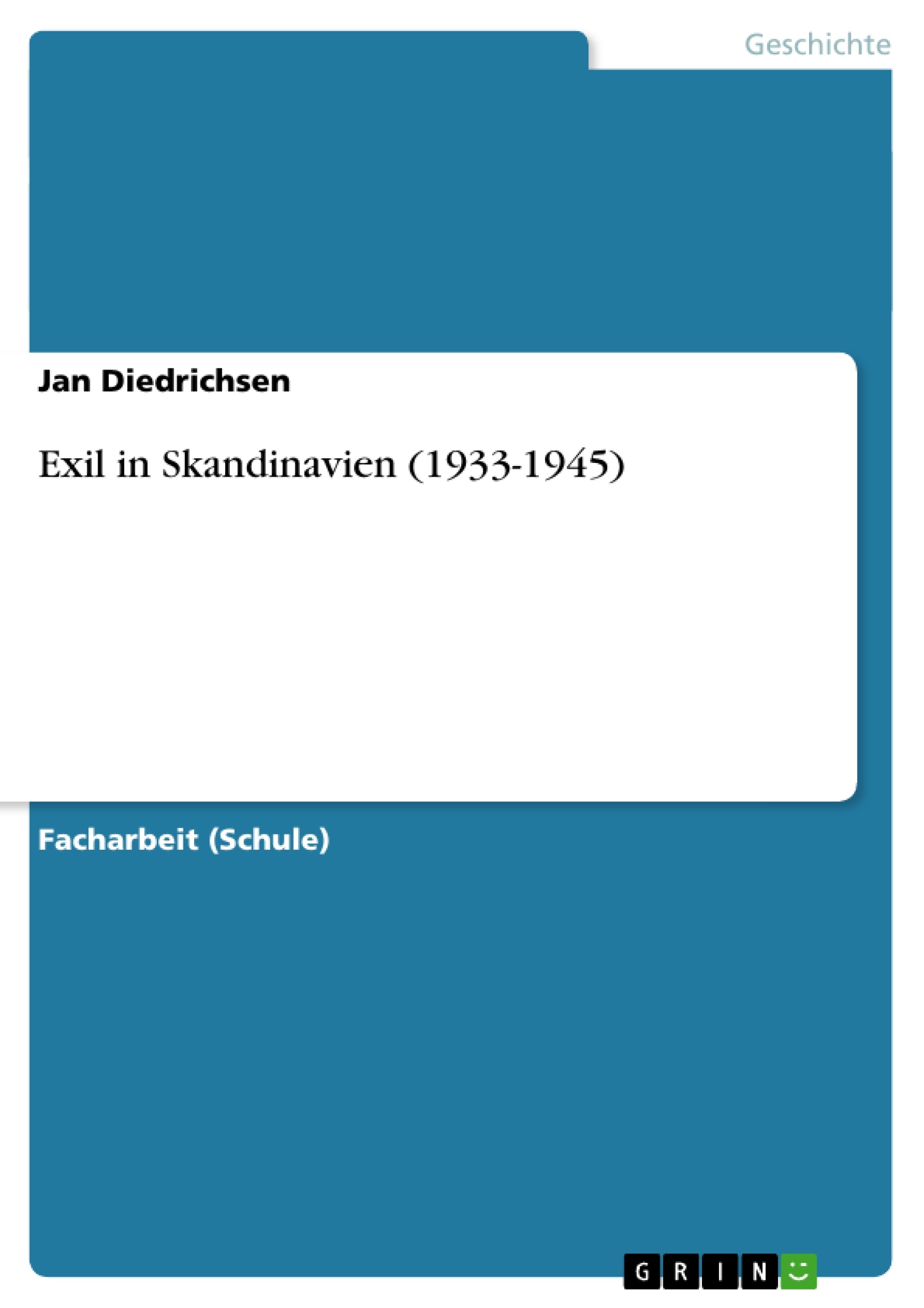1. Dänemark ein Zufluchtsort deutscher Exulanten
Seit der Machtergreifung 1933 durch die Nationalsozialisten und während ihrer gesamten Herrschaft, waren viele Menschen gezwungen Deutschland zu verlassen. Diese Flüchtlinge suchten in verschiedenen Staaten Exil. In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Aufnahmeland Dänemark beschäftigen und die politischen Bedingungen des Exils seit 1933 beleuchten.
Vertreter verschiedenster politischer Gruppierungen sowie religiöse Flüchtlinge und Intellektuelle suchten in Dänemark Schutz. Als Exempel für die Situation der Exulanten in Dänemark habe ich mich mit der Biographie eines deutschen Kommunisten befaßt. Ich habe mich aus zwei Gründen auf die Situation der kommunistischen Emigranten konzentriert. Erstens würde eine ausgewogene Bearbeitung der verschiedenen Gruppierungen, die das Exil in Dänemark ausmachten, den Rahmen sprengen. Des weiteren wird meiner Ansicht nach das ambivalente Verhältnis der dänischen Politik zum Thema Emigranten besonders anhand der Situation kommunistischer Flüchtlinge deutlich.
Unter dänischen Historikern findet die Lage deutscher Exulanten nur wenig Beachtung.
Hauptsächlich Exilforscher aus dem deutschsprachigen Raum haben sich mit der Situation der deutschen Flüchtlinge beschäftigt. Ein weiteres Kennzeichen der Exilforschung Dänemarks ist, daß sie sich hauptsächlich mit den sog. Eliten beschäftigt. Das Leben und Wirken der bekannten Emigranten in Dänemark ist gut dokumentiert - es fehlt aber eine tiefgreifende Darstellung der Lebensbedingungen von "normalen" Flüchtlingen. Es gibt so auch kein Standardwerk, daß sich umfassend mit der facettenreichen Situation der Emigranten in Dänemark beschäftigt. Forschungsergebnisse werden in Form von Aufsätzen in verschiedenen Sammelwerken publiziert.
Einleitend werde ich mich mit den politischen Bedingungen in Dänemark beschäftigen. Hierbei wird die Haltung der dänischen Politik gegenüber Nazideutschland eine wesentliche Rolle spielen. Ein weiterer Faktor - die wirtschaftlichen Bedingungen in Dänemark - werde ich ebenfalls kurz beleuchten. Der Hauptteil dieser Arbeit wird jedoch aus einer Betrachtung der dänischen Flüchtlingspolitik bestehen.
2. Dänemark im Schatten Deutschlands
Das Scheitern der Weimarer Republik und die nationalsozialistische Machtübernahme wurde in Dänemark mit großer Sorge betrachtet und änderte die dänische Politik gegenüber dem Nachbarn im Süden fundamental.
Da die dänische Flüchtlingspolitik meiner Meinung nach durch die Beziehungen beider Länder maßgeblich beeinflußt wurde, habe ich in sehr groben Zügen, die "Taktik" der dänische Politik gegenüber Deutschlands festgehalten.
2.1 Die dänische Low - Profile - Politik
Nach 1933 und während der gesamten 30er Jahre wurde das immer offensivere und aggressivere Auftreten Deutschlands von dänischer Seite mit großer Beunruhigung zur Kenntnis genommen. Besonders die geographische Nähe zum omnipotenten Deutschland führte zu berechtigter Sorge - Dänemark bangte um seine territoriale Souveränität. Die Nationalsozialisten hatten immer wieder darauf hingewiesen, daß sie die Konsequenzen des Versailler Vertrages aufheben wollten. Diese Bestrebungen bedrohten auch das zu Dänemark gehörende Nordschleswig.
Aus diesem Blickwinkel ist die These von Brian Klitgaard und Jens Melson, Dänemark habe in den 30er Jahren eine Taktik des Unsichtbarbleibens, eine "Low - Profile - Politik" betrieben, einleuchtend. Nach Auffassung von Klitgaard und Melson bestand ein zentraler Punkt der dänischen Politik darin, den deutschen Machthabern keinen Grund für eine Intervention zu bieten, man wollte nicht negativ auffallen.
2.2 Die Politik der Zusammenarbeit
Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen am 9. April 1940 änderte sich die dänische Politik gegenüber Deutschland wiederum grundlegend. Die Besetzung wurde ohne entscheidenden Widerstand von der dänischen Seite vollzogen. Parlament, Regierung und König sahen schnell ein, daß militärisches aufbäumen zwecklos sei - die Besetzung wurde unter Protest zur Kenntnis genommen.
Die Okkupation stellte die dänische Politik vor vollendete Tatsachen. Die dänische Regierung entschied sich für eine Zusammenarbeit mit den Besatzern.
Mit dieser Verhandlungspolitik verfolgte die dänische Regierung das Ziel, Dänemark so unbeschadet wie möglich durch den zweiten Weltkrieg zu manövrieren. Durch Verhandlungen und Zugeständnisse versuchten dänische Politiker die Souveränität des Königreiches zu wahren, um weiterhin Einfluß auf die innenpolitischen Geschehnisse nehmen zu können. Um dieses zu gewährleisten, waren zahlreiche Kompromisse mit der Besatzungsmacht nötig.
2.3 Wachsender Widerstand
Mit den zunehmenden Niederlagen Hitlers auf den Schlachtfeldern verschärft sich auch das deutsch - dänische Verhältnis. Der Widerstand in der dänischen Bevölkerung nahm zu. Es kam zu vermehrten Sabotageaktivitäten, Streiks und Straßenunruhen, und die deutschen Besatzer regiert mit blutigem Gegenterror. Dies veranlaßte die Regierung am 29. August 1943 zum Rücktritt, und der dänische König ließ ebenfalls seine Funktionen ruhen. Über Dänemark wurde der Ausnahmezustand verhängt, und die Zusammenarbeitspolitik war de facto gescheitert. Am 5. Mai 1945 wurde Dänemark durch die Alliierten befreit.
2.4 Weltwirtschaftskrise
Neben den politischen Relationen zwischen Dänemark und Deutschland spielte die wirtschaftliche Beziehungen beider Länder im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik der dänischen Regierung ebenfalls eine wichtige Rolle.
Auch Dänemark blieb von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise nicht verschont. Besonders in den 30er Jahren war die dänische Ökonomie hart betroffen. Die Erwerbslosigkeit war erdrückend, und die Arbeiter gingen auf die Straße, um für ihr Recht auf Beschäftigung zu demonstrieren. Die sozialdemokratisch geführte Regierung reagierte mit staatlichen Arbeitsmaßnahmen gegen die Krise. Für die Stabilisierung der Wirtschaft war der Faktor Deutschland von großer Bedeutung, denn wirtschaftlich war Dänemark eng mit Deutschland verknüpft. Ein großer Teil des dänischen Exports - hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte - fanden im benachbarten Deutschland seine Abnehmer. Der Import von Rohstoffen und Technologie aus Deutschland war ebenso für die dänische Wirtschaft von großer Wichtigkeit.
3. Die dänische Flüchtlingspolitik
Ich habe mich einleitend mit den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Dänemark beschäftigt, weil diese meiner Meinung nach entscheidenden Einfluß auf die dänische Fremdenpolitik gehabt haben. Doch es gab auch andere Einflüsse auf die dänische Flüchtlingspolitik. Bei einigen Politikern wurde so z. B. auch die Angst vor einer möglichen "Überfremdung" durch den einsetzenden "Flüchtlingsstrom" laut. Kennzeichnend war auch eine fundamentale Fehleinschätzung der Lage in Deutschland. Einige Politiker gingen davon aus, daß der nationalsozialistische Spuk bald beendet sein würde.
Ich werde mich nun mit der Bedeutung Dänemarks als Exilland beschäftigen, um mich dann eingehend der dänischen Flüchtlingspolitik und ihren Auswirkungen auf die Schutzsuchenden zuzuwenden.
3.1. Dänemarks Bedeutung als Flüchtlingsland
Betrachtete man die dänische Flüchtlingspolitik ist es auch von Interesse, welche quantitative Bedeutung das Königreich eigentlich als Flüchtlingsland hatte. H. U. Petersen hat sich mit dem quantitativen Ausmaß des deutschsprachigen Exils in Dänemark auseinandergesetzt.
Seiner Recherche zufolge hielten sich 1934 in Dänemark 800 Exulanten auf. Ende 1935 waren es ungefähr 1.100 Personen und ein Jahr später 1.340. Bis Anfang 1938 reduzierte sich die Anzahl der Flüchtlinge leicht auf 1.140, um nach der Reichskristallnacht bis 1940 auf 1.600 Personen anzusteigen.
Doch mit dem Zahlenmaterial muß man meiner Ansicht nach vorsichtig umgehen. H. U. Petersen bezieht sich bei seinen Zahlenangaben auf Material des dänischen Justizministeriums und des Archivs der dänischen Sozialdemokratie. Seine Statistik umfassen jedoch weder - worauf Petersen selber hinweist - die jüdischen Landwirtschaftsschüler, die sich in Dänemark aufhielten, noch die jüdischen Kinder, die sich auf Initiative des "Danske Kvinders Nationalråd" in Dänemark befanden. Ein weiterer Faktor, der die Zahlenangaben beeinflussen könnte, sind die kommunistischen Flüchtlinge. Neben denjenigen, die sich ordnungsgemäß in Dänemark gemeldet hatten und somit auch in den Akten des Justizministeriums zu finden sind, hielten sich auch eine Anzahl von Kommunisten illegal in Dänemark auf. Doch es bleibt anhand des von H. U. Petersen zusammengestellten Zahlenmaterials festzustellen, daß das quantitative Ausmaß des deutschsprachigen Exils in Dänemark verschwindet gering war. Abgesehen von der Bedeutung als direktes Exilland spielte Dänemark als Transitland eine wichtige Rolle. Schätzungen sprechen davon, daß über 10.000 Flüchtlinge Dänemark als Sprungbrett für eine Reise nach Schweden nutzten.
3.2. Die Flüchtlingspolitik und ihre Auswirkung
Die Tatsache, daß im Kielwasser der nationalsozialistischen Machtübernahme auch ein Flüchtlingsstrom folgte, traf Dänemark unvorbereitet. Dies läßt sich allein aus der Tatsache ableiten, daß das Gesetz, das als Grundlage für die Behandlung der deutschen Flüchtlinge dienen sollte, aus dem Jahre 1875 stammte und bis 1933 nur geringfügig verändert bzw. erweitert wurde. Das Fremdengesetz setzte sich nicht explizit mit der neuen Flüchtlingssituation auseinander, sondern war ursprünglich als Instrument zur Regulierung der Einreise von ausländischen Arbeitskräften gedacht.
Die dänische Flüchtlingspolitik läßt sich meiner Meinung nach anschaulich an den Bestimmungen und Änderungen des Fremdengesetzes ablesen und interpretieren. H. U. Petersen hat sich ebenfalls mit dem Fremdengesetz im Wandel auseinandergesetzt und der folgende Teil fußt auf seinen Ergebnissen sowie auf den Betrachtungen von Melson und Klitgaard.
Erst auf außenpolitischen Druck hin, und wegen der anwachsenden Zahl von Exulanten in Dänemark bezog die dänische Politik 1933 auf administrativer Ebene mit einer Resolution des Justizministeriums zur Flüchtlingsproblematik Stellung. Daraus ging hervor, daß Hitlerflüchtlinge weiter in Dänemark geduldet waren und sich in einer gewissen Zeitspanne um eine Einreisemöglichkeit in ein Drittland bemühen sollten. Die Flüchtlinge mußten ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können, sie durften dem dänischen Staat finanziell nicht zur Last fallen. Die Hitlerflüchtlinge mußten sich im Großraum Kopenhagen und Frederiksberg niederlassen und sich bei der Polizei melden. Ihnen war strikt untersagt, politisch aktiv zu werden.
Nach der administrativen Resolution des Justizministeriums folgte 1934 auch eine Änderung des Fremdengesetzes. Bereits mit der ersten Änderung trat eine Verschärfung ein. Es bestand nun die Möglichkeit Personen, die einreisen wollten aus Gründen der Staatssicherheit bereits an der Grenze abzuweisen. Des weiteren wurde die normale Aufenthaltsdauer - ohne weitere Genehmigung durch die Obrigkeit - von einem halben Jahr auf drei Monate reduziert. Die Flüchtlinge und ihre Gastgeber mußten sich binnen fünf Tagen bei der Polizei melden.
Die zweite Änderung des dänischen Fremdengesetzes wurde 1938 vorgenommen und auch in diesem Fall ist von einer Verschärfung der Bedingungen die Rede. Die Meldepflicht der Flüchtlinge wurde von fünf auf zwei Tage reduziert. Des weiteren hatten die Exulanten kein Anrecht darauf, eine Erklärung für eine eventuelle Abschiebung zu erhalten. Das gleiche galt bei der Verweigerung einer Arbeitserlaubnis. Bereits seit 1936 wurde administrativ eingeführt, daß jeder Flüchtling bei seiner Anmeldung bei der dänischen Polizei einen Fragebogen auszufüllen habe. Hier mußten die Befragten unter anderem Auskünfte über ihre politischen Verhältnisse, Verbindungen und Aktivitäten vor ihrem Exil geben.
Nur ein Jahr später - 1939 - sollte das Fremdengesetz nochmals revidiert werden. Diese neuerliche Gesetzesinitiative war auch auf eine wachsende Unzufriedenheit der dänischen Polizeiführung zurückzuführen, die eine bessere Kontrolle der Exulanten forderte. Die Erarbeitung eines ganz neuen Fremdengesetzes wurde debattiert aber wieder verworfen. So kam es erneut zu einer Verschärfung des bestehendes Gesetzestextes. Die Sanktionsmöglichkeiten bei einer illegalen Einreise wurden erweitert, und die polizeilichen Befugnisse wurden erheblich ausgedehnt.
Beschlagnahmungen, Durchsuchungen und Festnahmen wurden erleichtert. Nach der Einführung des "J"- Stempels in den Papieren von Juden, wurde den dänischen diplomatischen Vertretungen - strengvertraulich - mitgeteilt, daß jüdische Asylsuchende nur mit vorheriger Billigung durch das Justiz- oder Außenministeriums eine Einreiseerlaubnis erhalten sollten. Diese erneute Zuspitzung der Gesetzgebung trat neun Tage vor der Besetzung Dänemarks in Kraft.
Eine letzte Änderung des Gesetzes erfolgte 1942 und hatte eine erneute Verschärfung des Gesetzes zur Folge. Alle Flüchtlinge und ihre Gastgeber wurden aufgefordert, sich umgehend bei der Polizei zwecks einer Registrierung zu melden. Nunmehr mußten auch Ausländer, die aus Dänemark ausreisen wollten, ihre Papiere vorlegen. Des weiteren wurden die Sanktionsmöglichkeiten der Polizei erneut erweitert.
Betrachtet man das dänische Fremdengesetz und seine Auswirkungen, kann man meiner Meinung nach von einer restriktiven Flüchtlingspolitik sprechen. Besonders bezeichnend ist die Haltung gegenüber den jüdischen Flüchtlingen, die man nicht als politisch Verfolgte sondern als Wirtschaftsimmigranten betrachtete.
Die laufende Verschärfung der Gesetzgebung schottete Dänemark immer weiter gegenüber den Flüchtlingen ab. Nach dem 9. April 1940 und dem Einmarsch der deutschen Truppen war Dänemark selbstredend kein Flüchtlingsland mehr, auch wenn es in vielen Dingen trotz der Besatzung noch relativ autark entscheiden konnte. Ein Ausspruch des dänischen Justizministers Unmarck-Larsen im dänische Reichstag im Frühjahr 1940 ist bezeichnend für die Situation. Unmarck-Larsen unterstrich, "...daß buchstäblich gesprochen kein Emigrant nach Dänemark hineinkommet, ohne daß sich ganz besondere Gründe nachweisen lassen...".
H. U. Petersen ist sogar der Ansicht, daß "... die Behandlung der Hitlerflüchtlinge nach dem 9. April 1940 und die Diensteifrigkeit der Behörden, besonders der Polizei, ein äußerst beschämendes Kapitel der Geschichte Dänemarks sind."
4. Die Hilfsorganisationen
Eine besonders wichtige Rolle in der dänischen Flüchtlingspolitik nahmen die Hilfsorganisationen ein. Auch für die Emigranten waren die Hilfsorganisationen von großer Bedeutung. Wurde ein Flüchtling von einer der Organisationen anerkannt, konnte er in der Regel auch mit einer Anerkennung durch die dänischen Behörden rechnen. Auch bei der Beschaffung von Arbeitserlaubnissen und direkten finanziellen Zuwendungen waren die Organisationen behilflich.
Die Hilfsorganisationen hatten auch für die dänische Regierung Vorteile. Sie waren im Hinblick auf das Verhältnis zu Hitlerdeutschland nützlich, denn die sog. Hilfskomitees waren hauptsächlich auf privater Initiative gegründet. Dies hatte den Vorteil, daß die dänische Regierung sich in kritischen Fragen gegenüber Deutschland bedeckt halten und "die Schuld" auf die Komitees schieben konnte. Die dänische Politik hatte zusätzlich den Vorzug ausgemacht, daß man durch die begrenzte Anzahl der Hilfsorganisationen die Emigranten besser unter Kontrolle hatte.
4.1. Die einzelnen Hilfskomitees
Es gab fünf Hilfskomitees, die von staatlicher Seite offiziell anerkannt waren. Ich werde im Folgenden die einzelnen Komitees kurz skizzieren und ihre Aufgabenbereiche schildern. Wie bereits erwähnt waren die Hilfsorganisationen nicht auf staatlicher Ebene organisiert; trotzdem vertraten die einzelnen Organisationen besondere Flüchtlingsgruppen.
Das "Matteotti-Komitee" war die Anlaufstelle für die sozialdemokratischen Hitlerflüchtlinge. Das Komitee hatte seinen Namen nach einen italienischen Sozialdemokraten, der 1924 von den Faschisten ermordet worden war. Die Organisation wurde in Dänemark 1933 gegründet und hatte sich zur Aufgabe gesetzt deutschen Flüchtlingen, die aus der Arbeiterbewegung kamen, bei ihrem Exil in Dänemark behilflich zu sein oder bei einer Weiterreise in ein Drittland zu helfen. Die Gründung der Organisation ist auf führende dänische Sozialdemokraten und Gewerkschaftler zurückzuführen. Neben der Hilfe bei den Behördengängen und anderen administrativen Dingen wurde auch finanzielle Unterstützung gezahlt.
Eine weiter Hilfsorganisation - "Das Komitee zur Unterstützung von landesflüchtigen Geistesarbeitern " - wandte sich an verfolgte Intellektuelle aus Deutschland und half ihnen bei ihrem Aufenthalt in Dänemark. Wie beim "Matteotti-Komitee", wurde den Flüchtlingen auch mit finanziellen Mitteln unter die Arme gegriffen. Die Hilfsorganisation ist von dänischen Intellektuellen gegründet worden, u.a. von dem Physiker Niels Bohr.
Das "Komitee vom 4. Mai" hatte es mit den meisten Flüchtlingen zu tun - diese Organisation wandte sich nämlich an die jüdischen Emigranten. Das "Komitee vom 4. Mai" hatte wegen der großen Anzahl von jüdischen Exulanten einen hohen Geldbedarf und so kam es immer wieder zu Spendenaufrufen. Die Organisation vermittelte u. a. junge Männer und Frauen an landwirtschaftliche Betriebe, wo sie ausgebildet wurden, mit Hinblick auf eine spätere Ausreise nach Palästina. Das Komitee richtete Gemeinschaftsküchen ein und es wurde in beschiedenem Rahmen finanzielle Unterstützung gezahlt.
Des weiteren gab es ein "Kirchliches Komitee für landesflüchtige nicht arische Christen". Dieses Komitee wurde 1936 gegründet, denn in diesem Jahr erlaubte das dänische Kirchenministerium, daß die gesamte Kollekte des 30. August an das Komitee gehen sollte. Es wurden 80.000 Kronen eingesammelt. Das Komitee hatte sich zur Aufgabe gesetzt, die Ausreise von Emigranten nach Übersee zu ermöglichen. Wegen der hohen Kosten einer solchen Reise, konnte nur wenigen Personen geholfen werden.
Als weitere Organisation trat die "Rote Hilfe", die Organisation der Kommunisten, in Erscheinung. Die dänische "Rote Hilfe" war eine Unterabteilung der internationalen Roten Hilfe, die während der 4. Komintern in Moskau gegründet wurde und in der ganzen Welt aktiv war. Die dänische "Rote Hilfe" wurde bereits in den 20er Jahren gegründet und stand seit 1936 unter der Leitung des berühmten dänischen Schriftstellers Martin Andersen Nexø. Die Kommunisten nahmen unter den dänischen Hilfsorganisationen einen Sonderstatus ein. Die Zusammenarbeit mit den Behörden lief nicht immer reibungslos. Auch die Kooperation mit den anderen Hilfsorganisation war nicht gut. Die "Rote Hilfe" half den kommunistischen Flüchtlingen in verschiedener Form. So gab es neben direkter finanzieller Zuwendungen auch Unterstützung bei dem Kontakt mit den dänischen Behörden.
Eine Zusammenarbeit zwischen dem "Matteotti-Komitee", dem "Komitees zur Unterstützung von landesflüchtigen Geistesarbeiter und dem "Komitee vom 4. Mai" führte 1936 zum "Bund dänischer Emigrantenhilfskomitees". Durch eine Zusammenarbeit versprach man sich eine bessere Position bei den Verhandlungen mit der dänischen Regierung. Doch auch innerhalb des Zusammenschlusses gab es Unterschiede. Den besten Kontakt zur sozialdemokratischen dänischen Regierung hatte das "Matteotti-Komitee".
Die Flüchtlinge der einzelnen Komitees wurden durch die dänische Regierung sehr unterschiedlich behandelt. H. U. Petersen spricht sogar von einer "prinzipiell ungerechten Behandlung der verschiedenen Flüchtlingsgruppen". Er nennt als Beleg für diese Behauptung, daß die 20.000 Kronen, die von 1937 bis 1940 jährlich im Rahmen des dänischen Finanzgesetzes für die Unterstützung der Arbeit der Hilfsorganisationen abgesetzt wurden, zu gleichen Teilen an die Mitgliedsorganisationen des "Bundes dänischer Emigrantenhilfskomitees" überwiesen wurden. Die "Rote Hilfe" ging leer aus, trotz der Tatsache, daß sich diese Organisation auch für die Belange der Flüchtlinge einsetzte und staatlich anerkannt war.
Die Hilfskomitees konnten bis zum Einmarsch der deutschen Truppen ihre Arbeit fortsetzten. Im Dezember 1940 forderten die deutschen Besatzer Einsicht in die Arbeit der Komitees und bei einer gezielten Aktion der dänischen Polizei, an der auch die Gestapo teilnahm, wurden die Archive der Hilfsorganisationen beschlagnahmt. Nur die "Rote Hilfe" konnte ihr Archiv vor dem Zugriff schützen. Nach Aufforderung des dänischen Justizministeriums wurden die Hilfsorganisationen im März 1941 aufgelöst.
5. Kommunisten im dänischen Exil
Wie bereits in der Einleitung angekündigt, werde ich mich etwas genauer mit der Situation der Kommunisten im dänischen Exil beschäftigen. Die regressive Haltung der dänischen Politik bzw. der dänischen Polizei wird bei den kommunistischen Flüchtlinge besonders deutlich. Bei der Betrachtung der kommunistischen Flüchtlinge wird ersichtlich, was H. U. Petersen meint, wenn er von der "Diensteifrigkeit der Behörden" spricht.
5.1 Die dänischen Behörden und die Kommunisten
Kommunistische Flüchtlinge wurden in Dänemark nicht gerne gesehen. Der Antikommunismus war in dänischen Politik und besonders bei der Polizei anzutreffen. Sowohl bürgerliche Parteien als auch die Sozialdemokratie waren der Ansicht, daß die Kommunisten sich doch um eine Ausreise in die Sowjetunion bemühen sollten. Man wollte vermeiden, daß sie politisch aktiv wurden, was ihnen ja auch durch eine Bestimmung im Fremdengesetz untersagt war. Auch hier spielt das Verhältnis zu Hitlerdeutschland und die dänische "Low-Profile-Politik" eine bedeutende Rolle. Die kommunistischen Flüchtlinge wurde zwar bis 1941 geduldet aber waren keine gerngesehenen Gäste.
Zahlreiche Kommunisten hielten sich - nach einer Parteiorder - auch an Gesetze und meldeten sich bei der Polizei; sie füllten dort sogar die Fragebögen über ihre bisherigen Aktivitäten aus. Diese "legalen" Kommunisten hielten sich in Dänemark bis 1941 auch relativ unbehelligt auf. Neben den "legalen" Kommunisten arbeiteten natürlich auch einige weiterhin im Untergrund.
Die Besetzung Dänemarks wurde unter den kommunistischen Flüchtlingen natürlich mit besonderer Sorge zur Kenntnis genommen. Doch die Nationalsozialisten begannen nicht sofort - wie befürchtet - mit einer systematischer Verfolgung der Flüchtlinge. Das Interesse der GESTAPO an den Flüchtlingen war eher gering. Es waren eifrige dänische Polizisten, die nach der Besatzung Verhaftungen vornahmen. Erst im Sommer 1941 kam es zu systematischen Verhaftungen. Auch hier bewahrte Dänemark seine Souveränität. Es waren dänische Polizisten, die die Verhaftungen vornahmen. Dank der Fragebögen, die ja auch von den kommunistischen Flüchtlingen ausgefüllt worden waren, war die dänische Polizei in vielen Fällen bestens über den Aufenthaltsort der Flüchtlinge informiert. Diese Auskünfte wurde den deutschen Besatzern - ohne daß dies von ihnen verlangt wurde - übergeben.
Im Juli 1940 wurde die Errichtung eines Internierungslagers in Horserød auf Nordseeland beschlossen. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nahmen die Verhaftungen an Umfang zu. Das Internierungslager in Horserød wurde aufgeteilt, und die Kommunisten wurden gesondert untergebracht. Zahlreiche Kommunisten, die sich im Internierungslager Horserød aufhielten, wurden nach Deutschland ausgeliefert oder abgeschoben. Für viele Flüchtlinge bedeutete das Konzentrationslager.
5.2. Eine Biographie
Um die Situation der Flüchtlinge in Dänemark und die regressive Haltung der dänischen Politik besonders zu verdeutlichen, habe ich mit der Biographie eines deutschen Kommunisten befaßt, der in Dänemark Zuflucht suchte. Eine einzelne Biographie ist natürlich nicht repräsentativ für eine Flüchtlingsgruppe, doch es zeichnet meiner Meinung nach ein gutes Bild der ausweglosen Situation einiger Flüchtlinge. Als Quelle dient mir das Buch "Der var bud efter dem - Fire skæbneforteællinger fra 30érnes revolutionære miljø" von Ole Sohn. Das Buch fußt auf Gespräche mit drei dänischen und einem deutschen Kommunisten und Archivstudien in Moskau sowie Informationen des dänischen Justizministerium.
Für mich war die Biographie von Victor Priess von Interesse, da er sich als deutscher Emigrant in Dänemark aufgehalten hat. Victor Priess wurde 1908 in Hamburg geboren und wuchs in einem sozialdemokratisch geprägtem Elternhaus auf. Bereits als 15jähriger begann Victor Priess seine politische Tätigkeit im kommunistischen Jugendapparat. Später wurde er vom Militär-Politischen-Nachrichtendienst der KPD angeworben. Nach dem Verbot der KPD arbeitete Priess verstärkt im Untergrund, und am 15. August 1933 wurde er von der Gestapo verhaftet und verhört. Doch ihm gelang die Flucht und er erhielt die Parteiorder, sich nach Dänemark abzusetzen. Die Gestapo fahndete nun wegen Hochverrats nach ihm.
Über Norwegen gelang Victor Priess im Februar 1934 nach Dänemark. Die dänischen Behörden erteilten ihm eine befristete Aufenthaltsgenehmigung mit der Auflage, dem Staat nicht finanziell zur Last zu fallen. Er durfte sich nur im Großraum Kopenhagen aufhalten und unter keinen Umständen politisch aktiv werden. An jedem zehnten Tag mußte er sich bei der Polizei melden.
1935 erkrankte Priess schwer, und durch die kommunistische Hilfsorganisation "Rote Hilfe" wurde ein Kontakt zur Familie Ipsen in Hundslund in Jüttland hergestellt, die ihn gerne zur Rekreation aufnehmen wollte. Er beantragte ordnungsgemäß bei der Polizei eine Reisegenehmigung, um die Familie besuchen zu können. Erst nachdem die dänische Staatspolizei die Familie Ipsen genauer unter die Lupe genommen hatte, durfte Victor Priess abreisen, und sein Aufenthalt war auf einen Monat befristet. Er fühlte sich bei der Familie wohl, und seine Genesung schritt schnell voran. Nach einem Monat mußte er die Familie wieder verlassen, doch kurz darauf wurde er nochmals eingeladen. Er hielt sich mehrere Monate in Hundslund auf, wo er als Familienmitglied betrachtet wurde. Victor Priess entschloß sich aber als Freiwilliger nach Spanien zu gehen, wo er bis 1939 diente und schwer verwundet wurde. Während seiner gesamten Zeit in Spanien hielt er engen Kontakt zur Familie Ipsen in Dänemark. Victor Pries beantragte erneut eine Einreiseerlaubnis nach Dänemark, und die Familie Ipsen erklärte sich sofort bereit, ihn aufzunehmen. Doch die dänischen Behörden stellten sich quer. Sie wußten zwar durch das deutsche Fahndungsbuch, daß Victor Pries wegen Hochverrats gesucht wurde und daß ihn in Deutschland der Tod drohte, doch eine Einreiseerlaubnis wollten sie ihm trotzdem nicht erteilen.
Die Familie Ipsen gab sich den dänischen Behörden aber nicht so einfach geschlagen und setzte sich vehement für Victor Priess ein. Dr. Ipsen schrieb den dänischen Außenminister Peter Munch, der wie er auch Mitglied der Partei Radikale Venstre (Linksliberale) war. Er wandte sich auch an den sozialdemokratischen Justizminister K.K. Steinecke, doch ohne Erfolg - es gab keine Einreise für Victor Priess, Dänemark blieb für ihn nicht erreichbar.
Auch der weitere Lebenslauf von Victor ist alles andere als rosig. Als sich ihm die Möglichkeit bot reiste er 1944 in die Sowjetunion. Dort wurde er nach einem Schauprozeß zu 25 Jahren Arbeitslager in Sibirien verurteilt - man hatte ihn fälschlicherweise der Spionage angeklagt. 1956 wurde er entlassen und konnte nach Deutschland reisen.
6. Schlußbetrachtung
H. U. Petersen spricht im Hinblick auf die dänische dänischen Flüchtlingspolitik von einem "beschämenden Kapitel" und ich kann mich dieser Auffassung anschließen. Beim Beschäftigen mit der dänischen Flüchtlingspolitik und dem Vorgehen der Polizei wurde ich immer wieder über die regressiven bzw. flüchtlingsfeindlichen Tendenzen überrascht. Besonders betreten hat mich auch die unterschiedliche Behandlung der Exulanten gemacht. Die Situation der kommunistischen und jüdischen Hitlerflüchtlinge sind hierfür bezeichnend.
. Von einer prinzipiell flüchtlingsfeindlichen Politik der dänischen Regierung zu sprechen wäre meiner Meinung nach jedoch falsch, denn Dänemark war besonders noch in den 30er Jahren eine Anlaufstelle für Hitlerflüchtlinge. Auch die gesamte dänische Polizei als flüchtlingsfeindlich zu stempeln wäre nicht zutreffend. Legt man jedoch die Behandlung der Flüchtlinge und insbesondere der kommunistischen Exulanten nach 1941 zugrunde, steht es meiner Meinung nach außer Frage, daß große Teile der dänischen Polizei mit den Besatzern sympathisierten bzw. zusammenarbeiteten.
Ich bin selber dänischer Staatsbürger und wage die Behauptung, daß die meisten Dänen mit der Behandlung der deutschen Flüchtlinge nicht vertraut sind und die Auswirkungen der dänischen Flüchtlingspolitik weitestgehend nicht bekannt sind . Daß die Haltung der dänischen Politik unbekannt ist, liegt auch an der Tatsache, daß sich die dänische Forschung nur peripher mit der Problematik beschäftigt - hier herrscht meiner Ansicht nach Nachholbedarf.
Bibliographie
Bohn, Robert (Hg.) et al. 1991. Neutralit ä t und totalit ä re Aggression. Nordeuropa und die Gro ß m ä chte im Zweiten Weltkrieg. Stuttgart: Steiner Verl..
Dinesen, Ruth (Hg.) et al. 1986. Deutschsprachiges Exil in D ä nemark nach 1933. Zu Methoden und Einzelergebnissen. Kopenhagen, M ü nchen: Fink Verl.
Lorenz, Einhart (Hg.). 1998. Ein sehr tr ü bes Kapitel?. Hitlerfl ü chtlinge im nordeurop ä ischen Exil 1933 bis 1950. Hamburg: Ergebnisse-Verl.
Petersen, Hans Uwe (Hg.). 1991. Hitlerflüchtlinge im Norden 1933-1945. Kiel: Veröffentl. des Beirats für Geschichte der Arbeiterbewegung und Demokratie in S.H., Bd. 7.
Sløk, Johannes (Bearb.). 1956 . Krise i Danmark. Struktur æ ndring og krisepolitik i 1930 ´ erne. K ø benhavn: Berlinske Forlag (Berlinske Leksikon Bibliotek).
Sohn, Ole. 1993. Der var bud efter dem. Fire sk æ bnefort æ llinger fra 30 ´ ernes revolution æ re milj ø . K ø benhavn: Vindrose.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad handler teksten "Dänemark ein Zufluchtsort deutscher Exulanten" om?
Teksten handler om Danmarks rolle som tilflugtssted for tyske flygtninge (exulanter) under nazisternes magtovertagelse fra 1933 og fremefter. Den undersøger de politiske betingelser for eksil i Danmark og de forskellige grupper, der søgte beskyttelse, med særligt fokus på de kommunistiske emigranters situation.
Hvorfor fokuserer teksten på kommunistiske emigranter?
Teksten fokuserer primært på de kommunistiske emigranters situation, da en afbalanceret behandling af alle de forskellige grupper ville overstige rammerne for teksten. Desuden illustrerer de kommunistiske flygtninges situation tydeligt det ambivalente forhold, den danske politik havde til emigranter.
Hvilken "Low - Profile - Politik" førte Danmark?
Danmark førte efter 1933 en "Low - Profile - Politik" for at undgå at provokere Tyskland og dermed undgå en tysk intervention.
Hvilken politik førte den danske regering under den tyske besættelse?
Den danske regering valgte at samarbejde med de tyske besættere for at manøvrere Danmark igennem Anden Verdenskrig så uskadt som muligt og for at bevare kongerigets suverænitet og indflydelse på indenrigspolitiske begivenheder.
Hvordan påvirkede verdensøkonomisk krisen Dänemark?
Verdensøkonomisk krisen ramte også Dänemark hårdt, især i 1930'erne. Arbejdsløsheden var høj, og Tyskland var en vigtig faktor for stabiliseringen af den danske økonomi, da en stor del af den danske eksport gik til Tyskland, og Dänemark importerede råstoffer og teknologi fra Tyskland.
Hvor mange tyske flygtninge var der i Dänemark?
Det kvantitative udmåle af det tyske exil i Dänemark var beskedent. Det skønnes, at der var 800 exulanter i 1934, 1.100 i slutningen af 1935, 1.340 i 1936 og omkring 1.600 i 1940. Dänemark fungerede også som et vigtigt transitland for flygtninge, der rejste videre til Sverige.
Hvad var det dänische "Fremdengesetz"?
Fremdengesetz (udlændingeloven) var loven, der dannede grundlag for behandlingen af tyske flygtninge. Loven var oprindeligt tænkt som et redskab til regulering af indrejsen af udenlandske arbejdskraft, men blev ændret og strammet i løbet af 1930'erne for at regulere og begrænse antallet af flygtninge.
Hvordan var den dänische Flüchtlingspolitik?
Teksten argumenterer for, at den dänische Flüchtlingspolitik (flygtningepolitik) var restriktiv, især over for jødiske flygtninge, som ikke blev betragtet som politisk forfulgte, men som økonomiske immigranter. Lovgivningen blev løbende strammet, hvilket isolerede Dänemark mere og mere fra flygtninge.
Welche Hilfsorganisationen gab es?
Der var fem Hilfsorganisationen (hjælpeorganisationer), som var officielt anerkendt af staten: Matteotti-Komiteet, Komiteet zur Unterstützung von landesflüchtigen Geistesarbeitern, Komitee vom 4. Mai, Kirchliches Komitee für landesflüchtige nicht arische Christen og Rote Hilfe. Disse organisationer hjalp flygtninge med blandt andet økonomisk støtte, myndighedskontakt og jobsøgning.
Welche Rolle spielten die dänischen Behörden und die Kommunisten?
De dänischen Behörden (myndigheder) var ikke glade for kommunistische Flüchtlinge (kommunistiske flygtninge). Antikommunismus var udbredt, og myndighederne mente, at kommunisterne skulle rejse til Sovjetunionen. Efter den tyske besættelse var det ivrige danske politifolk, der foretog anholdelser af kommunistiske flygtninge.
Hvad var Victor Priess' skæbne?
Victor Priess var en tysk kommunist, der flygtede til Dänemark. Selvom han var eftersøgt af Gestapo, ville de danske myndigheder ikke give ham en indrejsetilladelse. Han endte i Sovjetunionen, hvor han blev dømt til tvangsarbejde i Sibirien.
Hvordan konkluderer teksten om den dänischen Flüchtlingspolitik?
Teksten konkluderer, at den dänischen Flüchtlingspolitik (flygtningepolitik) er et "beschämendes Kapitel" (beskæmmende kapitel) i Danmarks historie. Samtidig fremhæves det, at det ville være forkert at kalde hele den danske politik eller politi for flygtningefjendsk, men at behandlingen af flygtninge, især efter 1941, var problematisk.
- Quote paper
- Jan Diedrichsen (Author), 2000, Exil in Skandinavien (1933-1945), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94800