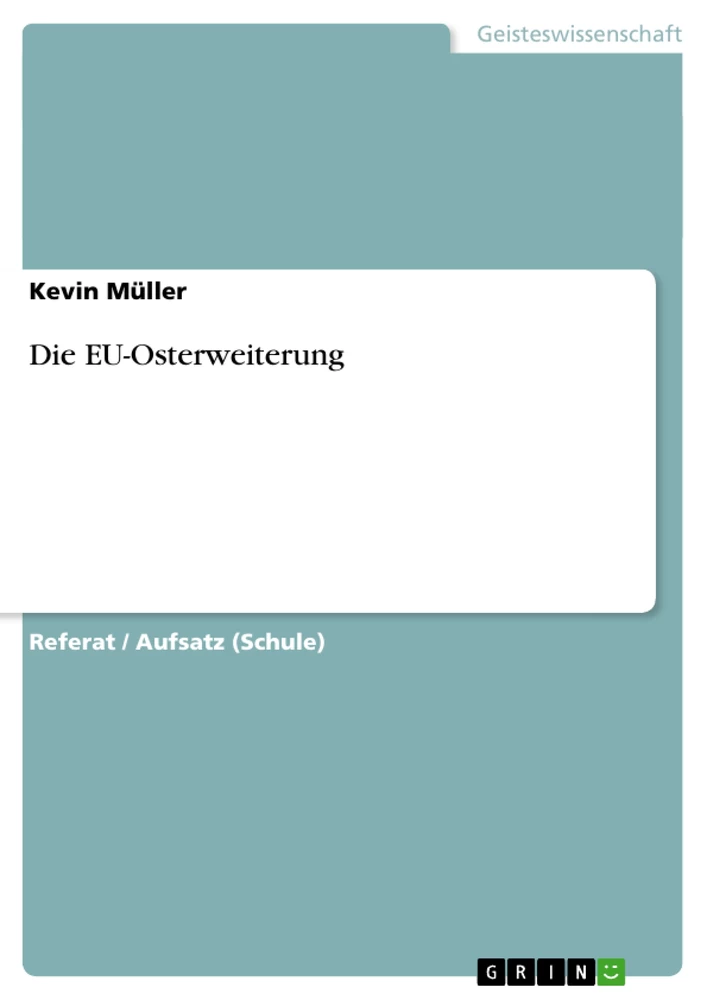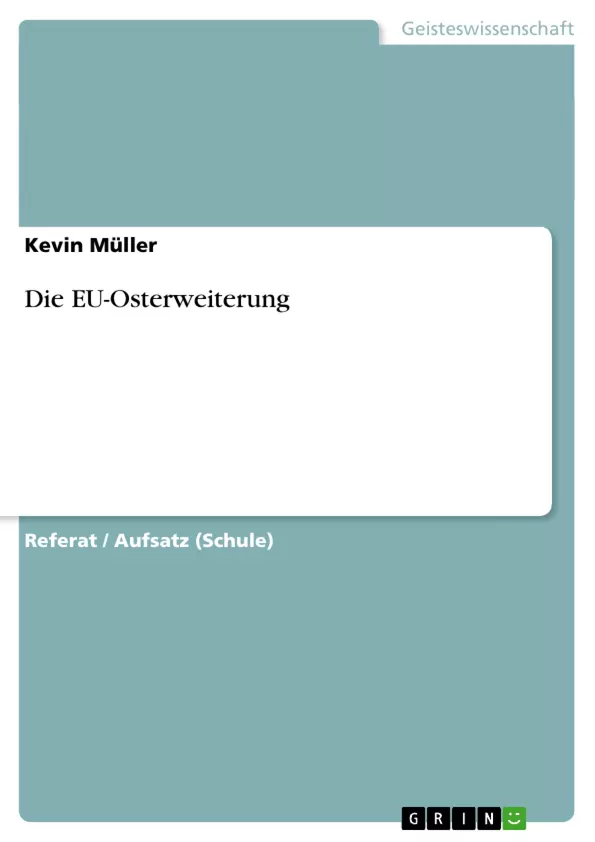I. Einleitung
Kosten und Nutzen einer EU-Osterweiterung werden derzeit breit in Politik und Gesellschaft diskutiert. Nach dem unerwarteten Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa und der Sowjetunion, steht der Europäischen Union eine schwierige Herausforderung bevor, die darin liegt diese sogenannten OME - Staaten (Ostmitteleuropa) in ein demokratisches marktwirtschaftliches Europa zu integrieren. 10 dieser OME - Staaten haben bereits Beitrittsanträge gestellt, mit 6 von ihnen (Estland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern) wird bereits konkret über eine Aufnahme in die EU verhandelt.
"DerÜbergang der mittel- und osteuropäischen (MOE-)Länder zu Demokratie und Marktwirtschaft stellt ein weltgeschichtliches Ereignis dar, an dessen Erfolg die westlichen Demokratien und insbesondere Westeuropa ein fundamentales Interesse haben.", so Wolfgang Quaisser vom Osteuropa-Institut München.
Wirtschaftliche Prosperität und eine funktionierende Demokratie sind schließlich Grundvoraussetzungen für Stabilität im ostmitteleuropäischen Raum. Da sich die meisten Staaten noch in Phasen der Transformation befinden, muß die EU besonderes Augenmerk darauf legen, diese Staaten zu unterstützen, nicht zuletzt deshalb, weil heutige Versäumnisse dort mittelfristig zu Instabilität und somit eines Vielfachen der jetzigen Kosten führen könnten.
II. Die Voraussetzungen für einen Beitritt zur EU
Bereits 1990 wurden auf der KSZE-Konferenz durch die Pariser Charta für ein neues Europa die Leitmotive eines Systemwechsels in den MOE-Staaten festgelegt: Demokratie, Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit und Marktwirtschaft. Im Maastrichter Vertrag 1992 wurden diese Ziele als Voraussetzungen für einen Beitritt zur europäischen Union formuliert. Weiter konkretisiert wurden sie in den sogenannten Kopenhagener Kriterien (1993) des Europäischen Rates und im Weißbuch zum Binnenmarkt der Europäischen Kommission.
Eine Einteilung der Kriterien erfolgt anhand der Agenda 2000 der Europäischen Kommission:
a. Politische Kriterien
- Demokratie und Rechtstaatlichkeit
- Menschenrechte
- Schutz von Minderheiten
b. Wirtschaftliche Kriterien
- Funktionsfähige Marktwirtschaft
- Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten
c. Übernahme des Besitzstandes der Union ("aquis communautaire") sowie der politischen Ziele
Das Weißbuch zum Binnenmarkt (1995) beschäftigt sich mit den Fragen der wirtschaftlichen Integration, insbesondere der Anpassung der MOE-Staaten an den europäischen Binnenmarkt.
Die Anpassung an die zahlreichen Rechtsvorschriften der EU muß konsequent erfolgen und erfordert eine große reformerische Anstrengung in den assoziierten Ländern.
Diese enormen Veränderungen und Zwänge bereiten einem ehemals sozialistischen Land wie Ungarn Probleme, auf die im folgenden eingegangen wird.
III. Umsetzung der politischen Kriterien in den Beitrittsländern
Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft nannte der Europäische Rat auf seiner Kopenhagener Tagung "institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten". Sobald der Vertrag von Amsterdam in Kraft tritt, wird der derzeitige Artikel O des Vertrages unter Einbeziehung der "Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit" geändert.
In ihren Stellungnahmen gelangte die Kommission zu dem Schluß, daß mit Ausnahme eines Landes alle Bewerberländer die politischen Kriterien erfüllen, selbst wenn einige von ihnen in der demokratischen Praxis und beim Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten noch weitere Fortschritte machen müßten. Nach Auffassung der Kommission erfüllte nur die Slowakei die politischen Kriterien nicht. Aus den letzten Wahlen ging eine neue Regierung hervor, die Reformen einleiten dürfte, welche möglicherweise eine Änderung der Lage bewirken.
Bei der Frage nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achtete die Kommission darauf, wie die Demokratie in der Praxis funktioniert, anstatt sich auf förmliche Beschreibungen der politischen Organe zu verlassen. Insgesamt vertritt die Kommission die Auffassung, daß die Verhältnisse generell zufriedenstellend sind, zumal sich die Demokratie konsolidiert und damit die in den Stellungnahmen festgestellten positiven Entwicklungstendenzen stärkt. Freie, allgemeine und gleiche Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen haben in den letzten 18 Monaten in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Litauen und Lettland stattgefunden. Dabei haben die betreffenden Bewerberländer bewiesen, daß sie über stabile Institutionen verfügen, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Behörden und die Festigung der Demokratie gewährleisten. Auch in der Slowakei gibt es Anzeichen für eine Entwicklung in dieser Richtung.
Ungeachtet dieser positiven Entwicklungen ist nicht genug getan worden, um die in den Stellungnahmen aufgezeigten Mängel im institutionellen Bereich zu beheben. Ein allen Bewerberländern gemeinsames Problem sind nach wie vor die Schwächen der Justiz, angefangen vom Ausbildungsstand der Richter bis hin zu den äußerst schleppend verlaufenden Gerichtsverfahren, die nur durch eine Reform der Strafprozeßordnung beschleunigt werden können. Besonders ernst ist die Lage in Polen, in der Tschechischen Republik, in Slowenien und in Estland. Im Falle der Slowakei ist eines der Hauptprobleme nach wie vor die richterliche Unabhängigkeit. Während Ungarn Anstrengungen zur Verbesserung seines Rechtssystems unternommen hat, haben andere Länder seit Veröffentlichung der Stellungnahmen nur geringe Fortschritte erzielt.
Der Kampf gegen die Korruption muß noch energischer geführt werden. Die von den Bewerberländern getroffenen Maßnahmen sind dem Ernst dieses Problems nicht immer angemessen. Zwar führen einige Länder neue Kontroll- und Präventionsprogramme ein, aber für eine Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist es noch zu früh. In den meisten Bewerberländern fehlt es in gewisser Weise an der Entschlossenheit, das Problem anzugehen und endgültig mit der Korruption aufzuräumen.
Generell ist die Achtung der fundamentalen Menschenrechte in den Bewerberländern gewährleistet. In den meisten Bewerberländern laufen die Verfahren zur Ratifikation der wichtigsten Rechtsinstrumente zum Schutz der Menschenrechte. Jedoch vertritt die Kommission nach wie vor die Auffassung, daß in manchen Fällen die Unabhängigkeit von Rundfunk und Fernsehen besser garantiert werden muß.
In Rumänien trifft die Regierung mit Hilfe von Phare weiterhin Maßnahmen, die einen besseren Schutz der annähernd 100.000 in staatlichen Waisenhäusern lebenden, von ihren Eltern verlassenen Kinder gewährleisten sollen. Es wurde versucht, die Rückführung der Kinder in ihre Familien oder die Adoption durch Pflegefamilien zu fördern.
Hinsichtlich des Schutzes von Minderheiten begrüßte die Europäische Union bereits das Ergebnis der kürzlich in Lettland durchgeführten Volksbefragung zum Gesetz über die lettische Staatsbürgerschaft. Es wird die Einbürgerung von Nicht-Letten und ihrer staatenlosen Kinder erleichtern. In Estland hat das Parlament bedauerlicherweise die Änderungen des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft, aufgrund deren staatenlose Kinder die Staatsbürgerschaft erhalten könnten, noch nicht genehmigt.
Die Lage der Sinti und Roma ist nach wie vor schwierig, da die betreffenden Bewerberländer bei der Lösung dieses Problems wenig Fortschritte gemacht haben. Obwohl ihre Rechtsstellung und ihre Rechte gleichbleibend fortbestehen, leiden die Sinti und Roma, insbesondere in Ungarn, der Slowakei, in Bulgarien und der Tschechischen Republik, unter Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung. Rumänien, wo mehrere Millionen Sinti und Roma leben, muß erhöhte Anstrengungen zur Verbesserung der Lage dieser Minderheit unternehmen.
Es gibt Anzeichen dafür, daß sich die Lage der ungarischen Minderheit in Rumänien auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens bessert; in diesem Zusammenhang ist die Entschlossenheit der rumänischen Regierung, Mittel und Wege zur Gründung einer ungarisch-deutschen Universität zu finden, zu nennen. Bisher gibt die Lage der ungarischen Minderheit in der Slowakei noch Anlaß zur Besorgnis. Was die Rechtsstellung der ungarischen Minderheit in der Slowakei anbetrifft, so wird mit der Aufnahme von Vertretern dieser Minderheit in die neue slowakische Regierung ein positives Zeichen gesetzt.
Generell sind zwar keine neuen Probleme oder Rückschritte festzustellen, wo es um das Funktionieren des politischen Systems und des Rechtssystems nach demokratischen Grundsätzen in den Bewerberländern geht, in den vergangenen 18 Monaten wurde jedoch wenig erreicht, sodass in diesem Bereich weitere Anstrengungen unternommen werden müssen. Generell bleibt die Lage der Minderheiten unter dem Aspekt der Erweiterung problematisch.
IV. Umsetzung der wirtschaftlichen Kriterien in den Beitrittsländern
In den Stellungnahmen wurde festgestellt, daß alle mittel- und osteuropäischen Beitrittsländer beachliche Fortschritte beim Übergang zur Marktwirtschaft nach dem Zusammenbruch des ehemaligen kommunistischen Handelsblocks erzielt haben. Die unterschiedliche Ausgangslage dieser Länder wurde zwar anerkannt, dennoch wurde in diesen Stellungnahmen großer Wert auf eine kohärente Anwendung der allgemein unterstützten marktorientierten Reform- und Wirtschaftspolitik gelegt. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, daß viele der Beitrittskandidaten trotz eines hohen Wirtschaftswachstums immer noch großen Risiken im Zusammenhang mit der makroökonomischen Entwicklung ausgesetzt sind.
Seit der Veröffentlichung der Stellungnahmen wurde das Wirtschaftswachstum in den zehn Beitrittsländern in Mittel- und Osteuropa (MOEL) durch die Verschlechterung der internationalen Konjunktur und die Krisenstimmung auf den Finanzmärkten nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen. Für dieses Jahr wird mit einem realen Wachstum für die zehn Länder von 3,5 % gerechnet, bei Wachstumsraten in den meisten MOEL von 4-7 %, die weltweit mit zu den höchsten zählen. Die höchsten Wachstumsraten wurden in Estland, Lettland und Polen verzeichnet. Wichtigster Motor des Wirtschaftswachstums ist die Inlandsnachfrage, insbesondere im Bereich der Anlageinvestitionen. Der Beitrag des Nettoexports ist leicht negativ, da die Einfuhren stärker gewachsen sind als die Ausfuhren. Im Gegensatz zu der überwiegend positiven Wachstumsentwicklung wurden beim realen BIP- Wachstum in Rumänien und der Tschechischen Republik negative Zahlen verzeichnet, jedoch aus Gründen, die nicht mit dem Rückgang der internationalen Konjunktur zusammenhängen. In Rumänien spielt der Staat in vielen Wirtschaftssektoren immer noch eine zu dominante Rolle. In der Tschechischen Republik sind dagegen weitergehende und tiefergreifende Strukturreformen notwendig, um die zu engen Verflechtungen zwischen Unternehmen und Banken zu lösen. Bulgarien erholt sich zur Zeit von dem jüngsten Konjunkturabschwung und wird in diesem Jahr wieder ein positive Wachstumsrate aufweisen.
Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) haben weiter zugenommen, auch wenn sie sich im Vergleich zu Westeuropa noch gering ausnehmen. Die Länder, in denen Privatisierung und Strukturreformen stetig fortgesetzt werden oder in letzter Zeit beschleunigt wurden, wie in Ungarn, der Tschechischen Republik, Estland, Slowenien, Lettland und Litauen, verzeichneten den höchsten Zufluß an ausländischen Direktinvestitionen pro Kopf der Bevölkerung. Insbesondere Lettland verzeichnete 1997 mit 7,6 % des BIP den höchsten Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in der Region. In Litauen verdoppelten sich die ausländischen Direktinvestitionen 1997 wie im Vorjahr und erreichten 3,4 % BIP. Auch Bulgarien verbuchte eine Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen, wenn auch etwas geringer als 1998. Die in den Stellungnahmen abgegebenen Empfehlungen hatten also entgegen gewissen Befürchtungen, keine Verlagerung der ADI-Ströme zum Nachteil jener Länder zur Folge, mit denen noch keine Beitrittsverhandlungen eingeleitet wurden.
Das Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftparität erreicht in einigen Beitrittsländern fast jenes einiger Mitgliedstaaten: In Slowenien 68 %, in der Tschechischen Republik 63 % des Gemeinschaftsdurchnitts. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich in Lettland, Polen, Ungarn und Litauen. Die Inflationsraten gehen zurück und liegen in Slowenien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Lettland und Litauen im einstelligen Bereich. Die Haushaltsdefizite sind gering, und in einigen Ländern (Estland und - zeitweise - Lettland) wird sogar ein Haushaltsüberschuß verzeichnet.
Die Handelsbilanzen sind negativ, weil die Beitrittsländer sich in einer wirtschaftlichen Aufstiegsphase befinden. Allerdings ist das Handelsdefizit in einigen Ländern (Estland, Lettland, selbst Litauen, Tschechische Republik, Polen und Slowakei) zu hoch. Die Leistungsbilanz befindet sich in Estland, der Slowakei und Litauen tief im Defizit. Die rumänische Auslandsschuld nimmt zu.
Erwartet wird, daß sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Rußland-Krise auf die Beitrittsländer im Augenblick in Grenzen halten werden - vor allem aus zwei Gründen. Zuerst haben die Beitrittsländer vom Beginn ihrer wirtschaftlichen Umstellung an schrittweise und mit Erfolg ihren Handel vom ehemaligen Sowjetblock weg zur EU hin umorientiert. Auf diese Weise haben sie einen hohen Grad der Handelsintegration mit der Union erreicht: insgesamt rund 60 % ihres Handels werden mit der EU abgewickelt. Der zweite, tiefer liegende Grund ist, daß die Perspektive des EU-Beitritts und die stufenweise Übernahme des Acquis communautaire spürbar zu einer günstigen Marktstimmung beigetragen haben.
Dennoch sind die Bedingungen auf den internationalen Kapitalmärkten heute schwieriger.
Vor Ausbruch der Krise erhielten die Beitrittsländer umfangreiche Auslandskredite zu günstigen Konditionen. Heute stellen die Märkte die Mittel nur zu höheren Kosten bereit, wobei die Länder, deren wirtschaftliche Grunddaten als schwach angesehen werden, mit einem stärkeren Aufschlag rechnen müssen als die anderen Länder. Für die Beitrittsländer ergibt sich daraus ein großer Anreiz, die Strukturreform voranzutreiben und die Wirtschaftspolitik zu stärken.
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission eine neue Bewertung nach der gleichen Methode wie zuvor in den Stellungnahmen vorgenommen. Dabei wurden die Fortschritte bei der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien geprüft, um zu einer Gesamtbewertung der bisherigen Leistungen zu gelangen. Die Kriterien wurden auf der gleichen Grundlage wie in der Stellungnahme angewandt. Diese erste Überprüfung berücksichtigt jedoch anderthalbjährige aufmerksame Beobachtungen.
Die Kommission hat in den Stellungnahmen so klar wie möglich dargestellt, wie die Kopenhagener Kriterien zu interpretieren sind. Worauf es aber ankommt, ist das Zusammenspiel und Zusammenwirken aller Bedingungen und ihre sich gegenseitig verstärkende Wirkung auf die Wirtschaft. Hinzu kommt die wichtige Zeitdimension und die Frage der Erfolgsbilanz, die im Rahmen von Agenda 2000 wesentliche Bewertungsfaktoren waren. Unter Erfolgsbilanz ist in diesem Zusammenhang die unumkehrbare, nachhaltige und überprüfbare Durchführung der Reformpolitik über einen ausreichend langen Zeitraum zu verstehen, um eine dauerhafte Veränderung der Erwartungen und des Verhaltens der Wirtschaftsakteure und ein Urteil über die Nachhaltigkeit der Fortschritte zu ermöglichen.
Das Kriterium der funktionsfähigen Marktwirtschaft muß bereits jetzt erfüllt werden, während das zweite Kriterium - die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union standzuhalten - erst auf mittlere Sicht angewandt wird.
V.a) Funktionsfähige Marktwirtschaft
Das Bestehen einer funktionsfähigen Marktwirtschaft wird auf Basis folgender Faktoren bewertet:
- Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird durch das freie Spiel der Markkräfte hergestellt; die Preise sowie der Handel sind liberalisiert;
- Nennenswerte Schranken für den Markteintritt (Gründung von Unternehmen) und den Marktaustritt (Konkurse) bestehen nicht;
- Der Rechtsrahmen ist geschaffen, einschließlich der Regelung der Eigentumsrechte; die Durchsetzung der Gesetze und Verträge ist gewährleistet;
- Die makroökonomische Stabilität ist gewährleistet, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger öffentlicher Finanzen und Außenwirtschaftsbilanzen;
- Breiter Konsens besteht über die Eckpunkte der Wirtschaftspolitik;
- Der Finanzsektor ist ausreichend entwickelt, um die Spargelder in produktive Investitionen zu lenken.
In dem Bericht wird jeder Beitrittskandidat zunächst anhand der erzielten Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen bewertet. Die Kommission vertritt die Ansicht, daß die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Polen und Slowenien als funktionsfähige Marktwirtschaften angesehen werden können. Alle fünf Länder haben im Vergleich zum letzten Jahr weitere Fortschritte gemacht, auch wenn in allen Fällen einige wichtige Faktoren wie etwa die Finanzmärkte noch nicht voll entwickelt sind. Slowenien muß Maßnahmen treffen, um das Funktionieren der Marktmechanismen zu verbessern. Ein sechster Anwärter - die Slowakei - erfüllt die Bedingungen in bezug auf die Rechtsvorschriften und die Systemmerkmale beinahe, jedoch stehen die übertriebene Interventionspolitik des Staates und die fehlende Transparenz nicht im Einklang mit dem Funktionieren einer Marktwirtschaft; zudem hat sich die makroökonomische Situation nach einer Zeit der Stabilität verschlechtert.
Zwei andere Beitrittsländer, Lettland und Litauen, haben wesentliche Fortschritte auf dem Weg zur Marktwirtschaft gemacht. Dank der zügigen Weiterführung dieser Reformen wird Lettland bereits in absehbarer Zukunft in der Lage sein, das erste wirtschaftliche Kriterium zu erfüllen. In diesem Land sind wesentliche Fortschritte in der makroökonomischen Lage und bei der Schaffung der für die Marktwirtschaft erforderlichen Rechtsvorschriften und Verwaltungsstrukturen zu verzeichnen. Die Hemmnisse für den Markteintritt und den Marktaustritt wurden verringert, und es besteht breiter Konsens über die Eckpunkte der Wirtschaftspolitik.
Auch Litauen hat wesentliche Fortschritte gemacht, jedoch ist eine Beschleunigung der noch verbleibenden Reformen notwendig, um die Marktwirtschaft in allen Bereichen einzuführen.
Lettland und in geringerem Maße Litauen nähern sich der Situation Estlands im Jahre 1997, wenn auch in einigen Bereichen die Wirtschaftspolitik und Reformen erst seit kurzem durchgeführt werden, so daß die Kommission heute noch nicht beurteilen kann, ob sie bereits als lebensfähige Marktwirtschaften angesehen werden können.
Bulgarien kann nicht als eine funktionsfähige Marktwirtschaft angesehen werden, auch wenn es bei der Annahme der erforderlichen Maßnahmen und der Herstellung der makroökonomischen Stabilität erhebliche Fortschritte erzielt hat. Die wichtigste Herausforderung für Bulgarien besteht darin, die Durchführung der Rechts- und Verwaltungsreform verstärkt voranzutreiben, das Risiko einer weiteren makroökonomischen Instabilität abzuwenden und einen politischen Kurswechsel zu vermeiden.
Nur in Rumänien hat sich die Lage in bezug auf das erste Kriterium nicht gebessert. Die rumänische Regierung war wegen eines fehlenden politischen Konsenses außerstande, die erforderlichen Maßnahmen zu beschließen. Auch die makroökonomische Lage hat sich verschlechtert.
Insgesamt gesehen haben die Beitrittsländer bei ihrem Übergang zur Marktwirtschaft einschließlich der Privatisierung und Liberalisierung erhebliche Fortschritte erzielt, auch wenn sich ihre wirtschaftliche Lage nach Maßgabe ihrer Ausgangssituation weiterhin erheblich voneinander unterscheidet. Die Länder, in denen vergleichsweise stabile soziale und politische Verhältnisse herrschten und die ein ständiges Engagement für Reformen gezeigt haben, nämlich Ungarn und Polen, machen weiterhin stetige Fortschritte. Das gleiche gilt für Estland. Auch wenn sie dicht folgen, haben die Tschechische Republik und Slowenien nicht das gleiche entschlossene politische Engagement für die marktwirtschaftlichen Reformen unter Beweis gestellt.
V.b) Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften standzuhalten
Das zweite wirtschaftliche Kriterium, d.h. die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Gemeinschaft standzuhalten, setzt eine Reihe von Bedingungen voraus, die in jedem Bericht analysiert werden, und zwar folgende:
- das Bestehen einer funktionsfähigen Marktwirtschaft mit einer ausreichenden makroökonomischen Stabilität, damit die Wirtschaftsbeteiligten in einem stabilen und berechenbaren Umfeld Entscheidungen fällen können;
- eine ausreichende Verfügbarkeit von Human- und Sachkapital einschließlich Infrastruktur (Energieversorgung, Telekommunikation, Verkehr etc.), Bildung und Forschung, sowie die Weiterentwicklung dieser Faktoren;
- das Ausmaß, in dem die Regierungspolitik und die Gesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit über die Handelspolitik, die Wettbewerbspolitik, staatliche Beihilfen, Unterstützung für KMU beeinflussen etc.;
- der Umfang und das Tempo der Handelsintegration des Landes mit der Gemeinschaft vor der Erweiterung. Dieses Kriterium bezieht sich sowohl auf das Volumen als auch auf die Art der Waren, mit denen die betroffenen Länder bereits jetzt Handel mit den Mitgliedstaaten treiben;
- der Anteil der Kleinunternehmen, vor allem deswegen, weil kleine Firmen in der Regel stärker von einem verbesserten Marktzugang profitieren, aber auch deswegen, weil eine Dominanz der Großunternehmen größere Anpassungswiderstände bedeuten kann.
Der Fortschrittsbericht ist für diesen Bereich noch schwieriger zu erstellen als für das erste Kriterium, und zwar aus folgenden Gründen: (i) das Kriterium ist viel komplexer; (ii) das Urteil muß auf mittlere Sicht abgegeben werden; (iii) die Erfüllung dieses Kriteriums wird zum Teil von der Erfüllung des ersten Kriteriums bedingt und (iv) selbst wenn die richtigen Maßnahmen getroffen werden, braucht es Zeit, bis sie auf die Wirtschaft durchschlagen und ihre Fähigkeit, sich im Wettbewerb zu behaupten, entscheidend beeinflussen. Aus diesem Grund ist die Frage der Erfolgsbilanz um so wichtiger.
Die Kommission ist der Ansicht, daß zwei Länder - Ungarn und Polen - ihre Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck standzuhalten, weiter verbessert haben und das zweite Kriterium mittelfristig erfüllen dürften, vorausgesetzt, die laufenden Anstrengungen werden fortgesetzt. Auch Slowenien dürfte in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union mittelfristig standzuhalten, vorausgesetzt, daß es die geplanten Reformen zügig durchführt. Im Fall der Tschechischen Republik kann ebenfalls davon ausgegangen werden, daß sie das zweite Kriterium erfüllen kann, obwohl sie im Vergleich zum letzten Jahr etwas an Boden verloren hat. Mittelfristig bestehen gute Aussichten, daß die Slowakei dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union standhalten kann, sofern die Regierung umgehend Maßnahmen zur Errichtung einer funktionierenden Marktwirtschaft ergreift.
Estland befindet sich in der gleichen Lage, wenngleich die Nachhaltigkeit wegen seiner großen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte ungeachtet der jüngsten Verbesserung nicht gesichert ist.
Lettland hat zwar in letzter Zeit bedeutende Fortschritte gemacht, muß aber die Nachhaltigkeit der Reformen noch unter Beweis stellen. Der Privatisierungsprozeß ist nahezu abgeschlossen. Zusätzliche Anstrengungen sind jedoch notwendig im Bereich der Bankenaufsicht, bei der Steigerung der Wertschöpfung in bestimmten exportorientierten Schlüsselsektoren und bei der Vereinfachung des rechtlichen Umfeldes von Unternehmen.
Vergleichbare Fortschritte sind in Litauen festzustellen, daß aber noch den Privatisierungsprozeß zum Abschluß, bringen, die Reform des Energiesektors vollziehen und dafür sorgen muß, daß das Konkursrecht ordnungsgemäß angewandt wird.
Auch Bulgarien hat in jüngster Zeit gewisse Fortschritte erzielt, wenn auch der Privatisierungsprozeß ins Stocken zu geraten scheint. Zusätzliche Anstrengungen sind notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
In Rumänien hat sich die Situation verschlechtert, da die Regierung bei der Durchführung der Strukturreformen nicht die erforderliche politische Entschlossenheit an den Tag legt. Das Land hat noch einen sehr langen Weg vor sich.
Insgesamt dürften also sechs Länder - Ungarn, Polen, Tschechische Republik, Estland, Slowenien und Slowakei - in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union auf mittlere Sicht standzuhalten. Besondere Wachsamkeit ist jedoch in der Tschechischen Republik notwendig, damit die derzeitigen Reformen in vollem Umfange durchgeführt werden. Estland müßte die erforderliche makroökonomische Politik verfolgen, um das Risiko eines zu hohen Außenhandelsdefizits in Grenzen zu halten. Die Slowakei müßte die anhaltenden Strukturprobleme transparenter und unter Wahrung der Grundsätze einer Marktwirtschaft in Angriff nehmen. Sofern sie die vorgesehenen Reformen verwirklichen, dürften Lettland und Litauen ebenfalls, wenn auch in geringerem Maße, demnächst in der Lage sein, die erforderlichen Fortschritte zu erzielen, um dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union auf mittlere Sicht standzuhalten.
Legt man bei der Beurteilung der Situation beide Kriterien zugrunde, so ist abschließend festzustellen, daß keines der Beitrittsländer die wirtschaftlichen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wie dies bereits zum Zeitpunkt der Stellungnahmen der Fall war. Ungarn und Polen haben die weitesten Fortschritte erzielt, während die Tschechische Republik und Slowenien etwas an Terrain verloren haben, selbst wenn sie weiter sind als die übrigen Länder. Estland hat weiterhin Fortschritte gemacht und kann als Marktwirtschaft angesehen werden. Das Land dürfte in der Lage sein, auf mittlere Sicht dem Wettbewerbsdruck standzuhalten. Lettland und in geringerem Maße Litauen haben kürzlich wesentliche Fortschritte erzielt, erfüllen aber bisher weder das eine noch das andere der beiden Kriterien, vor allem weil viele der Maßnahmen erst in jüngster Zeit getroffen wurden. Bulgarien und Rumänien erfüllen keines der beiden Kriterien. Bulgarien hat zwar erhebliche Fortschritte gemacht und zeigt die erforderliche Entschlossenheit zur Durchführung der Reformen, wobei jedoch die Ausgangssituation sehr niedrig ist. Die Situation in Rumänien hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Nach den Wahlen in der Slowakei ist nunmehr mit einer Änderung der Wirtschaftspolitik zu rechnen, jedoch ist es noch zu früh, um ein Urteil über die Fähigkeit der Slowakei zur Erfüllung der beiden Kriterien auf mittlere Sicht abzugeben.
VI. Gründe für die EU Osterweiterung und Pressestimmen
Die Grenzen Europas
Von Nikolaus Blome
Bis heute war alles recht leicht: Reden, Visionen und allerlei Versprechungen. Nun aber beginnt das wirklich Diffizile an der allemal schwierigsten Erweiterung, die sich die Europäische Union jemals vorgenommen hat der nach Osten, wo die vielen armen Vettern warten. Es wird länger dauern, als alle meinen. Es wird teurer werden, als alle sagen. Und die Ängste sind viel größer, als die meisten befürchten. In Brüssel verhandeln nun Technokraten. Die Politiker dürfen sich jedoch nicht zurückziehen wie sonst, sie dürfen sich nicht verstecken. Denn der Kampf um die Währungsunion sollte eines gelehrt haben: Wer zu Beginn eines Jahrhundertprojektes den Skeptikern und Nörglern das politische Feld überläßt, der muß sehr bald vor allem gegen dieses Versäumnis ankämpfen und immer aus der Defensive heraus.
Dabei wird die Ost-Erweiterung der EU absehbar ein Geschäft für beide Seiten. Für die Ost- und Mitteleuropäer endet mit der Ankunft im Westen die lange Reise durch die Trümmerlandschaft des zerborstenen Ostblocks. Die Aufbauhilfe der EU wird die Marktwirtschaft dort absichern und die Demokratie endgültig verankern. Die Menschen im Osten werden reicher und reifer werden.
Und genau davon profitiert der Westen. Weil Deutschland schon jetzt mehr Handel mit den Osteuropäern treibt als mit Amerika. Weil es einen unschätzbaren Gewinn an Sicherheit und Zivilisiertheit bedeutet, wenn immer mehr Länder Europas ihre Konflikte nach eingeübtem, gemeinsamem Recht austragen. Die Osterweiterung muß kommen, weil sie Sinn macht.
Daran ändern auch die vielen Probleme nichts, von der deutschen Furcht vor ungehemmter Zuwanderung bis zur östlichen Sorge vor totalem Ausverkauf. Hier einen fairen Ausgleich mit langen Übergangsfristen herzustellen, ist mühsam aber letztlich nicht mehr als übliches Verhandlungsgeschäft.
Die tiefste Falle lauert nicht im Kleingedruckten, sondern im bislang Unausgesprochenen. So banal es klingt: Die Erweiterung der Europäischen Union ist kein Selbstzweck. Europa hat eine Grenze. Deshalb gibt es Länder, die jenseits dieser Grenze liegen. Und zwar für immer. Im Falle Rußlands und der Ukraine gilt dies wegen ihrer schieren Größe. Für die Türkei gibt es andere Gründe. Natürlich hat die EU großes Interesse daran, die Türkei zu stabilisieren und an den Westen zu binden. Sie könnte weit mehr tun als bisher geschehen. Immerhin sind die Türken Nachbarn der Europäer und ihre Mitbürger in vielen Staaten zugleich. Vor allem aus militärisch-strategischen Gründen ist die Türkei trotz der Rückständigkeit ihrer Demokratie und Zivilgesellschaft ein gleichberechtigter Partner in der Nato, die eine reine Zweckgemeinschaft mit äußerst engem Focus ist. Die Europäische Union muß aber mehr sein, sonst wäre sie nichts. Wer wie Amerika immer wieder die EU-Aufnahme Ankaras fordert, hat dies nicht begriffen.
80 000 Seiten umfaßt inzwischen der Bestand von Recht und Regeln in der EU. Im Auftrag der Mitglieder greift Brüssel immer tiefer in das tägliche Leben ein zwangsläufig ausgehend von einer Basis westeuropäisch-christlich geprägter Gemeinsamkeiten. Die Türkei hingegen ist ein Land, dessen Alltag vom Islam geprägt wird, auch wenn sich die Politik nach westlichem Muster organisieren will. Das ist eine heikle Balance sie kann gelingen. Allein: Ein Beitritt zur EU kann dabei nicht helfen. Denn beitreten müßte die Türkei wie jeder Kandidat zu den Bedingungen derer, die schon Mitglied sind. Die Liste ist lang. Rein 01 Vom europäischen Auftrag Deutschlands
Hans-Dietrich Genscher über Alfred Grossers Entwurf für die Zukunft des Kontinents
Wenn Alfred Grosser über Deutschland schreibt, ist ihm Aufmerksamkeit sicher. Wer könnte mehr über Deutsche und Franzosen sagen? Wer wäre eher dazu in der Lage, uns Deutsche in den Spiegel sehen zu lassen? Kaum ein anderer schließlich kann den Völkern um uns herum ein Deutschlandbild vermitteln, das derart scharfsinnig und vielschichtig ist.
Alfred Grosser ist ein europäischer Franzose. Schon die erste Seite seines Werkes zeigt, wie tief er Europa versteht und wie er es ganz und gar lebt. Grosser schreibt: "Und dennoch wird ständig so geredet und geschrieben . . . als könnten Deutschland oder Frankreich noch unabhängig von Europa gesehen werden, getrennt von einer Wirklichkeit, die ohne Europa schon längst nicht mehr existiert." Das bezeugt die Unumkehrbarkeit des europäischen Einigungsprozesses und bedeutet eine Abfuhr an die kleinmütigen "Ja-aber-Europäer", welche die Einigung Europas nur als eine leider? unvermeidbare Entwicklung zu sehen scheinen.
Es ist eine Absage an all diejenigen, die nicht erkennen, daß zu der historischen und moralischen Begründung der europäischen Einigung längst die Zukunftsperspektive Europas hinzugetreten ist, die den Völkern unseres Kontinents im Zeitalter der Globalisierung nur gemeinsam eine Chance eröffnet. Eine Absage schließlich an alle, die nicht einsehen wollen, daß die europäische Einigung die Antwort ist auf die Irrwege der Geschichte.
Grosser sagt nein zu der Wahrnehmung Europas als einer fernen bei manchen klingt es schon fast als einer "feindlichen" Macht unter dem Schlüsselwort: Brüssel. Ist es das Bedürfnis nach einem neuen Feindbild? Oder was ist der Grund, alles, was in Brüssel geschieht, nicht als Teil einer europäischen, von uns mitgestalteten Wirklichkeit zu empfinden? Wer zu dem einfachen "wir Europäer" findet, wird alles, was verbesserungswürdig ist in Brüssel, als seine eigene Sache betrachten.
Alfred Grosser beläßt es nicht bei oberflächlichen Betrachtungen, er mahnt, man dürfe Deutschlands "vielschichtige Vergangenheit nicht außer acht lassen, die weiterhin die heutigen Einstellungen, Auffassungen und das politische Verhalten mitbestimmt". Meisterhaft beschreibt er die deutschen Verflechtungen mit dem europäischen Schicksal. Er verdeutlicht, warum die Feststellung zutrifft, "uns Deutschen hat unsere Geschichte nie allein gehört, und sie wird uns auch nie allein gehören". Das ist historische Erfahrung und realistische Zukunftsperspektive. Grosser setzt sich mit der Identität der Deutschen auseinander und natürlich auch mit jenem verdächtigen Streben nach Normalität für Deutschland.
Er zeigt ein tiefes Verständnis für die ethische Begründung der Bundesrepublik, wie sie in dem alles überragenden Artikel 1 des Grundgesetzes von der Unantastbarkeit der Würde des Menschen definiert wird. Ein Deutschland, das verpflichtet ist auf die Grundwerte unserer Verfassung und das in dieser Verpflichtung der westlichen Wertegemeinschaft zugehört. Die Bundesrepublik, so schreibt er, habe nach dem gesamtdeutschen Unglück von 1945, nach dem zusätzlichen Unglück der Teilung das enorme Glück, nicht auf dem Begriff der Nation aufgebaut worden zu sein, sondern auf dem Begriff der politischen Ethik. Der Verfassungspatriotismus, der die Bundesrepublik zuallererst in ihrer Wertorientierung versteht, ist aus Sicht des Europäers Alfred Grosser ein Vorzug, nicht ein Mangel.
Welten trennen ihn von denjenigen, die dafür plädieren, Deutschland müsse endlich zur Normalität finden. Er beschreibt es als Aufgabe Deutschlands, am Aufbau Europas mitzuwirken und nicht "rückfällig normal" zu werden. Darin liegt der Schlüssel für das europäische Deutschland, das Thomas Mann forderte. Es ist das europäische Deutschland, das dem Auftrag unserer Verfassung entspricht, mitzuwirken an der Einigung Europas. Hier erinnert Grosser an den großen französischen Schriftsteller und Diplomaten Paul Claudel, der 1945 in seinem Brief an die Deutschen schrieb: "Deutschland ist nicht dazu da, die Völker zu spalten, sondern sie um sich zu versammeln. Seine Rolle ist es, Übereinstimmung zu schaffen all die unterschiedlichen Nationen, die es umgeben, spüren zu lassen, daß sie ohne einander nicht leben können."
Wie könnte man besser die europäische Berufung Deutschlands beschreiben. Seine Grundwerteverpflichtung ist es, die Deutschland in das vereinte Europa einbringen kann. Das ist kein Sonderweg, sondern ein Beitrag zur politischen Ethik der Europäischen Union und zu der neuen Kultur des Zusammenlebens großer und kleiner Staaten in der EU. Im Bewußtsein des Europas der Freiheit, das heute unsere Völker verbindet, erinnert Grosser an die Rede François Mitterrands 1988, als er, zu Erich Honecker gewandt, im Elysée-Palast sagte: "Denn wie könnten sich die Europäer über den Frieden einigen, wenn sie sich über die Freiheit trennen?"
Für Alfred Grosser ist die Europäische Union mehr als nur eine wirtschaftliche Organisation.
Immer wieder mahnt er, die geistige und kulturelle Dimension der europäischen Einigung nicht zu vergessen. Er erinnert an das Wort Jean Monets: "Hätte ich es gewußt, ich hätte mit der Kultur begonnen."
Natürlich hat Grosser recht, wenn er sagt, Gott sei Dank habe sich Monet anders verhalten, sonst wären wir in der europäischen Union noch nicht soweit gekommen. Doch das soll der Bedeutung der europäischen Kultur für die Einigung Europas nichts von ihrem Gewicht nehmen. Gottlob hat der oft gescholtene Vertrag von Maastricht endlich der Kultur "ihren" Artikel eingeräumt. Diese kulturelle Dimension der europäischen Einigung, zu der die Achtung vor der Kultur aller Völker gehört, ist die beste Garantie gegen die menschenverachtende Intoleranz, zu deren schrecklichster Form der Antisemitismus und die Vernichtung des europäischen Judentums in der Zeit des Dritten Reiches wurden.
Beeindruckend ist Grossers Verständnis der deutschen Vereinigung. Er bekennt sich ausdrücklich zu dem Begriff "Vereinigung", weil er das Restaurative, das in dem Wort "Wiedervereinigung" liegen kann, zumindest als Möglichkeit und damit auch als Bedrohung erkennt. Im deutschen Einigungsprozeß schien diese Gefahr in der Auseinandersetzung um die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze aufzuleuchten gewiß zu Unrecht.
Heute müssen wir wissen: Sie taucht immer wieder auf, wenn die Aufnahme Polens in die EU von der Erfüllung deutscher Sonderforderungen abhängig gemacht werden soll. Vor allem aber sieht Grosser die deutsche Vereinigung in ihrer europäischen Dimension: So wie die deutsche Politik in den Jahren 1989 und 1990 immer wieder darauf hingewiesen hat, daß die Vereinigung des Kontinents sich nicht um Deutschland herum vollziehen könne, so muß genauso bewußt sein, daß die deutsche Vereinigung nur als Teil der europäischen Einigung möglich wurde. Deshalb ist für den Autor die Aufnahme der neuen Bundesländer in die Bundesrepublik und damit auch in die Europäische Union eine doppelte Osterweiterung: sowohl der Bundesrepublik als auch der EU.
Besser kann man die Verbindung deutschen und europäischen Schicksals nicht beschreiben. Doch Grosser verweist gleichzeitig auf den grundlegenden Unterschied: Für Deutschland sei es das Ende seiner Erweiterung gewesen das ist das Verlangen nach Klarheit in der Grenzfrage , für die EU aber sei es nur der Anfang.
Beim Lesen dieses Kapitels erinnerte ich mich der Worte des jetzigen polnischen Außenministers Bronislaw Geremek, der mir am Morgen des 10. November 1989, wenige Stunden nach der Öffnung der Mauer in Berlin, sagte: "Wenn Deutschland vereinigt sein wird, werden wir Polen Nachbarn der Europäischen Gemeinschaft sein."
Wie sehr Alfred Grosser die Werteentscheidung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg verinnerlicht hat, bringt er mit der Kritik an dem Begriff "Westbindung" zum Ausdruck: Denn Deutschland sei nicht an die Europäische Gemeinschaft angebunden, sondern in sie eingebunden also der westlichen Staatengemeinschaft integral zugehörig.
Diese Tatsache ist für ihn auch der Schlüssel zum Verständnis des vereinten Landes. Weil diese Einbindung eine Werteentscheidung war, führte das Hinzutreten der östlichen Bundesländer zur Erweiterung der Gemeinschaft und nicht zur Herauslösung der Bundesrepublik aus der westlichen Wertegemeinschaft. Die europäische Berufung verhinderte den Sonderweg Deutschlands.
Wie wenige geht Alfred Grosser den Spuren nach, die die Teilung Deutschlands hinterlassen hat. Er rügt nicht nur westdeutsche Ignoranz gegenüber den Bürgerrechtlern in der früheren DDR, er kritisiert genauso das blauäugige Verhalten französischer Intellektueller. Wenn sich Grosser, der in Frankfurt geborene, vor den Nationalsozialisten geflohene Jude, der sehr wohl zu unterscheiden weiß zwischen den beiden Diktaturen in Deutschland, wenn er sich auseinandersetzt mit Verstrickungen zu DDR-Zeiten, dann tut er das mit großer Sensibilität und dem Bemühen um Gerechtigkeit.
Grosser versteht, daß mit der Zugehörigkeit Deutschlands zur Gemeinschaft westlicher Demokratien eine Politik vollendet wurde, die diese Zugehörigkeit stets als eine unumkehrbare Werteentscheidung begriff. Sie schloß sämtliche Sonderwege Deutschlands zur Vereinigung aus. Mit dieser Aussage wird verständlich, warum die These von der Wirtschafts- und Währungsunion als Preis für die deutsche Einheit so gefährlich ist.
Die Entscheidung für die Währungsunion war im Prinzip schon 1988 getroffen. Ihre Rücknahme nach der Vereinigung allerdings hätte allen deutschen wie europäischen Interessen zuwidergehandelt. Zudem hätte sie bei unseren Nachbarn alte Ängste neu belebt. Eindrucksvoll hebt der Verfasser die Wirkung des Nato-Doppelbeschlusses hervor, wenn er sagt, letztlich habe diese Entwicklung zur Einheit der Deutschen beigetragen. Aus dem Munde Michail Gorbatschows wissen wir längst, daß es genau so war. Unsere Verbündeten werden erkennen, was es bedeutete, daß die Anregung zum Nato- Doppelbeschluß von deutscher Seite ausging, und wie wichtig es war, daß dieser Doppelbeschluß in der Bundesrepublik verwirklicht wurde. Die Sowjets bekamen dadurch nicht nur ihre Grenzen gezeigt, sie erhielten auch die Chance, sich zu einer Politik der Abrüstung und Zusammenarbeit zu bekennen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Kosten und Nutzen einer EU-Osterweiterung, die Herausforderungen der Integration der OME-Staaten (Ostmitteleuropa) in ein demokratisches marktwirtschaftliches Europa nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme. Sie betont das fundamentale Interesse Westeuropas an einer erfolgreichen Transformation dieser Länder, da wirtschaftliche Prosperität und funktionierende Demokratie Grundvoraussetzungen für Stabilität sind.
Welche Voraussetzungen müssen für einen EU-Beitritt erfüllt sein?
Die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt basieren auf der Pariser Charta (1990) und dem Maastrichter Vertrag (1992) und wurden in den Kopenhagener Kriterien (1993) konkretisiert. Diese umfassen politische Kriterien (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Schutz von Minderheiten), wirtschaftliche Kriterien (funktionierende Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit) und die Übernahme des Besitzstandes der Union (aquis communautaire).
Wie werden die politischen Kriterien in den Beitrittsländern umgesetzt?
Die Kommission bewertet die institutionelle Stabilität, die Achtung der Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten. Viele Bewerberländer erfüllen diese Kriterien, aber es gibt noch Mängel in der Justiz, Korruptionsbekämpfung und beim Schutz von Minderheiten, insbesondere der Sinti und Roma.
Wie werden die wirtschaftlichen Kriterien in den Beitrittsländern umgesetzt?
Die Kommission bewertet die Fortschritte beim Übergang zur Marktwirtschaft, das Wirtschaftswachstum, die ausländischen Direktinvestitionen, das Pro-Kopf-BIP, die Arbeitslosigkeit, die Inflation und die Haushaltsdefizite. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern, aber insgesamt haben sie Fortschritte erzielt. Die Auswirkungen der Russland-Krise werden als begrenzt eingeschätzt.
Was sind die Faktoren für eine funktionsfähige Marktwirtschaft?
Die Faktoren für eine funktionsfähige Marktwirtschaft umfassen das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, liberalisierte Preise und Handel, keine nennenswerten Marktzutritts- und -austrittsbarrieren, einen Rechtsrahmen, makroökonomische Stabilität, breiten Konsens über die Wirtschaftspolitik und einen ausreichend entwickelten Finanzsektor.
Was bedeutet die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck standzuhalten?
Die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck standzuhalten, erfordert eine funktionsfähige Marktwirtschaft, ausreichende Human- und Sachkapitalausstattung (einschließlich Infrastruktur, Bildung und Forschung), eine wettbewerbsfähige Regierungspolitik und Gesetzgebung, einen hohen Grad der Handelsintegration mit der EU und einen hohen Anteil an Kleinunternehmen.
Welche Länder erfüllen die wirtschaftlichen Kriterien am besten?
Ungarn und Polen haben die weitesten Fortschritte erzielt, während die Tschechische Republik und Slowenien etwas an Terrain verloren haben. Estland kann als Marktwirtschaft angesehen werden und dürfte in der Lage sein, auf mittlere Sicht dem Wettbewerbsdruck standzuhalten.
Welche Gründe sprechen für die EU-Osterweiterung?
Die EU-Osterweiterung sichert die Marktwirtschaft und Demokratie in Osteuropa ab. Sie profitiert dem Westen durch verstärkten Handel und mehr Sicherheit.
Was sind die Grenzen Europas?
Es gibt Länder, die jenseits der EU-Grenzen liegen. Rußland, die Ukraine und die Türkei werden langfristig keine EU-Mitglieder sein, aber die EU kann die Türkei stabilisieren.
Was sind die wichtigsten Aspekte der EU-Mitgliedschaft für Deutschland?
Deutschland soll seinen Auftrag zur Einigung Europas wahrnehmen. Der Verfassungspatriotismus ist ein Vorzug für die Wertorientierung. Die Vereinigung ist Teil der europäischen Einigung.
- Quote paper
- Kevin Müller (Author), 1998, Die EU-Osterweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94729