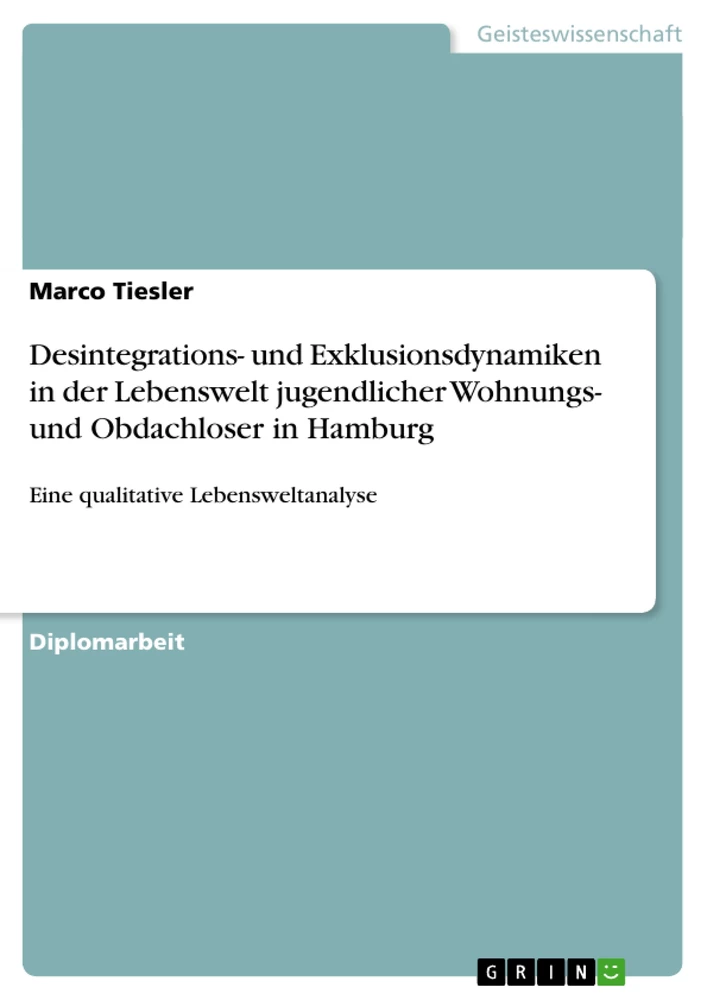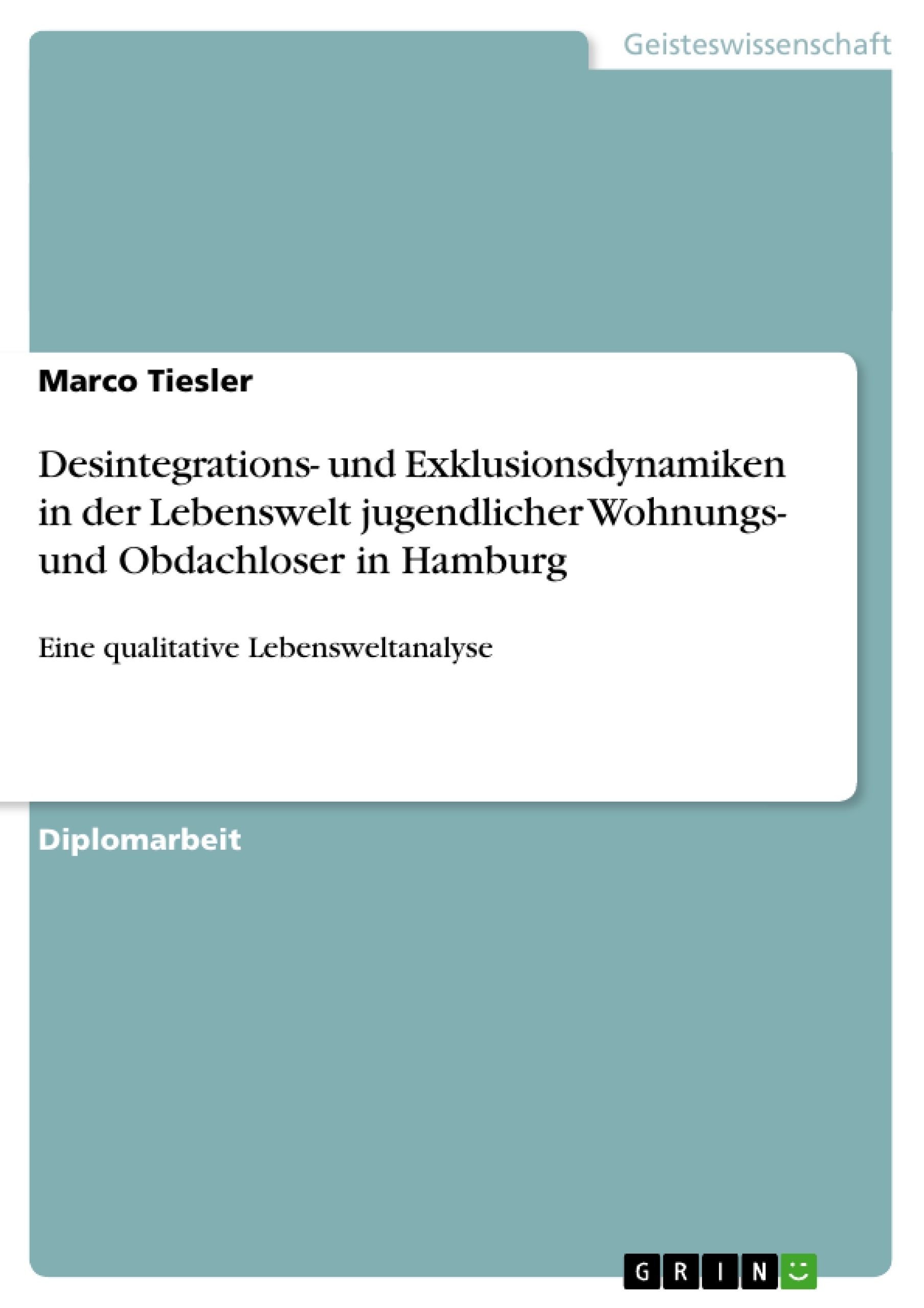Das Untersuchungsthema befasst sich mit dem sozialen Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Die Betroffenen stellen eine im höchsten Maße benachteiligte Gruppen im sozialstrukturellen Gefüge dar. Angelehnt an ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt der Universität Hamburg, befasst sich die vorliegende Arbeit sodann mit der Frage, inwiefern von einer desintegrierten oder exkludierten Lebenslage jugendlicher Obdach- und Wohnungsloser gesprochen werden kann. Ist davon auszugehen, dass desintegrative Tendenzen letztlich in einer exkludierten Soziallage münden, stellt sich die Frage, worin diese sich explizit ausdrückt. Was kennzeichnet den Kern der Ausgrenzung und wodurch unterscheidet er sich zu einer desintegrierten Positionierung im sozialstrukturellen Rahmen? Die forschungsleitende These lautet indes: "Je länger der Zustand der Wohnungslosigkeit und/oder Obdachlosigkeit anhält, desto umfassender wirkt der Prozess der sozialen Exklusion, der einen Ausstieg aus der Prekarität erschwert."
Beginnend mit der Beschreibung der bereits wissenschaftstheoretischen Position einer kritischen Theorie der Gesellschaft (II.Kapitel), werden folgend methodologische Fragen der qualitativen und quantitativen Sozialforschung vorgestellt und kritisch gegeneinander abgegrenzt (III.Kapitel).
Anschließend wird das soziale Problem der Wohnung-und Obdachlosigkeit anhand bisheriger
Forschungsergebnisse (IV.Kapitel). Überdies werden die gängigen sozialwissenschaftlichen Konzepte der
Integration, Desintegration und Exklusion theoretisch dargelegt (V. Kapitel). An diese theoretischen Grundlegungen schließt sich nachstehend die empirische Analyse der vor-liegenden Forschungsarbeit an.
Eingangs werden die Methoden der Datenerhebung (in diesem Fall sind es leitfadenbasierende Interviews) theoretisch nachgezeichnet und zudem die forschungsspezifischen Aspekte der vorliegenden Ausarbeitung (die spezifischen Forschungsfragen, Forschungshypothese, Forschungsprozess) hergeleitet (VI.Kapitel).
Woraufhin sich die Datenauswertung des empirischen Materials anhand der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse anschließt (VII.Kapitel). Ziel der inhaltsanalytischen Auswertung wird es indes sein, den Umschlag zwischen Desintegration und Exklusion in der Lebenssituation der betroffenen Jugendlichen am Textmaterial nachzuweisen.
Außerdem werden Auswege aus der Malaise sozialer Benachteiligung, respektive sozialer Ausgrenzung aufgezeigt (VIII. Kapitel).
Inhaltsverzeichnis
- THEORETISCHE EXPLIKATIONEN
- EINLEITUNG
- WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN: DIE KRITISCHE THEORIE DER GESELLSCHAFT ALS WELTERSCHLIEBENDE KRITIK
- Prolog
- Kritische und Traditionelle Theorie: Ein Kontrast in mehreren Gesichtspunkten
- In welchem Bedeutungszusammenhang findet die Kategorie der Kritik Verwendung?
- Verknüpfung oder Separation von Objekt und Subjekt? Oder: Wie ist Erkenntnis objektivierbar?
- Ein kurzer Exkurs zu den paradigmatischen Kernpunkten des Kritischen Rationalismus nach Karl R. Poppers
- Das Verhältnis von Theorie und Praxis: Welche gesellschaftliche Stellung besitzt Wissenschaft und inwieweit darf sie überhaupt Stellung beziehen?
- Ist das Subjekt oder die zu vermittelnde Subjekt-Objekt-Relation Gegenstand der wissenschaftlichen Analyse?
- Inwiefern spiegelt Wissenschaft die verdinglichten Verhältnisse wider?
- Das grundlegende Postulat der kritischen Theorie der Gesellschaft
- Theorieimmanente Ausgangspunkte der kritischen Theorie
- Welche Divergenz wird zwischen den theoretischen Implikationen und der praktischer Realisierung in den Studien der alten kritischen Theorie deutlich?
- Jürgen Habermas als Protagonist der neuen kritischen Theorie
- Die kommunikationstheoretische Wende der Dialektik der Aufklärung, hin zu einer neuen kritischen Theorie der Gesellschaft
- Theorie und Praxis: Habermas und das Moment des Sozialen
- Ein kurzer Exkurs zur Kritik an Adorno und Michel Foucault
- Erkenntnis und Interesse: Die Logik der Forschung
- Kommunikatives Handeln: Das Fundament des Sozialen
- Die Sphären der gesellschaftlichen Reproduktion: Lebenswelt und System
- Die Kolonialisierung der Lebenswelt
- Strukturwandel der Öffentlichkeit: Der herrschaftsfreie Dialog mündiger Bürger als Gewähr des Sozialen und Korrektiv der systemischen Kolonialisierung
- Kritische Fragen an eine neue kritische Theorie
- Epilog
- METHODOLOGISCHE EXPLIKATION: QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG IM LICHTE EINER KRITISCHEN GESELLSCHAFTSTHEORIE
- Prolog
- Der kontextuelle Bezug der Sozialforschung
- Methodologische Ausgangs- und Abgrenzungspunkte zwischen den Paradigmen der Qualitativen und Quantitativen Sozialforschung
- Das Lebensweltkonzept als theoretischer Bezugsrahmen der qualitativen Analyse
- Methodologische Implikationen der Qualitativen und Quantitativen Forschungsrichtungen
- Deduktives Erklären vs. Induktives Verstehen
- Theoriegenerierung vs. Theorieprüfung
- Unterschiede innerhalb der Datenerhebung
- Prinzipien der Qualitativen Sozialforschung
- Offenheit im theoretischen und methodischen Zugang zum Feld
- Forschung als Kommunikation
- Reflexivität des Forschers
- Explikation des flexiblen Untersuchungsverlaufs
- Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung
- Verfahrensdokumentation
- Regelgeleitetheit
- Gegenstandsangemessenheit und Indikation
- Empirische Verankerung
- Argumentative Interpretationsabsicherung
- Triangulation
- Resümierender Exkurs
- Epilog
- SOZIOLOGIE SOZIALER PROBLEME: DAS SOZIALE PROBLEM DER WOHNUNGS- UND OBDACHLOSIGKEIT IM SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS
- Prolog
- Die Soziologie sozialer Probleme
- Wesensmerkmale der Soziologie sozialer Probleme
- Der Begriff des Soziales Problems im Kontext alltagssprachlicher Verwendung
- Das Soziale Problem als sozialwissenschaftliche Kategorie
- Das soziale Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit
- Forschungsstand: Wohnungs- und Obdachlosigkeit im wissenschaftlichen Diskurs
- Jugendliche Betroffene als besondere Problemgruppe
- Epilog
- DESINTEGRATIONS- UND EXKLUSIONSDYNAMIKEN IM SPIEGEL EINER KRITISCHEN GESELLSCHAFTANALYSE: DER VEREINSEITIGUNG - WIDER DER ENTFALTUNG EINES VERNÜNFITGEN ALLGEMEINEN PRÄLUDIUM
- Prolog
- Die Frage nach der gelungenen Integration
- Gegenstand des sozialwissenschaftliches Diskurses: die Integrationsfrage
- Die Abgrenzung des Integrationsbegriff
- Die überflüssige Frage nach der gelungenen Integration?
- Das Selbstverständnis der Moderne im Spiegel der Integrationsproblematik
- Drei forschungsrelevante Dimensionen einer gelungenen Integration
- Desintegrative Tendenzen: im Bannkreis zwischen Integration und Exklusion
- Überlegungen zum Desintegrationsansatz
- Desintegration und ihre Vermittlung durch Anerkennungsbilanzen
- Anerkennungstheoretische Ebenen des Desintegrationsansatzes
- Die Folgen von Anerkennungsbeschädigungen
- Operationalisierung von Desintegrationstendenzen
- Exklusion: Die paradoxe Gleichzeitigkeit des Drinnen und Draußen
- Das gut Gewissen der Aufklärung: das Soziale Bewusstsein
- Die underclass-debate: Ein urbanes sozialräumliches Phänomen
- Zum Begriff der exclusion: Ausschluss trotz Integration
- Die forschungsleitende Exklusionsfigur
- Exkurs: Desintegrations- und Exklusionsdynamiken im Spiegel der kritischen Theorie, oder: Die Einbeziehung des Anderen
- Epilog
- Die kritische Theorie der Gesellschaft als theoretischer Rahmen
- Die Bedeutung von Integration und Desintegration in der modernen Gesellschaft
- Anerkennung und ihre Rolle bei der Entstehung von Exklusion
- Die Herausforderungen der Wohnungs- und Obdachlosigkeit für Jugendliche
- Die Folgen von Desintegration und Exklusion für die Betroffenen
- Theoretische Explikationen: Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die kritische Theorie der Gesellschaft. Es untersucht die Unterschiede zwischen kritischer und traditioneller Theorie und erläutert die zentralen Konzepte von Jürgen Habermas.
- Methodologische Explikation: In diesem Kapitel wird die qualitative Sozialforschung als methodischer Ansatz im Kontext der kritischen Gesellschaftstheorie vorgestellt. Es werden die spezifischen Prinzipien und Gütekriterien der qualitativen Forschung erläutert.
- Soziologie sozialer Probleme: Dieses Kapitel beleuchtet das soziale Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit im wissenschaftlichen Diskurs. Es untersucht die Forschungsliteratur zu diesem Thema und hebt die besonderen Herausforderungen für junge Menschen hervor.
- Desintegrations- und Exklusionsdynamiken im Spiegel einer kritischen Gesellschaftsanalyse: Dieses Kapitel fokussiert auf die Desintegrations- und Exklusionsdynamiken in der Gesellschaft. Es analysiert die Ursachen und Folgen von sozialer Ausgrenzung und beleuchtet die Rolle von Anerkennung und ihren Folgen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Desintegrations- und Exklusionsdynamiken bei jugendlichen Wohnungs- und Obdachlosen in Hamburg. Die Arbeit analysiert die Problematik aus der Perspektive der kritischen Theorie und untersucht die gesellschaftlichen Mechanismen, die zu sozialer Ausgrenzung führen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe Desintegration, Exklusion, kritische Theorie, Anerkennung, Lebenswelt, System, Wohnungslosigkeit, Jugend, Hamburg. Die Forschungsarbeit untersucht die Ursachen und Folgen der sozialen Ausgrenzung von jugendlichen Wohnungs- und Obdachlosen in Hamburg im Lichte der kritischen Theorie.
- Quote paper
- Marco Tiesler (Author), 2008, Desintegrations- und Exklusionsdynamiken in der Lebenswelt jugendlicher Wohnungs- und Obdachloser in Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94671