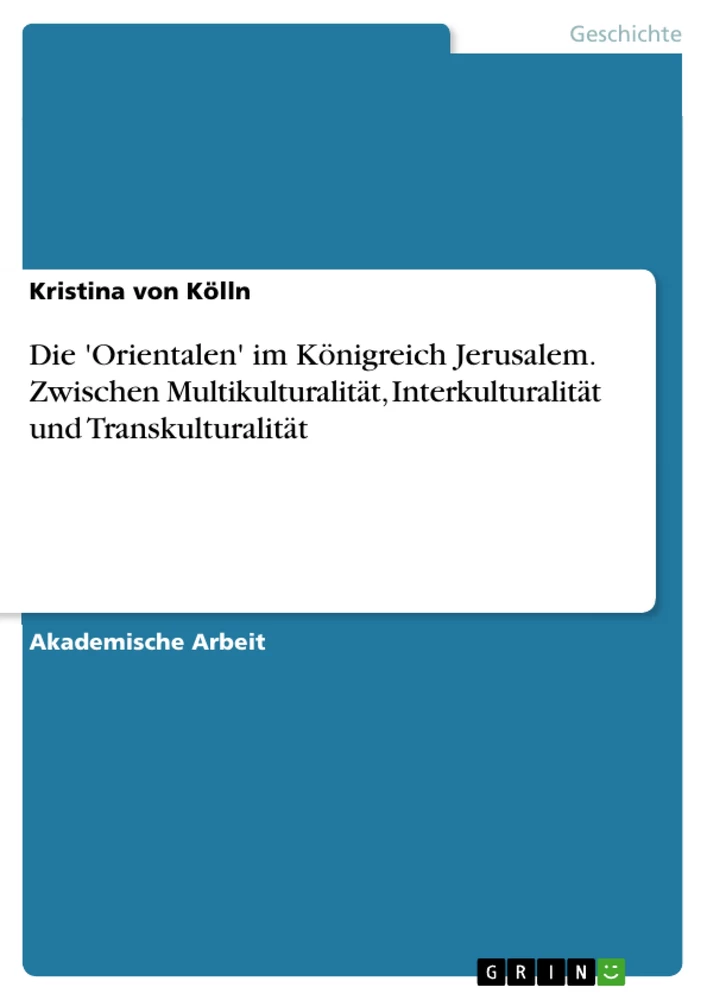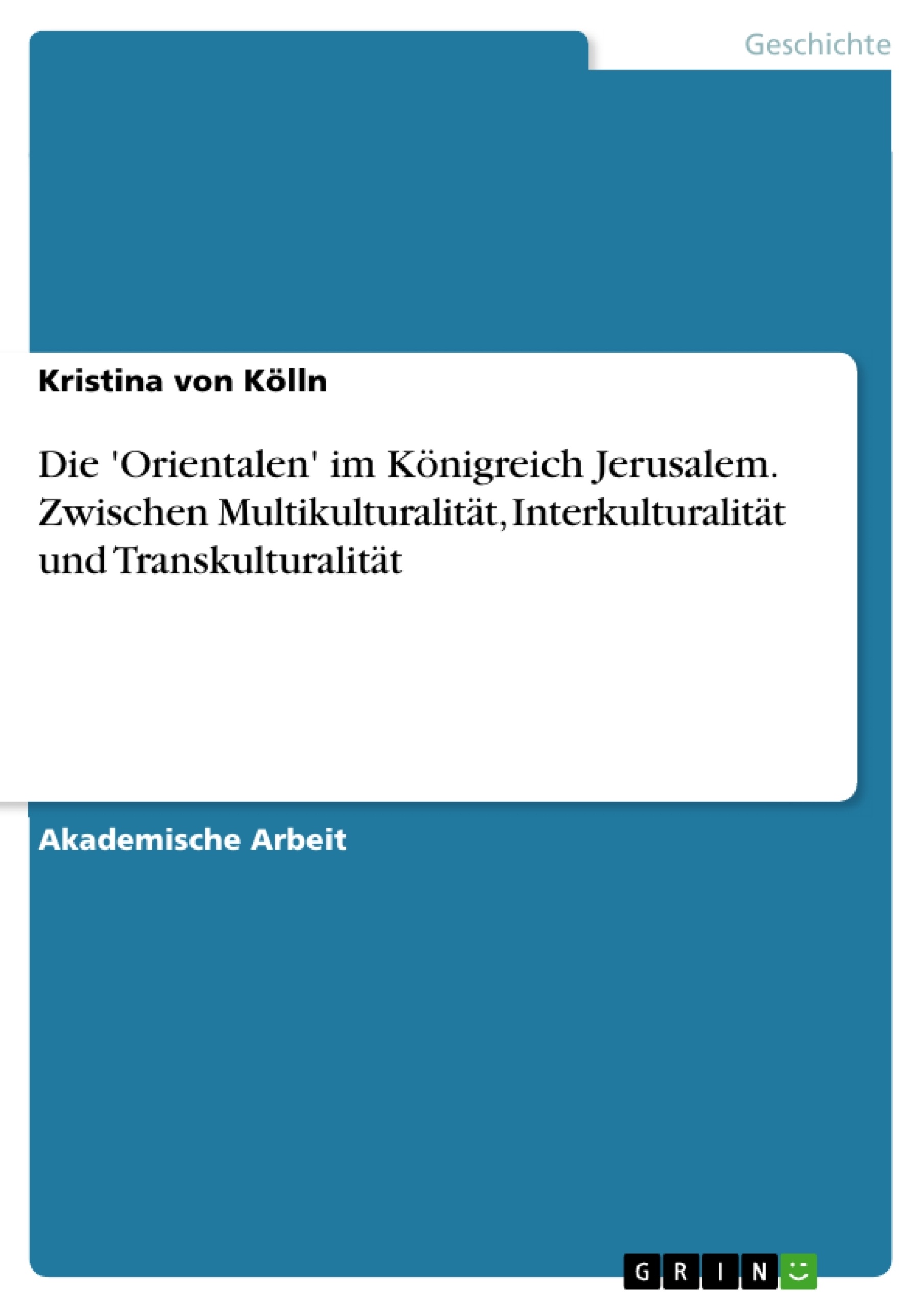Oft wird von den Kreuzfahrerstaaten als multikultureller Gesellschaft gesprochen. Diese Arbeit wollte jedoch ein differenzierteres Bild schaffen, indem sie der Frage nachging, ob die von Fulcher von Chartres gepriesenen Orientalen nicht viel eher als ein Beispiel für Transkulturalität gelten.
Im vorherigen Kapitel konnten verschiedene Merkmale einer Assimilation der Orientalen in die einheimische Gesellschaft nachgewiesen werden. Der finale Schritt zur vollkommenen Assimilation eines Vollbürgers ließ sich jedoch nicht nachweisen. Eine Anpassung der Orientalen an die einheimische Kultur ist unstrittig, doch von einer vollkommenen Integration, unter der Aufgabe eigener Kulturgüter, kann anhand der vorliegenden Quellen nicht gesprochen werden. Die Orientalen haben sich weiterhin auch auf ihre europäischen Wurzeln bezogen, sprachen neben den einheimischen Sprachen weiterhin die Sprache ihrer Väter und blieben lateinische Christen. Sie lebten somit als ‚kulturelle Mischlinge‘ – und damit als personifizierte Transkulturalität – die „in ihrer kulturellen Formation durch mehrere kulturelle Herkünfte und Verbindungen bestimmt“77 waren. Wie bereits zuvor beschrieben, ermöglichte ihnen diese innere Hybridität langfristig höchstwahrscheinlich ein leichteres Wandeln in einer so vielschichtigen Gesellschaft wie der des Königreichs Jerusalem.
Aufgrund der dünnen Quellenlage, sowie des begrenzten Umfangs dieser Arbeit, kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es sich auch bei den Orientalen um eine heterogene Gruppe handelte und man bestenfalls verallgemeinernde Aussagen treffen kann. Dennoch scheinen sowohl Selbstwahrnehmung als auch Fremdwahrnehmung der Orientale die Theorie der Transkulturalität, im Gegensatz zur Multikulturalität, zumindest zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gesellschaft im frühen Königreich Jerusalem
- Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität
- Historiographische Bewertungslage
- Die Orientalen
- Die Orientalen im Spiegel zeitgenössischer Quellen
- Fulcher von Chatres
- Jakob von Vitry
- Usama Ibn Munqidh
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vermeintliche Multikulturalität im Königreich Jerusalem, insbesondere die Rolle der „Orientalen“. Sie hinterfragt gängige Interpretationsmuster und beleuchtet das Zusammenleben verschiedener Kulturen unter den Aspekten von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität. Die Analyse stützt sich auf zeitgenössische Quellen und historische Forschung.
- Definition und Einordnung der „Orientalen“ im Königreich Jerusalem
- Analyse des kulturellen Austauschs und der Interaktionen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen
- Bewertung der historiografischen Debatte über Multikulturalität im Heiligen Land
- Untersuchung der Begriffe Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität im Kontext des Königreichs Jerusalem
- Anwendung der Assimilationstheorie zur Beurteilung des kulturellen Zusammenlebens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der vermeintlichen Multikulturalität im Königreich Jerusalem ein und skizziert den Wandel der Interpretationen dieses Zusammenlebens von einer Assimilation über Segregation bis hin zu einem „Sowohl-als-auch“-Modell. Die Arbeit fokussiert sich auf die „Orientalen“ und untersucht deren Rolle im Kontext von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität. Die Methodik und die Forschungsfragen werden präzise definiert.
Die Gesellschaft im frühen Königreich Jerusalem: Dieses Kapitel beschreibt die ethnische und religiöse Vielfalt der Gesellschaft im frühen Königreich Jerusalem anhand zeitgenössischer Quellen wie Johannes von Würzburg und Wilhelm von Tyrus. Es betont die zahlenmäßige Überlegenheit der einheimischen Bevölkerung (Muslime und Christen) gegenüber den europäischen Kreuzfahrern und deren anfängliche Schwierigkeiten, eine loyale Untertanenschaft aufzubauen. Die Kapitel beschreibt die Entstehung einer feudalen Gesellschaft, die sowohl europäische als auch lokale Strukturen integrierte, z.B. das daman-System in der Landwirtschaft. Die heterogene Zusammensetzung der Gesellschaft bildet die Grundlage für die spätere Untersuchung des kulturellen Austauschs.
Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität nach Wolfgang Welsch und diskutiert die Einschätzung von Marie-Luise Favreau-Lilie zur Abwesenheit einer wirklich gleichberechtigten und konfliktfreien Gesellschaft im Königreich Jerusalem. Es bildet den theoretischen Rahmen für die Analyse der Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Königreich Jerusalem und dient als Grundlage für die nachfolgende Interpretation der Quellen.
Schlüsselwörter
Königreich Jerusalem, Orientalen, Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität, Kreuzfahrer, Assimilation, mittelalterliche Gesellschaft, zeitgenössische Quellen, Fulcher von Chartres, Jakob von Vitry, Usama ibn Munqidh.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die vermeintliche Multikulturalität im Königreich Jerusalem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die vermeintliche Multikulturalität im Königreich Jerusalem, insbesondere die Rolle der „Orientalen“. Sie hinterfragt gängige Interpretationsmuster und beleuchtet das Zusammenleben verschiedener Kulturen unter den Aspekten von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität anhand zeitgenössischer Quellen und historischer Forschung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Einordnung der „Orientalen“, der Analyse des kulturellen Austauschs zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, der Bewertung der historiografischen Debatte über Multikulturalität im Heiligen Land, der Untersuchung der Begriffe Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität im Kontext des Königreichs Jerusalem und der Anwendung der Assimilationstheorie zur Beurteilung des kulturellen Zusammenlebens.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf zeitgenössische Quellen wie Johannes von Würzburg, Wilhelm von Tyrus, Fulcher von Chartres, Jakob von Vitry und Usama ibn Munqidh. Die Arbeit bezieht sich außerdem auf die historische Forschung und die theoretischen Arbeiten von Wolfgang Welsch und Marie-Luise Favreau-Lilie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Gesellschaft im frühen Königreich Jerusalem, ein Kapitel zu Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität, ein Kapitel zur Analyse der „Orientalen“ in zeitgenössischen Quellen und ein Fazit. Sie enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter „Orientalen“ verstanden?
Die Arbeit definiert und ordnet den Begriff „Orientalen“ im Kontext des Königreichs Jerusalem ein. Es wird untersucht, wie diese Gruppe in zeitgenössischen Quellen dargestellt wird und welche Rolle sie im kulturellen Austausch spielte.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die theoretischen Ansätze von Wolfgang Welsch zur Unterscheidung von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität. Sie diskutiert auch die Einschätzung von Marie-Luise Favreau-Lilie zur Gesellschaft im Königreich Jerusalem und wendet die Assimilationstheorie an.
Welche Aspekte der Gesellschaft im Königreich Jerusalem werden beleuchtet?
Die Arbeit beschreibt die ethnische und religiöse Vielfalt der Gesellschaft, die zahlenmäßige Überlegenheit der einheimischen Bevölkerung, die anfänglichen Schwierigkeiten der Kreuzfahrer, eine loyale Untertanenschaft aufzubauen, und die Entstehung einer feudalen Gesellschaft, die europäische und lokale Strukturen integrierte (z.B. das daman-System).
Wie wird die historiographische Debatte berücksichtigt?
Die Arbeit bewertet die historiographische Debatte über Multikulturalität im Heiligen Land und untersucht den Wandel der Interpretationen des Zusammenlebens im Königreich Jerusalem von einer Assimilation über Segregation bis hin zu einem „Sowohl-als-auch“-Modell.
- Arbeit zitieren
- Kristina von Kölln (Autor:in), 2019, Die 'Orientalen' im Königreich Jerusalem. Zwischen Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/945744