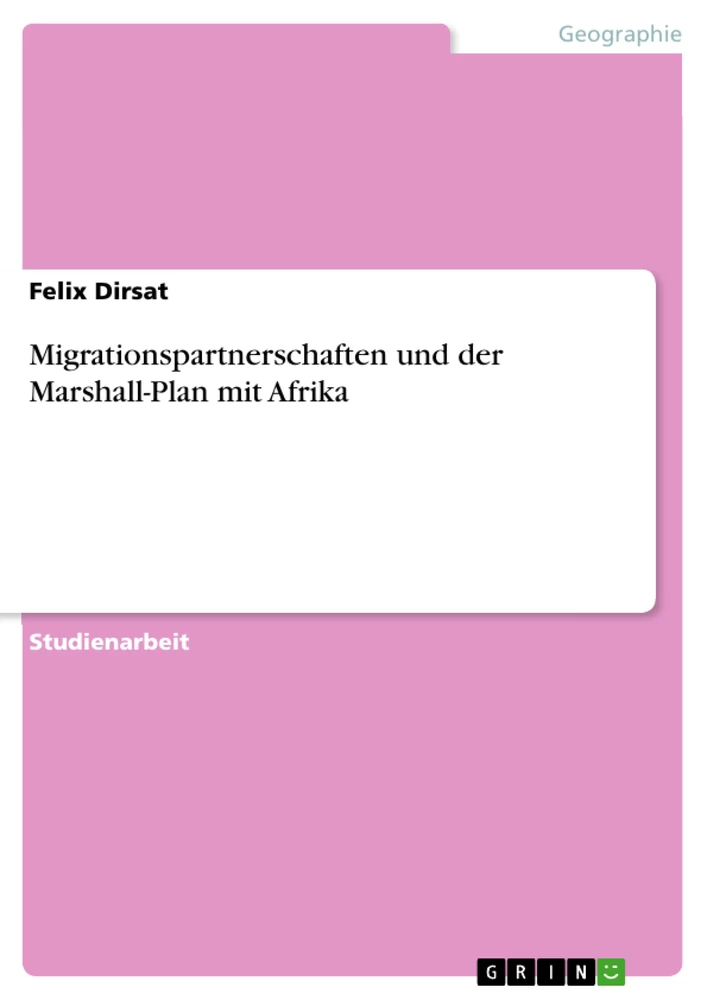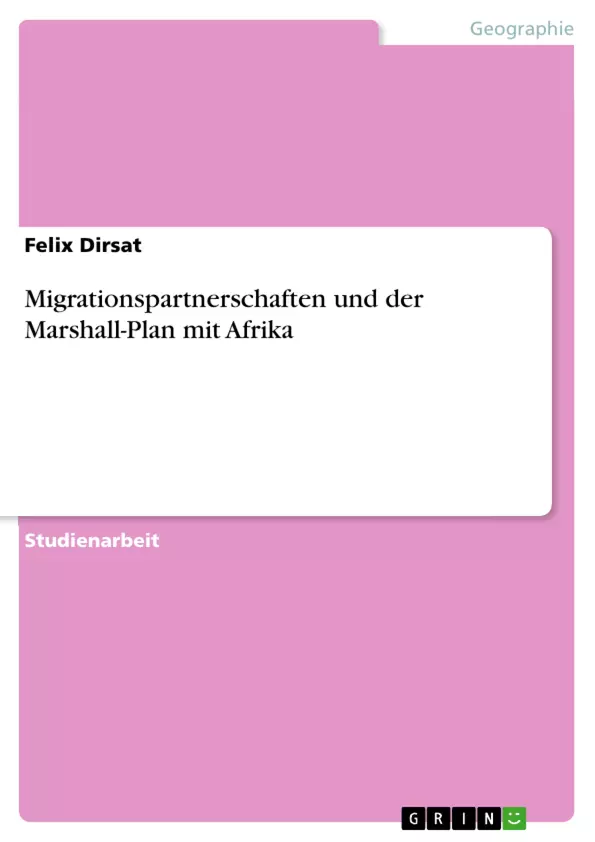In der vorliegenden Hausarbeit sollen die Migrationspartnerschaften, die die Europäische Union mit den afrikanischen Partnerländern eingerichtet hat sowie die damit einhergehenden Fonds seit November 2015 wie beispielsweise der EU-Nothilfe-Treuhandfonds untersucht werden. Außerdem wird ein neuer initiiertes Projekt, der Marshall-Plan mit Afrika und der damit einhergehenden Compact-with-Africa-Intitiative, betrachtet und in seiner Wirkung zur nachhaltigen Migrations- und Fluchursachenbekämpfung diskutiert. Es soll in erster Linie untersucht werden, inwiefern Migrationspartnerschaften und insbesondere der Marshall-Plan mit Afrika der G20 dazu beitragen, die Migrations- und Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen.
Die Migration von Flüchtlingen und Migrant*innen aus afrikanischen Ländern wird vor allem in der Öffentlichkeit „als besonders massiv, stark steigend und ausschließlich negativ wahrgenommen“. Durch die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 wurde dies besonders deutlich und auch die Europäische Union verfolgt seither verstärkt Maßnahmen, um die Migration und Flucht aus den afrikanischen Herkunfts- und Transitländern sowie deren Ursachen zu bekämpfen. Dies erfolgte zu Beginn jedoch primär durch „eine Strategie der Eindämmung und Auslagerung“ (ebd.), sodass zunächst eine Versicherheitlichung an den Grenzen Europas stattfand und viel weniger Bemühungen gezeigt wurden, die Ursachen vor Ort zu suchen und zu bekämpfen. Doch um den Migrationsdruck innerhalb der afrikanischen Bevölkerung zu mindern und dem Bevölkerungswachstum Afrikas stand zu halten, sollten nachhaltige Maßnahmen zur Migrations- und Fluchtursachenbekämpfung entwickelt und durch die Europäische Union umgehend umgesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Afrika als Partner- und Chancenkontinent Europas
- 3. Migrationspartnerschaften
- 3.1 EU-Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika
- 3.2 Einsatz des EUTF in den Partnerschaftsländern
- 3.3 Kritik
- 4. Marshall-Plan mit Afrika
- 4.1 Compact-with-Africa-Initiative
- 4.2 Kritik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Migrationspartnerschaften der Europäischen Union mit afrikanischen Ländern, insbesondere den EU-Nothilfe-Treuhandfonds und die Compact-with-Africa-Initiative des Marshall-Plans mit Afrika. Sie befasst sich mit der Frage, inwiefern diese Partnerschaften zur nachhaltigen Bekämpfung von Migrations- und Fluchtursachen beitragen können.
- Afrika als Partner- und Chancenkontinent Europas
- Migrationspartnerschaften als Instrument der EU-Außenpolitik
- Der EU-Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika und seine Wirksamkeit
- Der Marshall-Plan mit Afrika und seine Ziele
- Kritik an Migrationspartnerschaften und dem Marshall-Plan mit Afrika
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der Migration aus afrikanischen Ländern in den Kontext der europäischen Politik dar und erläutert den Fokus der Hausarbeit auf die Migrationspartnerschaften und den Marshall-Plan mit Afrika.
- Kapitel 2: Afrika als Partner- und Chancenkontinent Europas
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Situation Afrikas, seine demographische Entwicklung, die vorhandenen Ressourcen und die Herausforderungen, die mit der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des Kontinents verbunden sind. Es beleuchtet die Bedeutung Afrikas als Partnerkontinent Europas.
- Kapitel 3: Migrationspartnerschaften
Kapitel 3 beschreibt das Migration Partnership Framework der EU, das im Jahr 2016 eingerichtet wurde. Es erläutert die Ziele, die verschiedenen Komponenten und die Kritik an diesem System.
- Kapitel 4: Marshall-Plan mit Afrika
Das Kapitel fokussiert auf den Marshall-Plan mit Afrika und die Compact-with-Africa-Initiative. Es beschreibt die Ziele, Schwerpunkte und Akteure des Plans und setzt sich kritisch mit ihm auseinander.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Migrationspartnerschaften, EU-Nothilfe-Treuhandfonds, Marshall-Plan mit Afrika, Compact-with-Africa-Initiative, Afrika, Entwicklungshilfe, Migrationsursachenbekämpfung, Fluchtursachenbekämpfung, nachhaltige Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Marshall-Plan mit Afrika“?
Es ist eine Initiative zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika durch verstärkte Investitionen und Partnerschaften, um Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen.
Wofür wird der EU-Nothilfe-Treuhandfonds (EUTF) genutzt?
Der EUTF dient dazu, Stabilität zu fördern und die Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibung in afrikanischen Partnerländern zu bekämpfen.
Was beinhaltet die Compact-with-Africa-Initiative?
Diese G20-Initiative zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen für private Investitionen in afrikanischen Ländern zu verbessern, um nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen.
Welche Kritik gibt es an den Migrationspartnerschaften?
Kritiker bemängeln, dass der Fokus oft zu stark auf der Grenzsicherung und Eindämmung (Versicherheitlichung) liegt, statt die tieferliegenden sozioökonomischen Fluchtursachen vor Ort zu lösen.
Kann der Marshall-Plan Fluchtursachen nachhaltig bekämpfen?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch. Während Investitionen wichtig sind, müssen sie mit politischer Stabilität und lokaler Teilhabe einhergehen, um wirklich langfristige Effekte zu erzielen.
- Quote paper
- Felix Dirsat (Author), 2020, Migrationspartnerschaften und der Marshall-Plan mit Afrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/944706