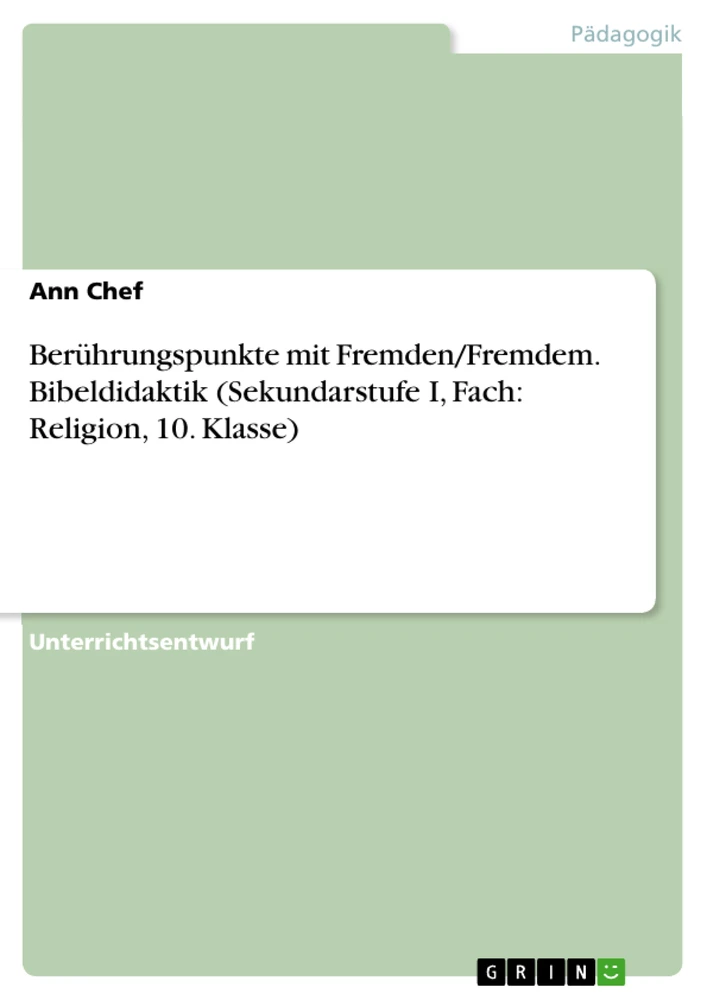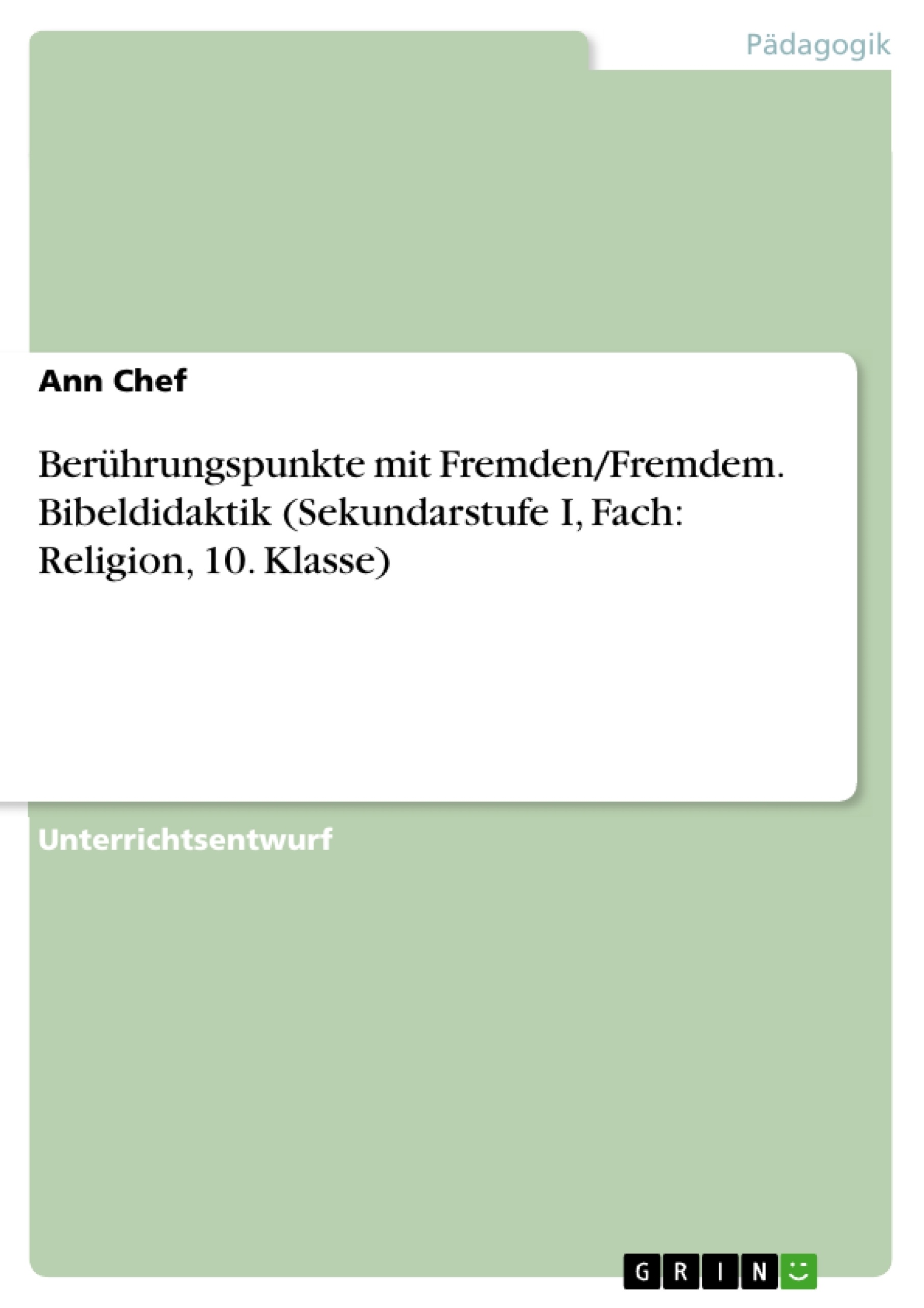Der Umgang mit Fremden ist in unserer Gesellschaft ein zentrales Thema, denn im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die gesellschaftliche Struktur gewandelt: Sie ist multikultureller und multireligiöser geworden, was schließlich zu einer Heterogenität der Gesellschaft sowie zu vielfältigen Begegnungen zwischen Menschen im Alltag führt. Dabei ist es jedoch nicht mehr selbstverständlich, dass einige Menschen in der Gesellschaft einen wertschätzenden Umgang mit Fremden pflegen und diesen offen gegenübertreten. Umso wichtiger ist es also, das Thema in der Schule und auch im Religionsunterricht aufzugreifen, sodass die Kinder für den Umgang mit Fremden sensibilisiert werden und eine Bereitschaft entwickeln, dem Anderen in seiner Fremdheit offen zu begegnen.
Zunächst wird der Begriff des Fremden bzw. der Fremdheit näher betrachtet, dieser lässt sich über die Beziehung einzelner Personen oder Gruppen definieren, wobei Fremdheit das Resultat von Zuschreibungen ist. Dabei wird am Gegenüber das als fremd wahrgenommen, was nicht Teil des eigenen Selbst ist und nicht zur Identifikation beiträgt, wodurch schließlich eine Differenz zwischen Personen entsteht. Doch die Anerkennung des Differenten am Anderen ist wesentlicher Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen sowie Begegnungen. Oft werden jedoch fremdartige Situationen, fremde Lebensstile und Fremde selbst als Bedrohung der eignen Existenz erfahren, denn durch Begegnungen mit dem Fremden wird das eigene Selbstbild hinterfragt und irritiert, wodurch bei manchen Menschen große Verunsicherung entstehen kann. Das Fremdbild wird dabei abgelehnt und als Gefährdung des Selbstkonzepts gesehen, sodass auf sozialer Ebene keine furchtbare Begegnung mehr entstehen kann. Wer oder was als fremd gilt, ist individuell abhängig, wobei entschieden wird, ob eine Person dem persönlich definierten Stereotyp des Fremden entspricht und in wieweit dies durch Verhalten, Sprache, Aussehen sowie Kleidung erfüllt ist, dass der Gegenüber als fremd anerkannt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Umgang mit Fremden in der Gesellschaft und insbesondere im biblischen Kontext. Er analysiert verschiedene Aspekte des Themas, darunter die Definition von Fremdheit, die Bedeutung von Begegnungen mit dem Anderen und die moralischen und sozialen Implikationen im Umgang mit Fremden.
- Definition von Fremdheit und die Folgen von Zuschreibungen
- Biblische Texte und ihre Botschaften zum Umgang mit Fremden
- Die Bedeutung von Wertschätzung und Achtung im Umgang mit Fremden
- Die Relevanz des Themas für die heutige Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse
Der Text beleuchtet die Definition von Fremdheit und analysiert die Entstehung von Fremdbildern. Dabei wird deutlich, dass Fremdheit durch Zuschreibungen entsteht und zu Differenzierung in der Gesellschaft führt. Der Text untersucht auch, wie Begegnungen mit Fremden das eigene Selbstbild beeinflussen können und warum Fremdbilder oft als Bedrohung wahrgenommen werden.
Didaktische Analyse
Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Relevanz des Themas "Umgang mit Fremden" im Religionsunterricht. Der Text verdeutlicht, dass das Thema für Schüler relevant ist, da sie im Alltag immer wieder mit Fremdheit konfrontiert werden. Er erläutert, wie die behandelten biblischen Texte Schülern helfen können, eine wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber Fremden zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Fremdheit, Umgang mit Fremden, Bibel, Fremdbild, gesellschaftliche Strukturen, Migration, multikulturelle Gesellschaft, Religion, Wertschätzung, Achtung, sozialethische Gebote, Fremdenliebe.
- Quote paper
- Ann Chef (Author), 2018, Berührungspunkte mit Fremden/Fremdem. Bibeldidaktik (Sekundarstufe I, Fach: Religion, 10. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/942617