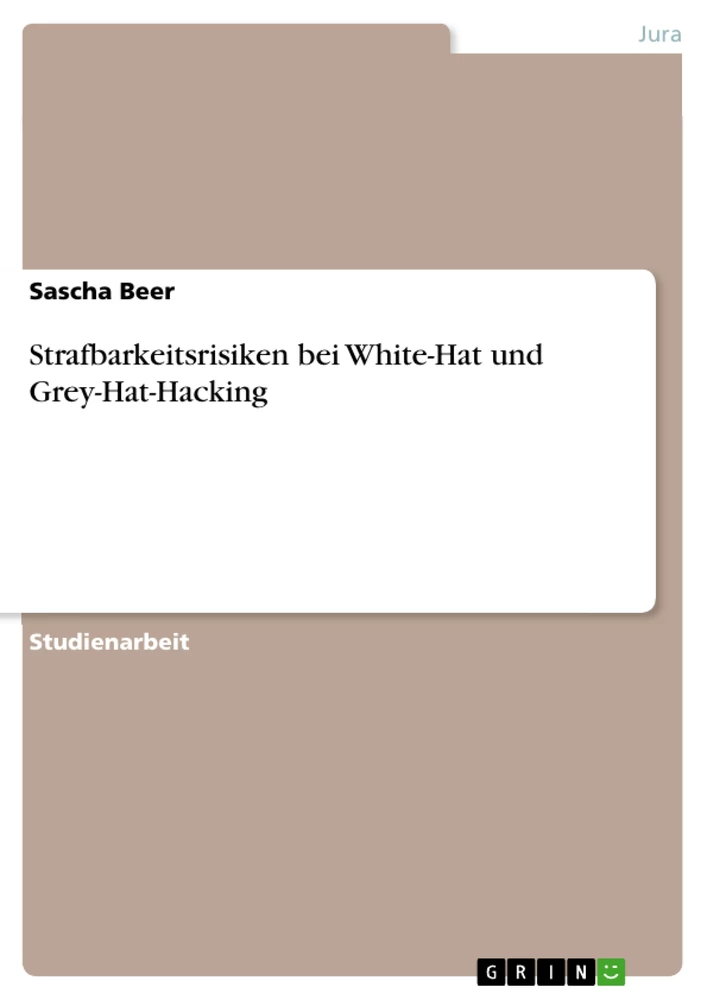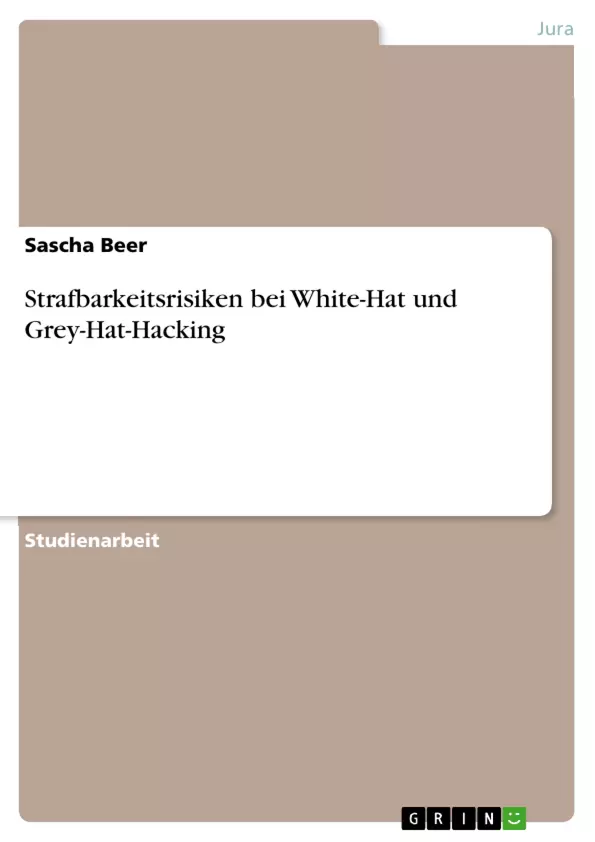Die Arbeit befasst sich mit den Strafbarkeitsrisiken bei White- sowie Grey Hat Hacking. Dabei werden die §§ 202a, 202b, 303a, 303b StGB und insbesondere der mit der Einführung des 41. Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität scharf kritisierte § 202c StGB – besser bekannt als „Hackerparagraph“ - näher betrachtet. Denn Hacker sind nicht gleich Hacker. Die einfachste Kategorisierung, der in der Gesellschaft eher negativ behafteten Begrifflichkeit des Hackers, lässt sich anhand der Ziele, die sie verfolgen, differenzierter ausmachen.
Wer sich an die Hacker-Ethik und geltendes Recht hält, sowie niemanden mit seiner Arbeit schaden möchte, wird als White Hat definiert. Überwiegend arbeiten White Hats im Auftrag von Firmen und decken durch Nutzung von Dual-Use-Software bzw. Penetrationstests Sicherheitslücken in IT-Infrastrukturen auf.
Im Gegensatz zu den White Hats handeln die sogenannten Black Hats ausschließlich mit krimineller Energie. Sie dringen unerlaubt in fremde Netzwerke ein, fangen Passwörter durch Trojaner ab oder nutzen Sicherheitslücken ausschließlich für eigene Zwecke sowie zum Schaden der Betroffenen. Black Hats werden auch als Cracker bezeichnet, um Sie von den White Hats genauer abzugrenzen. Eine Mischung aus White- und Black Hats bilden die Grey Hats. Grey Hats sind nicht eindeutig als positiv oder negativ einzustufen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Zusammenfassung
- B. Einführung
- C. Hauptteil
- I. Einführung in die Welt des Hackings
- 1. Hackereinteilung
- 2. Penetrationstest
- 3. Bug Bounty
- 4. Dual-Use-Problematik
- II. Strafbarkeit des Hacking
- 1. § 202a StGB – Das Ausspähen von Daten
- 2. § 202b StGB – Abfangen von Daten
- 3. § 202c StGB - Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten
- 4. § 303a StGB - Datenveränderung
- 5. § 303b StGB - Computersabotage
- III. Strafbarkeit von White-, Grey-Hat-Hacking
- I. Einführung in die Welt des Hackings
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die strafrechtlichen Risiken von White-Hat- und Grey-Hat-Hacking. Ziel ist es, die einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches (StGB), insbesondere § 202c StGB ("Hackerparagraph"), im Kontext dieser Hacking-Arten zu analysieren und die jeweiligen Strafbarkeitsrisiken aufzuzeigen. Die Arbeit differenziert zwischen den verschiedenen Hacking-Typen und deren Vorgehensweisen.
- Unterscheidung zwischen White-Hat, Grey-Hat und Black-Hat Hacking
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für Penetrationstests und Bug-Bounty-Programme
- Detaillierte Betrachtung der relevanten Paragraphen des StGB (§§ 202a, 202b, 202c, 303a, 303b)
- Bewertung der Strafbarkeitsrisiken für White-Hat und Grey-Hat Hacker
- Die Dual-Use-Problematik im Kontext des Hacker-Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
C. Hauptteil I. Einführung in die Welt des Hackings: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Welt des Hackings und differenziert zwischen verschiedenen Hacking-Typen, nämlich White-Hat, Black-Hat und Grey-Hat Hackern. Es werden die jeweiligen Motive und Vorgehensweisen dieser Gruppen beschrieben, wobei der Fokus auf White-Hat und Grey-Hat Hacking liegt, da diese im weiteren Verlauf der Arbeit im Zentrum der Analyse der Strafbarkeitsrisiken stehen. Penetrationstests und Bug-Bounty-Programme werden als legale Aktivitäten von White-Hat Hackern erläutert und die Dual-Use-Problematik von Software, die sowohl für legale als auch illegale Zwecke verwendet werden kann, wird angesprochen. Die Beschreibung dieser verschiedenen Hacking-Arten bildet die Grundlage für die anschließende juristische Analyse.
C. Hauptteil II. Strafbarkeit des Hacking: Dieses Kapitel analysiert die Strafbarkeit verschiedener Hacking-Aktivitäten anhand relevanter Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuches (§§ 202a, 202b, 202c, 303a, 303b StGB). Für jeden Paragraphen werden der objektive und subjektive Tatbestand, die Rechtswidrigkeit und die Frage des Versuchs und des Antragsdelikts detailliert untersucht. Der Fokus liegt auf der Interpretation und Anwendung dieser Paragraphen im Kontext von Hacking-Aktivitäten, um die jeweiligen Strafbarkeitsrisiken zu verdeutlichen. Das Kapitel dient als juristische Grundlage für die Bewertung der Strafbarkeitsrisiken von White-Hat und Grey-Hat Hacking im folgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
White-Hat-Hacking, Grey-Hat-Hacking, Black-Hat-Hacking, Penetrationstest, Bug Bounty, Dual-Use-Software, § 202a StGB, § 202b StGB, § 202c StGB, § 303a StGB, § 303b StGB, Computerstrafrecht, Strafbarkeitsrisiken, Hacker-Ethik, IT-Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Strafrechtliche Risiken von White-Hat und Grey-Hat Hacking
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die strafrechtlichen Risiken von White-Hat und Grey-Hat Hacking im Kontext des deutschen Strafgesetzbuches (StGB). Sie untersucht verschiedene Hacking-Typen, deren Vorgehensweisen und die relevanten Paragraphen des StGB, insbesondere § 202c StGB ("Hackerparagraph"). Die Arbeit beinhaltet eine Einführung in die Welt des Hackings, eine detaillierte Betrachtung der relevanten Paragraphen des StGB und eine Bewertung der Strafbarkeitsrisiken für White-Hat und Grey-Hat Hacker. Zusätzlich wird die Dual-Use-Problematik beleuchtet.
Welche Hacking-Arten werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen White-Hat, Grey-Hat und Black-Hat Hacking. White-Hat Hacker betreiben ethisches Hacking mit Zustimmung des Eigentümers, Grey-Hat Hacker bewegen sich in einer Grauzone zwischen legal und illegal, und Black-Hat Hacker betreiben illegales Hacking.
Welche Paragraphen des StGB werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Paragraphen § 202a StGB (Ausspähen von Daten), § 202b StGB (Abfangen von Daten), § 202c StGB (Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten), § 303a StGB (Datenveränderung) und § 303b StGB (Computersabotage) im Kontext von Hacking-Aktivitäten.
Was sind Penetrationstests und Bug-Bounty-Programme?
Penetrationstests und Bug-Bounty-Programme werden als legale Aktivitäten von White-Hat Hackern beschrieben. Sie dienen dazu, Schwachstellen in IT-Systemen aufzudecken und zu beheben.
Was ist die Dual-Use-Problematik?
Die Dual-Use-Problematik bezieht sich auf Software oder Technologien, die sowohl für legale als auch illegale Zwecke verwendet werden können. Die Arbeit untersucht diese Problematik im Kontext des Hacker-Rechts.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Strafbarkeitsrisiken von White-Hat und Grey-Hat Hacking aufzuzeigen und die relevanten Paragraphen des StGB im Kontext dieser Hacking-Arten zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Zusammenfassung, eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu einer Einführung in das Hacking, der Strafbarkeit des Hackings und der Strafbarkeit von White-Hat und Grey-Hat Hacking) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen White-Hat-Hacking, Grey-Hat-Hacking, Black-Hat-Hacking, Penetrationstest, Bug Bounty, Dual-Use-Software, § 202a StGB, § 202b StGB, § 202c StGB, § 303a StGB, § 303b StGB, Computerstrafrecht, Strafbarkeitsrisiken, Hacker-Ethik und IT-Sicherheit.
- Arbeit zitieren
- Sascha Beer (Autor:in), 2020, Strafbarkeitsrisiken bei White-Hat und Grey-Hat-Hacking, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/941374