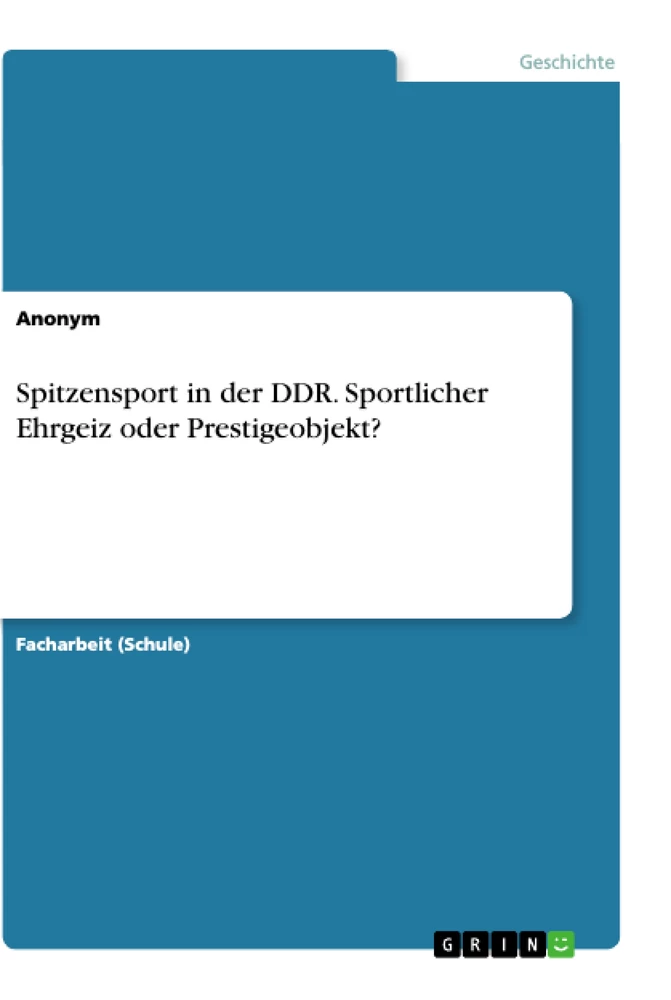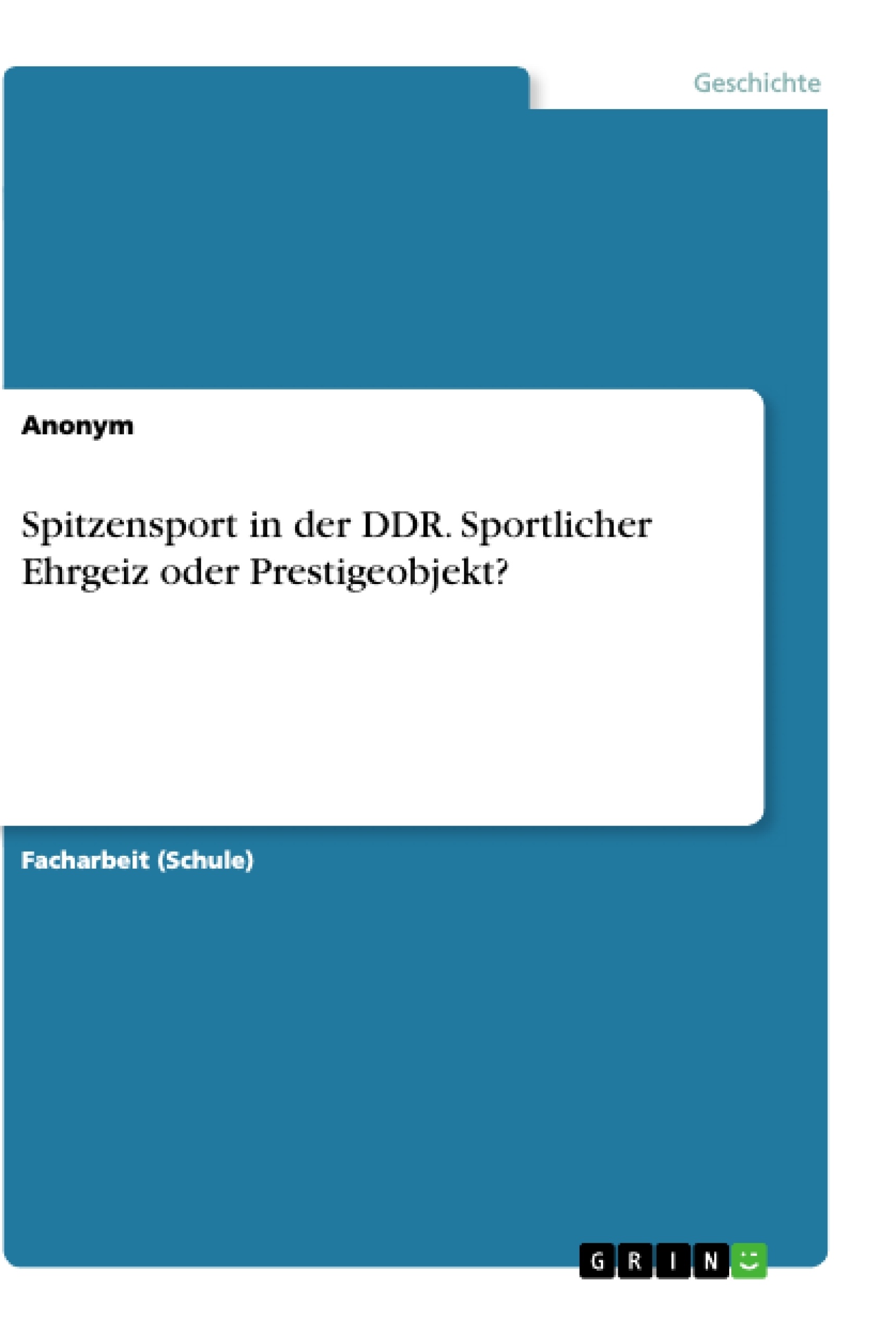In der Arbeit wird die Frage geklärt, ob Spitzensport in der Deutschen Demokratischen Republik als Mittel zum Zweck genutzt wurde. Um diese Frage zu beantworten, wird zu Beginn auf die Entwicklung und Struktur der Sportinstitutionen sowie auf den Weg eingegangen, den ein Sportler in der DDR durchlaufen musste, um ein Spitzensportler zu werden. Des Weiteren wird das Thema Sport und Politik mit Hilfe mehrerer Unterthemen ausführlich behandelt. Darüber hinaus werden Maßnahmen, welche zur Leistungssteigerung genutzt wurden, genannt sowie auf die Sportlaufbahnen der Sportler Katarina Witt und Axel Mitbauer eingegangen. Schließlich werden die strafrechtlichen Konsequenzen nach der Wiedervereinigung aufgriffen, um die Frage zum Abschluss beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und Struktur der staatlichen Institutionen im Spitzensport
- Der Weg zum Spitzensportler
- Talentsichtung
- Talentförderung
- Sport und Politik
- Sport unter Einfluss der SED
- Manfred Ewald: Chef des Sportsystems
- Sportliche Zielvorgaben
- Sportliche Erfolge des Systems
- Maßnahmen zur Leistungssteigerung
- Prämienanreize
- Doping
- Unterschiedliche Laufbahnen der Sportler im System
- Sportlerflucht
- Katarina Witt
- Strafrechtliche Konsequenzen nach der Wiedervereinigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit der Spitzensport in der DDR als Mittel zum Zweck der SED genutzt wurde. Analysiert werden die Entwicklung und Struktur der staatlichen Sportinstitutionen, der Weg zum Spitzensportler, der Einfluss von Politik und Ideologie auf den Sport, Maßnahmen zur Leistungssteigerung und die unterschiedlichen Karrierewege von Sportlern. Die strafrechtlichen Konsequenzen nach der Wiedervereinigung bilden den Abschluss.
- Entwicklung und Struktur der staatlichen Sportinstitutionen in der DDR
- Der Prozess der Talentsichtung und -förderung im DDR-Spitzensport
- Der Einfluss der SED-Politik auf den Spitzensport
- Methoden zur Leistungssteigerung, inklusive Doping und Prämien
- Die unterschiedlichen Erfahrungen und Karrieren von Sportlern im DDR-System
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Nutzung des Spitzensportes in der DDR als Mittel zum Zweck. Sie skizziert den Einfluss der SED auf alle Lebensbereiche und leitet die Struktur der Arbeit ein, die die Entwicklung der Sportinstitutionen, den Weg zum Spitzensportler, den Einfluss der Politik, Maßnahmen zur Leistungssteigerung, individuelle Sportlerkarrieren und die strafrechtlichen Konsequenzen nach der Wiedervereinigung beleuchtet.
2. Entwicklung und Struktur der staatlichen Institutionen im Spitzensport: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der staatlichen Sportstrukturen in der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Abschaffung traditioneller Vereine zugunsten von politisch kontrollierten Organisationen wie Betriebssportgemeinschaften und Sportclubs wird detailliert dargestellt. Die enge Verzahnung von Sport und Politik wird anhand von Beschlüssen des Politbüros und der SED verdeutlicht, wobei der Sport als Instrument der ideologischen und patriotischen Erziehung und zur Stärkung des sozialistischen Systems eingesetzt wurde. Die Hierarchie der Sportinstitutionen, von der Abteilung Sport des Zentralkomitees der SED bis zum Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB), wird analysiert, um die zentralisierte Kontrolle des Systems zu zeigen.
3. Der Weg zum Spitzensportler: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Prozesse der Talentsichtung und -förderung im DDR-Spitzensport. Es beschreibt das umfassende System der Talentsichtung, das von Vorschulen bis zu den Spartakiaden reichte und auf die Identifizierung und Förderung von talentierten Kindern in verschiedenen Sportarten abzielte. Die drei Förderstufen und die Umorientierung von Sportlern auf andere Disziplinen bei ausbleibenden Fortschritten werden erläutert. Das System zielte darauf ab, die besten Athleten zu identifizieren und zu fördern, um im internationalen Wettkampf erfolgreich zu sein und die ideologische Botschaft des DDR-Systems zu propagieren.
4. Sport und Politik: Das Kapitel analysiert den starken Einfluss der SED auf den DDR-Spitzensport. Die Rolle Manfred Ewalds als Chef des Sportsystems und die politischen Zielvorgaben der SED werden untersucht. Der Sport diente nicht nur der Leistungssteigerung, sondern auch der politischen Propaganda und der Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins. Die sportlichen Erfolge des Systems werden im Kontext der politischen Strategien der SED betrachtet, wobei Erfolge als Beweis der Überlegenheit des sozialistischen Systems interpretiert wurden.
5. Maßnahmen zur Leistungssteigerung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Maßnahmen zur Leistungssteigerung im DDR-Spitzensport, darunter Prämienanreize und Doping. Es werden die verschiedenen Methoden untersucht, mit denen die DDR-Regierung versuchte, die sportliche Leistung ihrer Athleten zu maximieren. Der Gebrauch von Doping wird als ein Beispiel für die Bereitschaft der DDR, unethische Methoden zur Erreichung politischer Ziele einzusetzen, diskutiert.
6. Unterschiedliche Laufbahnen der Sportler im System: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Karrierewege von Sportlern im DDR-System. Es wird auf das Phänomen der Sportlerflucht eingegangen und die Karriere von Katarina Witt als Beispiel für den Umgang mit herausragenden Athleten analysiert. Der Fokus liegt auf den individuellen Erfahrungen von Sportlern im System und den unterschiedlichen Möglichkeiten und Herausforderungen, denen sie begegneten.
Schlüsselwörter
DDR-Spitzensport, SED, Sportpolitik, Talentsichtung, Talentförderung, Doping, Leistungssteigerung, Sportlerkarrieren, Sportlerflucht, Manfred Ewald, Staatliche Sportinstitutionen, Ideologie, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen zum Thema DDR-Spitzensport
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Nutzung des Spitzensportes in der DDR als Mittel zum Zweck der SED. Sie analysiert die Entwicklung und Struktur der staatlichen Sportinstitutionen, den Weg zum Spitzensportler, den Einfluss von Politik und Ideologie auf den Sport, Maßnahmen zur Leistungssteigerung und die unterschiedlichen Karrierewege von Sportlern. Die strafrechtlichen Konsequenzen nach der Wiedervereinigung bilden den Abschluss.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und Struktur der staatlichen Sportinstitutionen in der DDR, den Prozess der Talentsichtung und -förderung, den Einfluss der SED-Politik auf den Spitzensport, Methoden zur Leistungssteigerung (inklusive Doping und Prämien) und die unterschiedlichen Erfahrungen und Karrieren von Sportlern im DDR-System.
Wie war die Entwicklung und Struktur der staatlichen Sportinstitutionen in der DDR?
Das Kapitel beschreibt die Entwicklung der staatlichen Sportstrukturen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Abschaffung traditioneller Vereine zugunsten politisch kontrollierter Organisationen (BSG, Sportclubs), die enge Verzahnung von Sport und Politik (Politbüro-Beschlüsse), den Sport als Instrument der ideologischen und patriotischen Erziehung und die zentralisierte Kontrolle des Systems (von der Abteilung Sport des ZK der SED bis zum DTSB).
Wie funktionierte die Talentsichtung und -förderung im DDR-Spitzensport?
Das Kapitel beschreibt das umfassende System der Talentsichtung (von Vorschulen bis zu den Spartakiaden), die drei Förderstufen und die Umorientierung von Sportlern bei ausbleibenden Fortschritten. Das Ziel war die Identifizierung und Förderung der besten Athleten für den internationalen Wettkampf und die ideologische Propaganda.
Welchen Einfluss hatte die SED-Politik auf den Spitzensport?
Das Kapitel analysiert den starken Einfluss der SED, die Rolle Manfred Ewalds, die politischen Zielvorgaben, den Sport als politische Propaganda und zur Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins, und die Interpretation sportlicher Erfolge als Beweis der Überlegenheit des sozialistischen Systems.
Welche Maßnahmen zur Leistungssteigerung wurden eingesetzt?
Dieses Kapitel befasst sich mit Prämienanreizen und Doping als Methoden zur Maximierung der sportlichen Leistung. Der Gebrauch von Doping wird als Beispiel für die Bereitschaft der DDR, unethische Methoden zur Erreichung politischer Ziele einzusetzen, diskutiert.
Welche unterschiedlichen Laufbahnen hatten Sportler im DDR-System?
Dieses Kapitel beleuchtet unterschiedliche Karrierewege, das Phänomen der Sportlerflucht und die Karriere von Katarina Witt als Beispiel. Der Fokus liegt auf den individuellen Erfahrungen von Sportlern und den Herausforderungen im System.
Welche strafrechtlichen Konsequenzen gab es nach der Wiedervereinigung?
Die Arbeit schließt mit einer Betrachtung der strafrechtlichen Konsequenzen nach der Wiedervereinigung ab (nähere Details sind im vollständigen Text enthalten).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
DDR-Spitzensport, SED, Sportpolitik, Talentsichtung, Talentförderung, Doping, Leistungssteigerung, Sportlerkarrieren, Sportlerflucht, Manfred Ewald, Staatliche Sportinstitutionen, Ideologie, Propaganda.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Spitzensport in der DDR. Sportlicher Ehrgeiz oder Prestigeobjekt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/940980