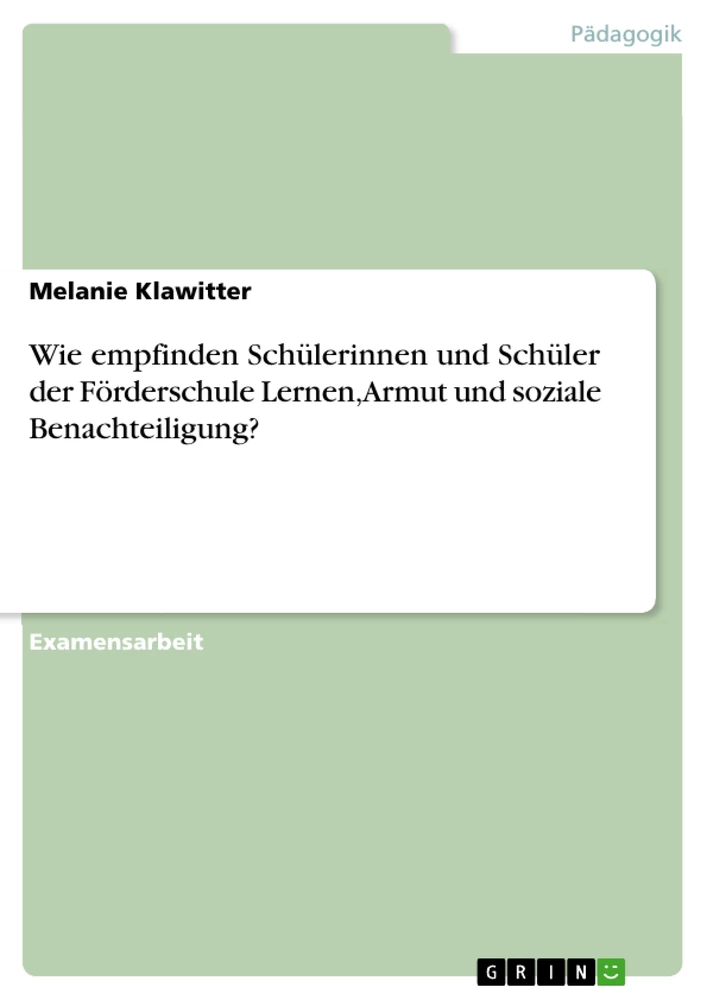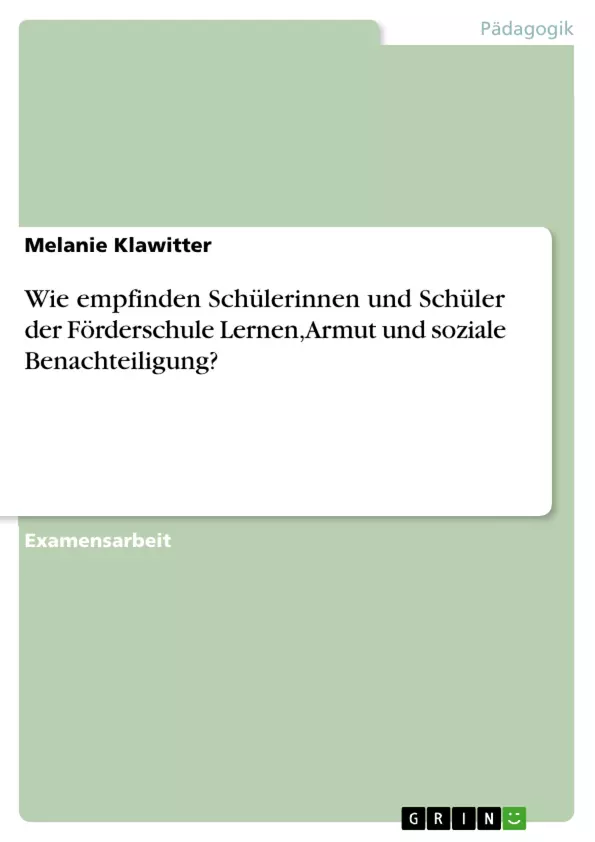In dieser Arbeit wird zunächst eine Einführung in die Bedeutung des Themas und den aktuellen Forschungsstand gegeben. Es folgen theoretische Darlegungen zur Kinderarmut in Deutschland. Hier werden verschiedene Sichtweisen und Modelle aufgezeigt. Es folgt ein Kapitel zu Armut und sozialer Benachteiligung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie ein Kapitel zur kindlichen Wahrnehmung und Bewältigung von Armut. Im empirischen Teil der Arbeit folgt die ausführliche Darlegung meiner Fragebogenuntersuchung bei der 307 FörderschülerInnen aus 11 Förderschulen in Nordrhein-Westfalen im Alter von 12-17 Jahren befragt wurden.
Diese Untersuchung liefert überraschende Ergebnisse zutage und stellt die erste Untersuchung ihrer Art dar. Noch nie zuvor wurden in Deutschland FörderschülerInnen zu ihrer Sicht auf Armut und soziale Benachteiligung befragt. Gerade aufgrund der Brisanz und Aktualität des Themas leistet die Untersuchung einen wichtigen Beitrag für die sonderpädagogische Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Vorwort
- Kapitel 1: Einführung
- 1.1 Zur Bedeutung des Themas
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Zum aktuellen Forschungsstand
- 1.4 Vorgehensweise
- Kapitel 2: Kinderarmut in Deutschland
- 2.1 Armut in Deutschland- Zahlen und Fakten im Überblick
- 2.2 Verschiedene Definitionen und Sichtweisen zum Begriff „Armut“
- 2.3 Das „Pentagon der Armut\" als Erklärungsmodell zur Entstehung von Armut und sozialer Benachteiligung
- 2.4 Dimensionen und Auswirkungen von Armut
- 2.4.1 Wohnverhältnisse
- 2.4.1.1 Exkurs: Straßenkinder in Deutschland
- 2.4.2 Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten außerhalb der Schule
- 2.4.3 Psychische und physische Gesundheit
- 2.4.4 Familie und soziale Netzwerke
- 2.4.5 Materielle Versorgung und Konsum
- 2.4.6 Delinquenz und normabweichendes Verhalten
- Kapitel 3: Armut und soziale Benachteiligung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- 3.1 Zum Zusammenhang von Lernbehinderung und Armut sowie sozialer Benachteiligung
- 3.2 Zur Wahrnehmung von Armut und sozialer Benachteiligung aus Sicht von Lehrern der Förderschule Lernen
- Kapitel 4: Wahrnehmung und Bewältigung von Armut
- 4.1 Wie Kinder in Deutschland Armut erleben und beurteilen
- 4.2 Vulnerabilität und Resilienz
- 4.3 Professionelle Hilfsangebote und Beratungsstellen
- 4.4 Bewältigungsstrategien
- Kapitel 5: Empirische Untersuchung durch Fragebogen zur Fragestellung „Wie empfinden Schülerinnen und Schüler der Förderschule Lernen Armut und soziale Benachteiligung?“
- 5.1 Hypothesen
- 5.2 Wahl der Untersuchungsmethode- Möglichkeiten und Grenzen der empirischen Untersuchung durch Fragebogen
- 5.3 Fragebogendesign
- 5.4 Untersuchungsgruppe- soziodemographische Daten
- 5.5 Darstellung der Ergebnisse
- 5.6 Interpretation der Ergebnisse im Bezug auf die Hypothesen
- 5.7 Erklärungsansätze für das Antwortverhalten der befragten Förderschüler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die Wahrnehmung und die Auswirkungen von Armut und sozialer Benachteiligung auf Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis für die subjektiven Erfahrungen dieser Schülergruppe zu entwickeln.
- Armut in Deutschland: Definitionen, Ausprägungen und Auswirkungen
- Zusammenhang zwischen Lernbehinderung, Armut und sozialer Benachteiligung
- Wahrnehmung von Armut und sozialer Benachteiligung durch Schüler und Lehrer
- Bewältigungsstrategien von Kindern und Jugendlichen in Armut
- Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur subjektiven Erfahrung von Armut bei Förderschülern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, erläutert die Bedeutung des Themas der Armut und sozialen Benachteiligung bei Schülern an Förderschulen Lernen, formuliert die Forschungsfrage und beschreibt den aktuellen Forschungsstand sowie die gewählte Vorgehensweise der Studie. Es liefert den notwendigen Kontext für die nachfolgenden Kapitel und begründet die Relevanz der Untersuchung.
Kapitel 2: Kinderarmut in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Kinderarmut in Deutschland. Es präsentiert statistische Daten, diskutiert verschiedene Definitionen von Armut und beleuchtet das „Pentagon der Armut“ als Erklärungsmodell für die Entstehung von Armut und sozialer Benachteiligung. Weiterhin werden die verschiedenen Dimensionen und Auswirkungen von Armut auf die Lebensbedingungen betroffener Kinder und Familien detailliert beschrieben, einschließlich der Auswirkungen auf Wohnverhältnisse, Bildung, Gesundheit, Familie und soziales Umfeld sowie Delinquenz.
Kapitel 3: Armut und soziale Benachteiligung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen: Dieses Kapitel untersucht den spezifischen Zusammenhang zwischen Lernbehinderung, Armut und sozialer Benachteiligung. Es analysiert, wie sich Armut und soziale Benachteiligung auf den Schulalltag von Schülern an Förderschulen Lernen auswirken und beleuchtet die Wahrnehmung dieser Problematik aus der Perspektive der Lehrkräfte. Es wird der spezifische Kontext der Förderschule als Institution im Umgang mit dieser Problematik untersucht.
Kapitel 4: Wahrnehmung und Bewältigung von Armut: Kapitel 4 befasst sich mit der subjektiven Wahrnehmung und den Bewältigungsstrategien von Kindern und Jugendlichen in Armutssituationen. Es analysiert, wie Kinder Armut erleben und beurteilen und diskutiert die Konzepte von Vulnerabilität und Resilienz im Kontext von Armut. Zusätzlich werden professionelle Hilfsangebote und Beratungsstellen vorgestellt und deren Rolle bei der Bewältigung von Armut beleuchtet.
Kapitel 5: Empirische Untersuchung durch Fragebogen zur Fragestellung „Wie empfinden Schülerinnen und Schüler der Förderschule Lernen Armut und soziale Benachteiligung?“: In diesem Kapitel wird die durchgeführte empirische Untersuchung detailliert dargestellt. Es beschreibt die methodische Vorgehensweise, die Fragestellung, die Hypothesen und die soziodemografischen Daten der Untersuchungsgruppe. Die Ergebnisse der Befragung werden präsentiert und im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen interpretiert. Schließlich werden Erklärungsansätze für das Antwortverhalten der befragten Förderschüler diskutiert.
Schlüsselwörter
Armut, soziale Benachteiligung, Förderschule Lernen, Lernbehinderung, empirische Untersuchung, Schülerperspektive, Lehrerperspektive, Resilienz, Vulnerabilität, Bewältigungsstrategien, sozioökonomischer Status, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Examensarbeit: Wahrnehmung und Auswirkungen von Armut und sozialer Benachteiligung auf Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen
Was ist das Thema der Examensarbeit?
Die Examensarbeit untersucht die Wahrnehmung und Auswirkungen von Armut und sozialer Benachteiligung auf Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen. Der Fokus liegt auf den subjektiven Erfahrungen dieser Schülergruppe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Kinderarmut in Deutschland), Kapitel 3 (Armut und soziale Benachteiligung an Förderschulen Lernen), Kapitel 4 (Wahrnehmung und Bewältigung von Armut) und Kapitel 5 (Empirische Untersuchung).
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über Kinderarmut in Deutschland. Es beinhaltet statistische Daten, verschiedene Armutsdefinitionen, das „Pentagon der Armut“ als Erklärungsmodell und detaillierte Beschreibungen der Auswirkungen von Armut auf Wohnverhältnisse, Bildung, Gesundheit, Familie, soziales Umfeld und Delinquenz.
Worauf konzentriert sich Kapitel 3?
Kapitel 3 untersucht den Zusammenhang zwischen Lernbehinderung, Armut und sozialer Benachteiligung an Förderschulen Lernen. Es analysiert die Auswirkungen von Armut auf den Schulalltag und die Wahrnehmung dieser Problematik aus der Sicht der Lehrkräfte.
Was ist der Inhalt von Kapitel 4?
Kapitel 4 befasst sich mit der subjektiven Wahrnehmung und den Bewältigungsstrategien von Kindern und Jugendlichen in Armut. Es analysiert, wie Kinder Armut erleben und beurteilen, und diskutiert die Konzepte von Vulnerabilität und Resilienz. Zusätzlich werden professionelle Hilfsangebote und Beratungsstellen vorgestellt.
Wie sieht die empirische Untersuchung in Kapitel 5 aus?
Kapitel 5 beschreibt detailliert eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen zur Frage, wie Schülerinnen und Schüler der Förderschule Lernen Armut und soziale Benachteiligung empfinden. Es umfasst die methodische Vorgehensweise, die Hypothesen, die soziodemografischen Daten, die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie Erklärungsansätze für das Antwortverhalten der Befragten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armut, soziale Benachteiligung, Förderschule Lernen, Lernbehinderung, empirische Untersuchung, Schülerperspektive, Lehrerperspektive, Resilienz, Vulnerabilität, Bewältigungsstrategien, sozioökonomischer Status, Deutschland.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis für die subjektiven Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen bezüglich Armut und sozialer Benachteiligung zu entwickeln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Armut in Deutschland, den Zusammenhang zwischen Lernbehinderung, Armut und sozialer Benachteiligung, die Wahrnehmung von Armut durch Schüler und Lehrer, Bewältigungsstrategien von Kindern in Armut und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur subjektiven Erfahrung von Armut bei Förderschülern.
- Quote paper
- Melanie Klawitter (Author), 2008, Wie empfinden Schülerinnen und Schüler der Förderschule Lernen, Armut und soziale Benachteiligung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93987