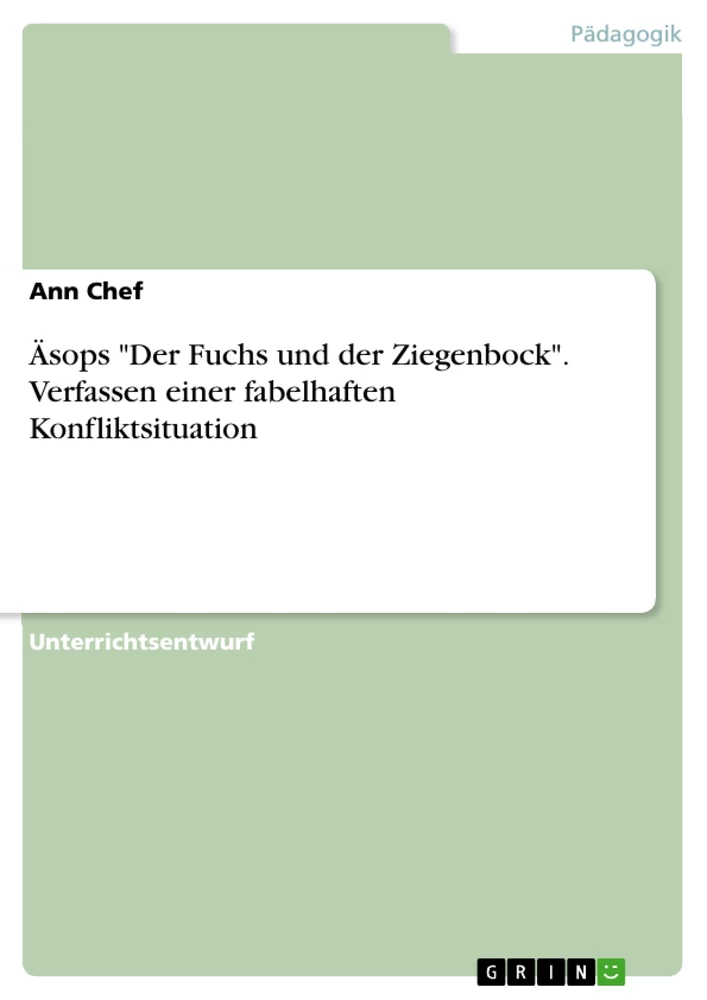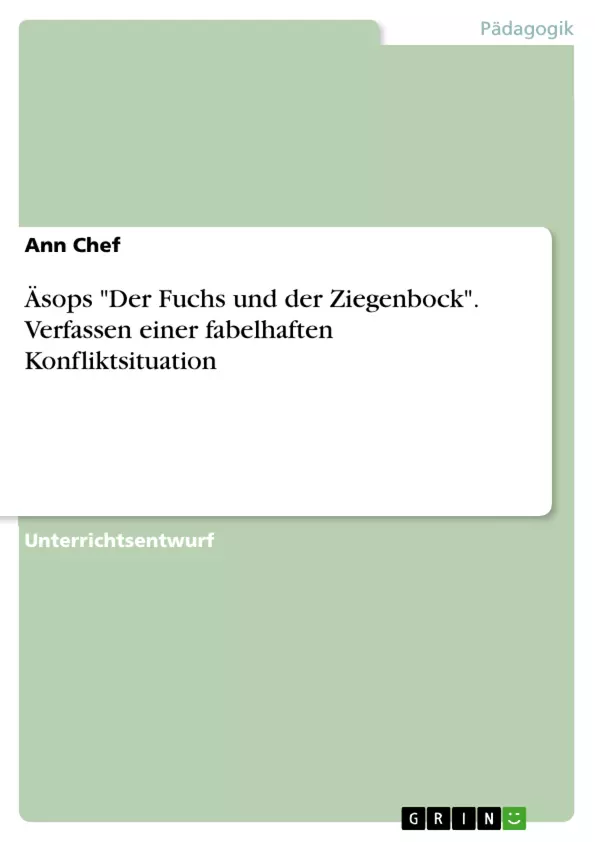In der vorliegenden Unterrichtsstunde fungiert die Fabel „Der Fuchs und der Ziegenbock“ von Äsop nicht nur als Lerngegenstand, welcher produktiv erschlossen werden soll, sondern die Fabel bietet den SuS auch die Möglichkeit, Verhaltensweisen zu bewerten und eine Moral daraus abzuleiten.
Die Textsorte der Fabel, welche weit in die griechisch-römische Antike zurückreicht, wird von Lessing in seinen bekannten "Abhandlungen über die Fabel"(1759) als allgemeiner moralischer Satz definiert. Dieser bildet als kurze Erzählung in anschaulicher Weise die Wirklichkeit ab. Den allgemeinen moralischen Satz bzw. die Lehre der Fabel und somit die Funktion dieser Textsorte stellt Lessing in den Vordergrund, welche einen belehrenden und erzieherischen Charakter aufweist. Dabei muss es den Rezipienten aber möglich sein, die Moral anschauend zu erkennen, sie sollte also leicht erkennbar sein.
Deutschunterricht soll die Lernenden zum kritischen Lesen, Denken und zur Reflexion erziehen, wobei die SuS eigene Leseerfahrungen nutzen sollen, um in kritischer Distanz ihre eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Dafür eignet sich die Fabel aufgrund ihres erzieherischen und lehrhaften Charakters besonders. Sie fordert die Lernenden "zur Prüfung einer Sache […] auf und zugleich zur Überprüfung [ihrer] eigenen Denk- und Verhaltensweisen“, was in der gesamten Unterrichtseinheit sowie in dieser Unterrichtsstunde durch eine Übertragung der Bildebene auf die Lebenswirklichkeit, also die Sachebene, erreicht wird. In der Auseinandersetzung mit Fabeltexten findet dadurch auf besondere Weise die Erziehung der SuS sowie die Entwicklung ihrer humanistischen Wertevorstellungen statt, wie es im Schulgesetz des Landes Schleswig-Holsteins vorgesehen ist.
Damit lässt sich auch nach Klafki die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Lerngegenstands für die SuS begründen.
Indem die handelnden Tiere in der Fabel meist zu einer Bewertung ihres Verhaltens nahezu einladen, werden die SuS dazu angeregt, sich ihre eigenen Werte bewusstzumachen, diese zu artikulieren und zu reflektieren. Denn Rezipienten stimmen einer Lehre nicht automatisch zu, sondern hinterfragen diese kritisch und gelangen zu einer eigenen Schlussfolgerung. Die Lernenden bedenken Folgen und Konsequenzen von bestimmten Werthaltungen und gewinnen daraus eine eigene Haltung, wodurch sie ihr eigenes Verhalten auch zukünftig unter diesen Gesichtspunkten reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtseinheit: Was uns die Fabel lehrt - Analytische sowie produktionsorientierte Verfahren zur Erschließung von Fabeln
- Thema der Unterrichtsstunde: „Der Fuchs und der Ziegenbock“ (Äsop) – Verfassen einer fabelhaften Konfliktsituation
- Einbindung der Unterrichtsstunde in die laufende Unterrichtseinheit
- Stunde 1
- Stunde 2-3
- Stunde 4
- Stunde 5-6
- Stunde 7
- Stunde 8
- Stunde 9
- Stunde 10
- Stunde 11-14
- Stunde 15
- 1. Angaben zur Lerngruppe und unterrichtliche Voraussetzungen
- 12. Didaktische Überlegungen
- 23. Methodische Überlegungen
- 3. Literaturverzeichnis
- Bildquellen
- Anmerkung der Redaktion
- Anhang
- Verlaufsskizze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtsstunde zielt darauf ab, dass die SchülerInnen die Konfliktsituation der Fabel „Der Fuchs und der Ziegenbock“ produktiv erschließen, indem sie selbst Rede und Gegenrede verfassen. Die Hauptidee ist, die Schreibkompetenz der SchülerInnen zu fördern und gleichzeitig ihr Verständnis für die Textsorte Fabel zu vertiefen.
- Analytische Erschließung von Fabeln
- Produktionsorientierte Verfahren zur Erschließung von Fabeln
- Entwicklung der Schreibkompetenz
- Vertiefung des Wissens über Merkmale und Aufbau von Fabeln
- Bewertung von Verhaltensweisen und Ableitung einer Moral
Zusammenfassung der Kapitel
- Thema der Unterrichtseinheit: Dieser Abschnitt stellt die didaktischen Ziele der Unterrichtseinheit vor, die sich auf die analytische und produktionsorientierte Erschließung von Fabeln konzentrieren.
- Thema der Unterrichtsstunde: Hier wird die spezifische Aufgabe der Unterrichtsstunde vorgestellt: Die SchülerInnen sollen eine Konfliktsituation in der Fabel „Der Fuchs und der Ziegenbock“ verfassen, um die Fabel produktiv zu erschließen.
- Einbindung der Unterrichtsstunde in die laufende Unterrichtseinheit: Dieser Teil gibt einen Überblick über den Verlauf der gesamten Unterrichtseinheit und zeigt die Positionierung der aktuellen Stunde innerhalb des Gesamtkonzepts.
- 1. Angaben zur Lerngruppe und unterrichtliche Voraussetzungen: Dieser Abschnitt bietet Informationen über die Lerngruppe und die relevanten Voraussetzungen für die Unterrichtsstunde.
- 12. Didaktische Überlegungen: Dieser Abschnitt beleuchtet die pädagogischen Aspekte der Unterrichtsstunde und argumentiert, warum die Fabel „Der Fuchs und der Ziegenbock“ als Lerngegenstand besonders geeignet ist.
- 23. Methodische Überlegungen: Dieser Teil beschreibt die methodische Vorgehensweise in der Unterrichtsstunde und zeigt die einzelnen Phasen des Unterrichtsverlaufs, von der Aktivierung des Vorwissens über die Erarbeitungsphase bis hin zur Sicherung und Vertiefung des Gelernten.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Unterrichtsstunde befasst sich mit der Fabel „Der Fuchs und der Ziegenbock“ von Äsop. Die Schlüsselwörter sind: Fabel, Konfliktsituation, Rede und Gegenrede, produktives Erschließen, Schreibkompetenz, Moral, Verhaltensbewertung, Textsorte, Merkmale, Aufbau.
- Arbeit zitieren
- Ann Chef (Autor:in), 2020, Äsops "Der Fuchs und der Ziegenbock". Verfassen einer fabelhaften Konfliktsituation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/936658