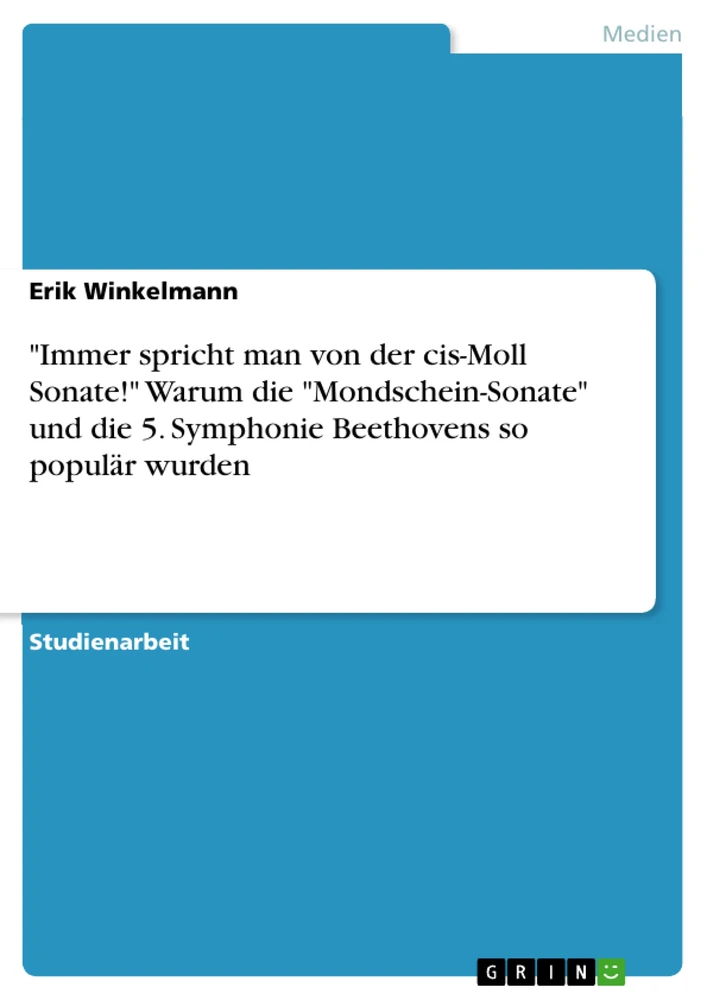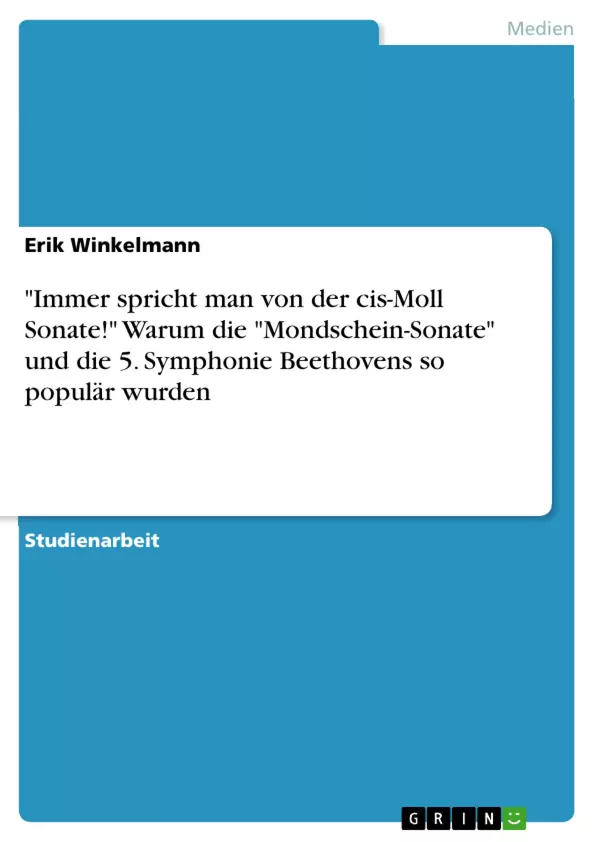Wieso haben diese Werke Beethovens, insbesondere die ersten Sätze, einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht, dass sie heute auch nicht Musik affine Menschen kennen? Dieser Frage widmet sich diese Hausarbeit, wobei besonders auf die beiden ersten Sätze, die bekanntesten, ein besonders Augenmerk gelegt wird.
Die Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27,2 von Ludwig van Beethoven, besser bekannt als die "Mondschein-Sonate", erfreut sich einer beispiellosen Bekanntheit. Beethoven selbst soll die Cis-Moll Sonate als sein meistdiskutiertes Werk betrachtet haben, was sich bis heute in der überwältigenden Menge an Literatur zu diesem Meisterwerk widerspiegelt. Sogar Musiklaien kennen zumindest die einprägsamen Anfangstakte dieser Sonata.
Die Sonate hat einen so hohen Bekanntheitsgrad erreicht, dass sie unter professionellen Pianisten ihren Reiz zu verlieren scheint und seltener in deren Programmen auftaucht. Im Gegensatz dazu erfreut sie sich bei Amateur-Pianisten großer Beliebtheit und wird häufig bei Klavierabenden aufgeführt sowie auf zahlreichen Tonträgern veröffentlicht. Ähnlich verhält es sich mit Beethovens fünfter Symphonie, die so allgemein bekannt ist, dass selbst Nicht-Musikkenner die ersten Noten summen könnten.
Die Entstehungsgeschichte der "Mondschein-Sonate" ist von romantischen Elementen geprägt. Beethoven widmete das Werk seiner Schülerin Giulietta Guicciardi, für die er offensichtlich emotionale Empfindungen hegte. Die Namensgebung der Sonate war schon zu Beethovens Lebzeiten Gegenstand vieler Spekulationen. Es wird vermutet, dass er sich von einem klavierspielenden Mädchen im Mondschein inspirieren ließ. Franz Liszt führte das Werk sogar in abgedunkelten Räumen auf, um die Atmosphäre zu intensivieren.
Der Name "Mondschein-Sonate" wurde jedoch erst später von Ludwig Rellstab geprägt, einem Berliner Musikpublizisten. Während einer nächtlichen Bootsfahrt assoziierte er den ersten Satz der Sonate mit dem schimmernden Mondlicht auf der Wasseroberfläche. Obwohl dieser Name heute am bekanntesten ist, wirft er ein einseitiges Bild auf das Werk, da er sich ausschließlich auf den ersten Satz bezieht und die anderen beiden außer Acht lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27,2 „Mondschein-Sonate“
- Widmung
- Namensgebung
- Musikalische Auffälligkeiten
- Auftreten der „Mondschein-Sonate“ im Laufe der Zeit
- Die „Mondschein-Sonate“ in Filmen, Videospielen und moderner Musik
- Fünfte Symphonie c-Moll, op. 67
- Musikalische Auffälligkeiten
- Rezeption der c-Moll Symphonie
- Uraufführung und Zeitgenossen Beethovens
- Romantik
- Moderne
- Musikverlage als Motoren der Popularisierung
- Wien und die Wiener Klassik als Einflussfaktor der Popularität Beethovens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Gründe für die hohe Popularität der „Mondschein-Sonate“ und der fünften Symphonie Beethovens. Es wird untersucht, welche Faktoren zu ihrem Bekanntheitsgrad beigetragen haben und wie sie im Laufe der Zeit wahrgenommen und interpretiert wurden.
- Musikalische Besonderheiten der „Mondschein-Sonate“ und der fünften Symphonie
- Die Rolle von Widmungen und Namensgebungen
- Die Bedeutung von Musikverlagen und Vermarktung
- Der Einfluss des musikalischen Umfelds der Wiener Klassik
- Die Rezeption der Werke in verschiedenen Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einleitung und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor. Die beiden folgenden Kapitel widmen sich der „Mondschein-Sonate“ und der fünften Symphonie Beethovens, wobei besonders auf die musikalischen Besonderheiten, die Widmung und Namensgebung sowie die Rezeption in verschiedenen Epochen eingegangen wird.
Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Rolle von Musikverlagen in der Popularisierung von Werken sowie dem Einfluss des musikalischen Umfelds der Wiener Klassik auf Beethovens Popularität.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Mondschein-Sonate“, „Fünfte Symphonie“, „Beethoven“, „Popularität“, „Musikalische Auffälligkeiten“, „Rezeption“, „Musikverlage“, „Wiener Klassik“. Sie analysiert die Gründe für die besondere Bekanntheit und Popularität der beiden Werke Beethovens und beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die zu ihrem Erfolg beigetragen haben.
- Quote paper
- Erik Winkelmann (Author), 2017, "Immer spricht man von der cis-Moll Sonate!" Warum die "Mondschein-Sonate" und die 5. Symphonie Beethovens so populär wurden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/934677