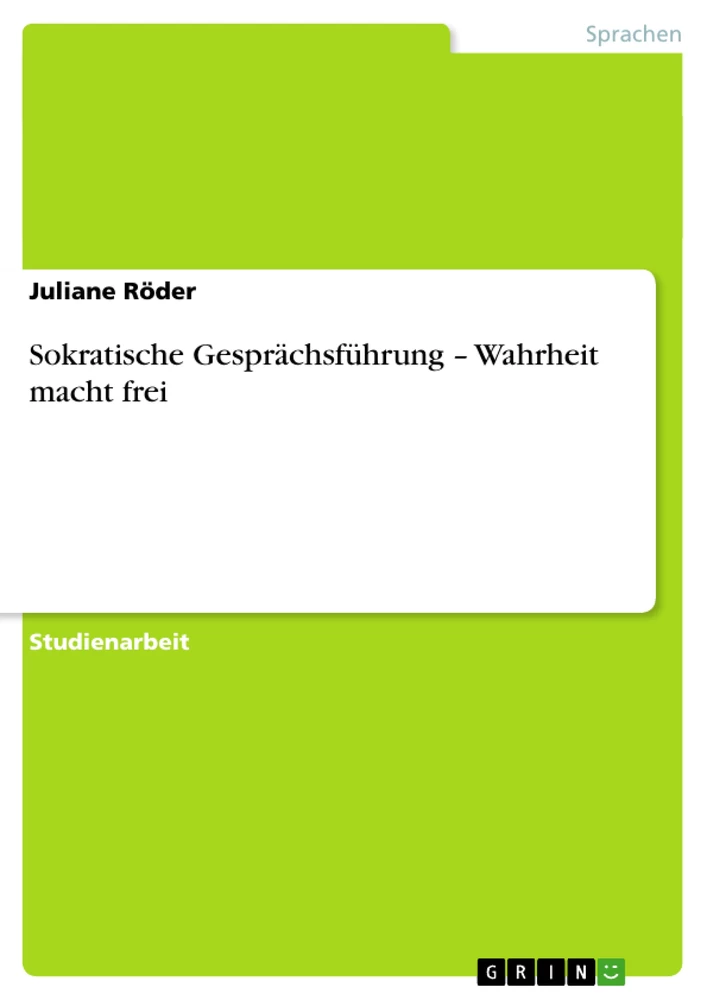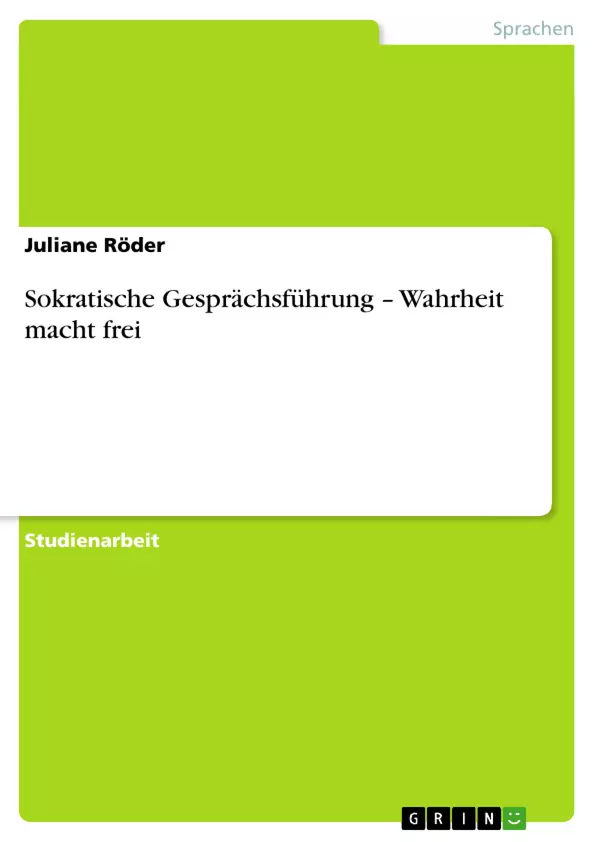Angesichts des Fortschritts der Erziehungswissenschaften ist es sehr erstaunlich, dass eine Methode, die vor 2500 Jahren aufgezeichnet wurde und seitdem Unmengen an Versuchen, Nachahmungen oder Weiterentwicklungen vorzuweisen hat, bis zur heutigen Zeit immer noch nicht tiefgründig genug erforscht worden ist. Doch was ist eigentlich die sokratische Methode? Ist sie die Kunst der Philosophie oder eher die Kunst, Philosophieren zu lehren und aus Schülern Philosophen zu machen? Philosophie ist hier in erster Linie der Inbegriff jener allgemeinen Vernunftwahrheiten, die nur durch Denken klar werden. Philosophieren ist somit nichts anderes, als mit Hilfe des Verstandes solche abstrakten Vernunftwahrheiten zu isolieren und in allgemeinen Urteilen auszusprechen. Doch wie können die philosophischen Prinzipien vermittelt werden? Vielleicht als Tatsachenberichte?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Wer war Sokrates?
- III. Sokrates - Begründer der Psychotherapie?
- IV. Die Lehre des Sokrates
- V. Der Weg zur inneren Verwirrung
- VI. Mäeutik
- VII. Didaktische Hilfsmittel und Argumentationsweise
- VIII. Phasenmodell der antiken sokratischen Dialoge
- IX. Beispiel eines Dialoges
- X. Fehler und Paradoxien
- XI. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der sokratischen Methode und ihrem Einfluss auf die moderne Philosophie und Psychologie. Sie untersucht die Geschichte und Philosophie des Sokrates sowie die Grundprinzipien seiner Lehre. Der Text beleuchtet die Bedeutung der sokratischen Gesprächsführung und ihre Rolle in der Selbstfindung und der Erkenntnisgewinnung.
- Die Geschichte und Philosophie des Sokrates
- Die sokratische Methode und ihre Prinzipien
- Die Bedeutung der sokratischen Gesprächsführung
- Die Rolle der sokratischen Methode in der Selbstfindung und Erkenntnisgewinnung
- Die Kritik an der sokratischen Methode und ihre Paradoxien
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sokratischen Methode ein und stellt die Bedeutung dieser Philosophie für die heutige Zeit dar. Die Autorin hinterfragt die Relevanz der sokratischen Methode, die trotz ihrer langen Geschichte bis heute nicht vollumfänglich erforscht worden ist.
II. Wer war Sokrates?: Dieses Kapitel bietet eine biographische Einführung in das Leben des Sokrates. Es beschreibt seine Zeit, seine Tätigkeit als Philosoph und seine Auseinandersetzung mit den Sophisten. Des Weiteren wird die Anklage und Verurteilung des Sokrates durch das Gericht in Athen beleuchtet.
III. Sokrates - Begründer der Psychotherapie?: In diesem Kapitel wird die Frage untersucht, ob Sokrates als Begründer der Psychotherapie angesehen werden kann. Die Autorin analysiert die Methoden und Zielsetzungen der sokratischen Gesprächsführung und untersucht ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede zur modernen Psychotherapie.
IV. Die Lehre des Sokrates: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Prinzipien der sokratischen Lehre. Die Autorin analysiert die Bedeutung der Selbsterkenntnis, der Vernunft und der Suche nach Wahrheit in der Philosophie des Sokrates.
V. Der Weg zur inneren Verwirrung: Das Kapitel beschreibt die sokratische Methode als einen Weg zur Selbstfindung und Erkenntnisgewinnung. Es wird der Prozess der inneren Verwirrung erläutert, der durch die sokratischen Fragen entsteht, und seine Bedeutung für die Veränderung der eigenen Denkweise.
VI. Mäeutik: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Mäeutik, der „geburtshelfenden Kunst", die Sokrates als Methode zur Befreiung von Selbsttäuschung und zur Entdeckung der Wahrheit verwendet hat.
VII. Didaktische Hilfsmittel und Argumentationsweise: Hier werden die verschiedenen didaktischen Hilfsmittel und Argumentationsweisen der sokratischen Methode vorgestellt. Es wird die Bedeutung der Ironie, der Elenktik (Widerlegung) und der Suche nach Widersprüchen im sokratischen Dialog beleuchtet.
VIII. Phasenmodell der antiken sokratischen Dialoge: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Phasen eines typischen sokratischen Dialogs. Die Autorin analysiert die Abläufe und Ziele des Gesprächs von der anfänglichen Verwirrung bis hin zur Erkenntnisgewinnung.
IX. Beispiel eines Dialoges: Dieses Kapitel bietet ein Beispiel für einen sokratischen Dialog. Die Autorin demonstriert die Anwendung der sokratischen Methode anhand eines konkreten Beispiels und zeigt die Funktionsweise der Methode in der Praxis.
X. Fehler und Paradoxien: Dieses Kapitel befasst sich mit den möglichen Fehlern und Paradoxien, die im Rahmen der sokratischen Methode auftreten können. Die Autorin analysiert kritisch die Schwächen der Methode und untersucht ihre Grenzen.
Schlüsselwörter
Sokratische Methode, Sokrates, Philosophie, Gesprächsführung, Mäeutik, Elenktik, Selbstfindung, Erkenntnisgewinnung, Wahrheit, Selbsttäuschung, Ironie, Paradoxien, Didaktik, Psychologie, Psychotherapie
- Quote paper
- Juliane Röder (Author), 2003, Sokratische Gesprächsführung – Wahrheit macht frei, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93181