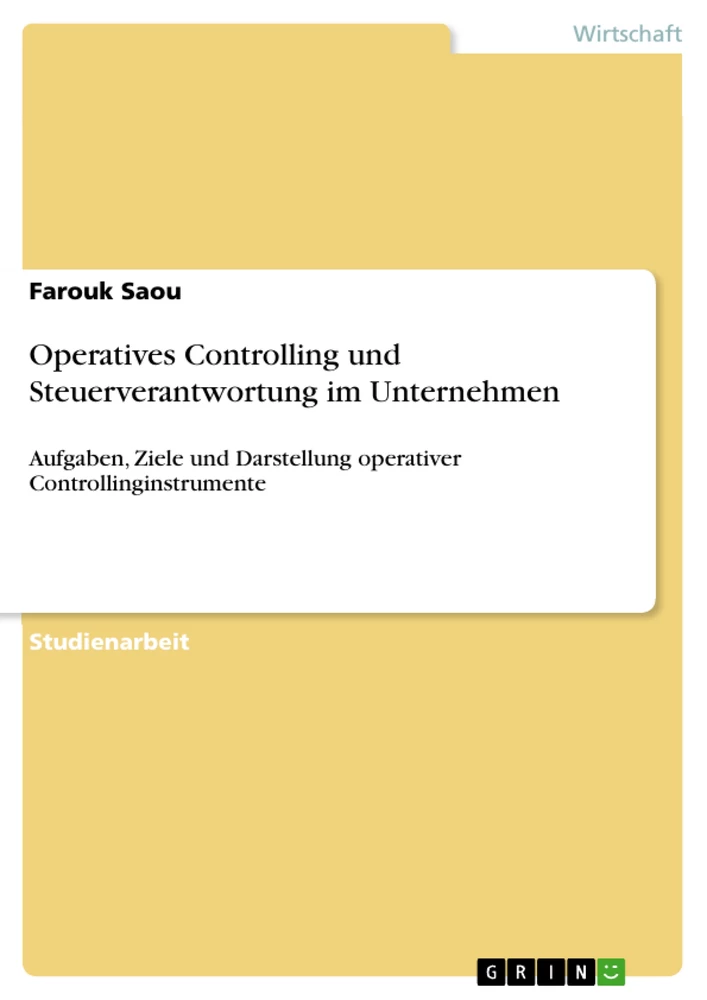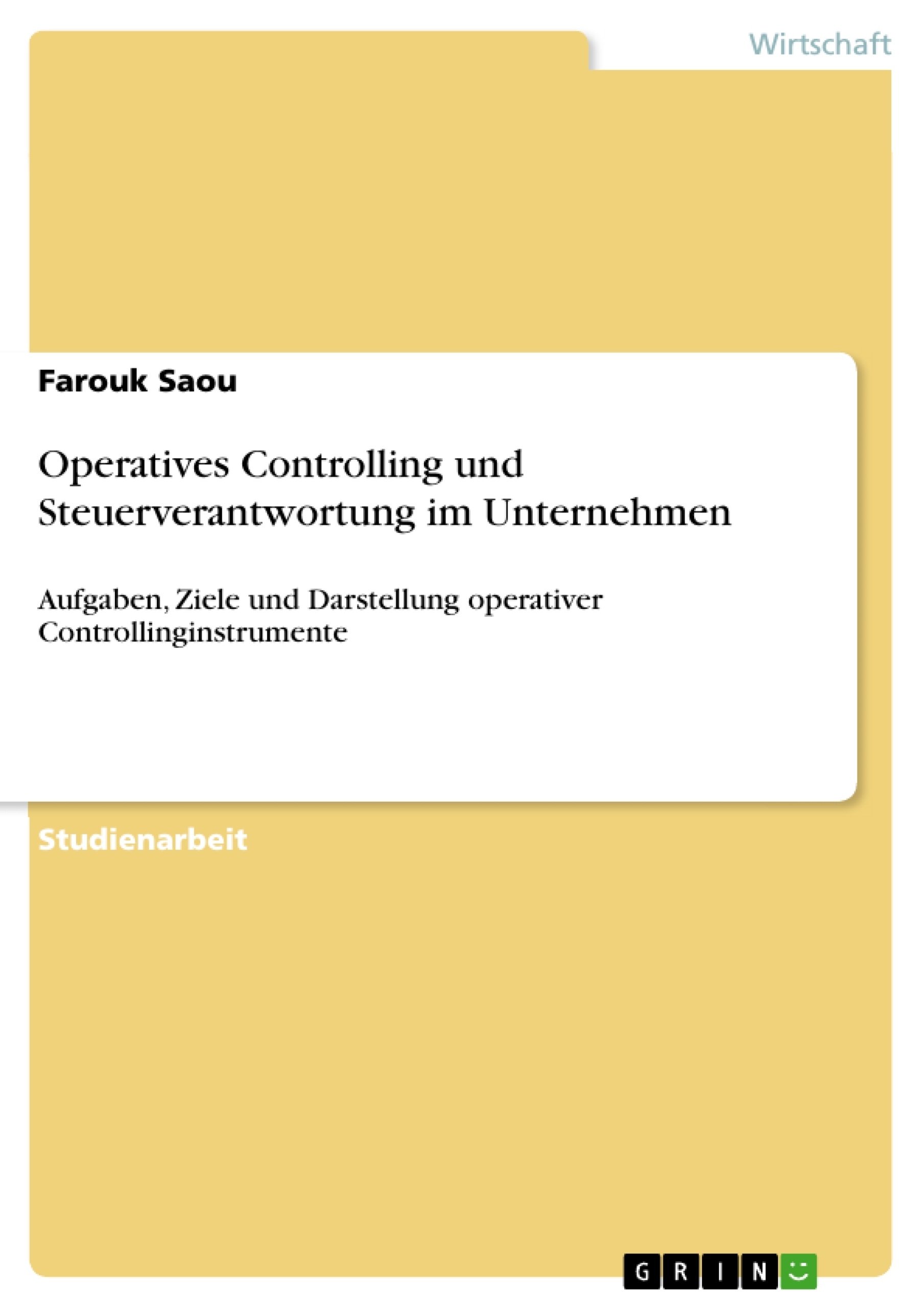Die Arbeit stellt Instrumente vor, die im Bereich des operativen Controllings im Unternehmen zum praktischen Einsatz kommen. Verschiedene Unternehmensbereiche werden begutachtet, um einen möglichst umfassenden Überblick über die Vielfältigkeit der eingesetzten Werkzeuge zu erlangen. Insbesondere wird untersucht, welche Wirkung der Einsatz von operativen Controllinginstrumenten hervorruft und wie die Ergebnisse aus der Anwendung genutzt werden können.
Es erfolgt die Einordung des Themas in den Themenbereich Controlling. Durch die Definition von Aufgaben und Zielen und die Darstellung einer übergeordneten Wirkungsweise der operativen Controllinginstrumente werden die Grundlagen des Themenbereiches erarbeitet. Dann stellt ein Überblick die Vielfalt der Werkzeuge in den verschiedenen Unternehmensfunktionen dar. Es wird beispielhaft je ein Instrument der operativen Planung, der Kontrolle und der Informationsversorgung auf Aufbau und Wirkungsweise untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgaben des operativen Controllings
- Definition Controllinginstrumente
- Ziele und Zielgrößen des operativen Controllings
- Quantitative Zielgrößen
- Qualitative Zielgrößen
- Operative Controllinginstrumente
- Übersicht: Operative Controllinginstrumente
- Instrumente des Vertriebscontrollings
- Instrumente des Personalcontrollings
- Instrumente des Produktions- und Qualitäts-Controllings
- Instrumente des Beschaffungscontrollings
- Instrumente des Logistikcontrollings
- Operative Instrumente der Planung
- Beispiel operatives Planungsinstrument: Budgetierung
- Operative Instrumente der Informationsversorgung
- Beispiel operative Instrumente zur Informationsversorgung: ABC-Analyse
- Operative Kontrollinstrumente
- Beispiel für operative Kontrollinstrumente: Soll-Ist-Vergleiche durch Kennzahlen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Instrumente des operativen Controllings und deren Anwendung in verschiedenen Unternehmensbereichen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der eingesetzten Werkzeuge zu geben und deren Wirkung sowie die Nutzung der Ergebnisse zu analysieren. Die Arbeit ordnet das Thema im Kontext des Controllings ein und erarbeitet die Grundlagen durch die Definition von Aufgaben und Zielen sowie die Darstellung der Wirkungsweise der Instrumente.
- Definition und Aufgaben des operativen Controllings
- Vielfalt operativer Controllinginstrumente in verschiedenen Unternehmensbereichen
- Analyse von Planungs-, Kontroll- und Informationsinstrumenten
- Wirkungsweise und Anwendung der Instrumente
- Zusammenspiel der Instrumente im Regelkreis des Controllings
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der operativen Controllinginstrumente ein und beschreibt den Umfang und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Absicht erklärt, einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der eingesetzten Werkzeuge in verschiedenen Unternehmensbereichen zu liefern und deren Wirkung sowie die Nutzung der erzielten Ergebnisse zu untersuchen. Die Arbeit ordnet das Thema in den Kontext des Controllings ein und legt die Grundlagen durch die Definition der Aufgaben und Ziele sowie die Darstellung der Wirkungsweise der Instrumente.
Aufgaben des operativen Controllings: Dieses Kapitel befasst sich mit den Hauptaufgaben des operativen Controllings, die in Planung, Kontrolle und Steuerung bestehen. Es wird betont, dass diese Aufgaben eng miteinander verknüpft sind und einen Regelkreis bilden. Zusätzlich wird die wichtige Rolle der Informationsversorgung als wesentliche vierte Aufgabe hervorgehoben. Das Kapitel erläutert, wie diese Aufgaben die ergebnisorientierte und zielgerichtete Steuerung der Unternehmensziele unterstützen und auf quantifizierbaren Daten aus Vergangenheit und Gegenwart basieren.
Operative Controllinginstrumente: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über operative Controllinginstrumente in verschiedenen Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Personal, Produktion, Beschaffung und Logistik. Es werden exemplarisch Instrumente der operativen Planung (z.B. Budgetierung), Kontrolle (z.B. Soll-Ist-Vergleiche) und Informationsversorgung (z.B. ABC-Analyse) im Detail erläutert und deren Aufbau und Wirkungsweise analysiert. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der Vielfältigkeit und des breiten Anwendungsspektrums dieser Instrumente.
Schlüsselwörter
Operatives Controlling, Controllinginstrumente, Planung, Kontrolle, Steuerung, Informationsversorgung, Regelkreis, Unternehmenssteuerung, Kennzahlen, Budgetierung, ABC-Analyse, Soll-Ist-Vergleich, Vertriebscontrolling, Personalcontrolling, Produktionscontrolling, Beschaffungscontrolling, Logistikcontrolling.
Häufig gestellte Fragen zu "Operative Controllinginstrumente"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Operative Controllinginstrumente"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über operative Controllinginstrumente. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Instrumente, ihrer Anwendung in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und ihrer Wirkungsweise im Kontext des Controllings.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Aufgaben des operativen Controllings (Planung, Kontrolle, Steuerung, Informationsversorgung), die Vielfalt der operativen Controllinginstrumente in verschiedenen Unternehmensbereichen (Vertrieb, Personal, Produktion, Beschaffung, Logistik), die Analyse von Planungs-, Kontroll- und Informationsinstrumenten (z.B. Budgetierung, ABC-Analyse, Soll-Ist-Vergleiche), die Wirkungsweise und Anwendung der Instrumente und deren Zusammenspiel im Regelkreis des Controllings.
Welche Arten von Controllinginstrumenten werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt eine breite Palette an operativen Controllinginstrumenten, darunter Instrumente der operativen Planung (z.B. Budgetierung), der Kontrolle (z.B. Soll-Ist-Vergleiche) und der Informationsversorgung (z.B. ABC-Analyse). Es werden Instrumente für verschiedene Unternehmensbereiche wie Vertriebscontrolling, Personalcontrolling, Produktionscontrolling, Beschaffungscontrolling und Logistikcontrolling detailliert betrachtet.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der operativen Controllinginstrumente zu geben und deren Anwendung in verschiedenen Unternehmensbereichen zu analysieren. Es soll die Wirkungsweise der Instrumente sowie die Nutzung der erzielten Ergebnisse verdeutlichen und das Thema im Kontext des gesamten Controllings einordnen.
Wie sind die Aufgaben des operativen Controllings definiert?
Die Hauptaufgaben des operativen Controllings werden als Planung, Kontrolle und Steuerung definiert. Diese Aufgaben sind eng miteinander verknüpft und bilden einen Regelkreis. Die Informationsversorgung wird als eine weitere, wichtige Aufgabe hervorgehoben, die die anderen drei unterstützt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Operatives Controlling, Controllinginstrumente, Planung, Kontrolle, Steuerung, Informationsversorgung, Regelkreis, Unternehmenssteuerung, Kennzahlen, Budgetierung, ABC-Analyse, Soll-Ist-Vergleich, Vertriebscontrolling, Personalcontrolling, Produktionscontrolling, Beschaffungscontrolling, Logistikcontrolling.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in verschiedene Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu den Aufgaben des operativen Controllings und den verschiedenen operativen Controllinginstrumenten. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen, um die Navigation und den Überblick zu erleichtern.
- Arbeit zitieren
- Farouk Saou (Autor:in), 2020, Operatives Controlling und Steuerverantwortung im Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/924364