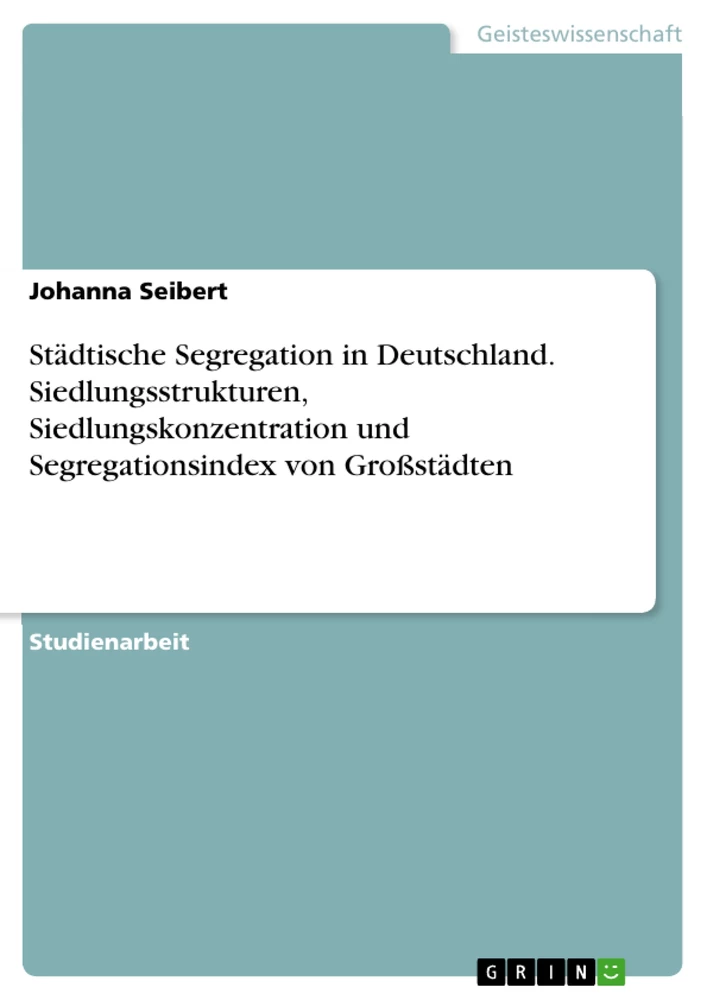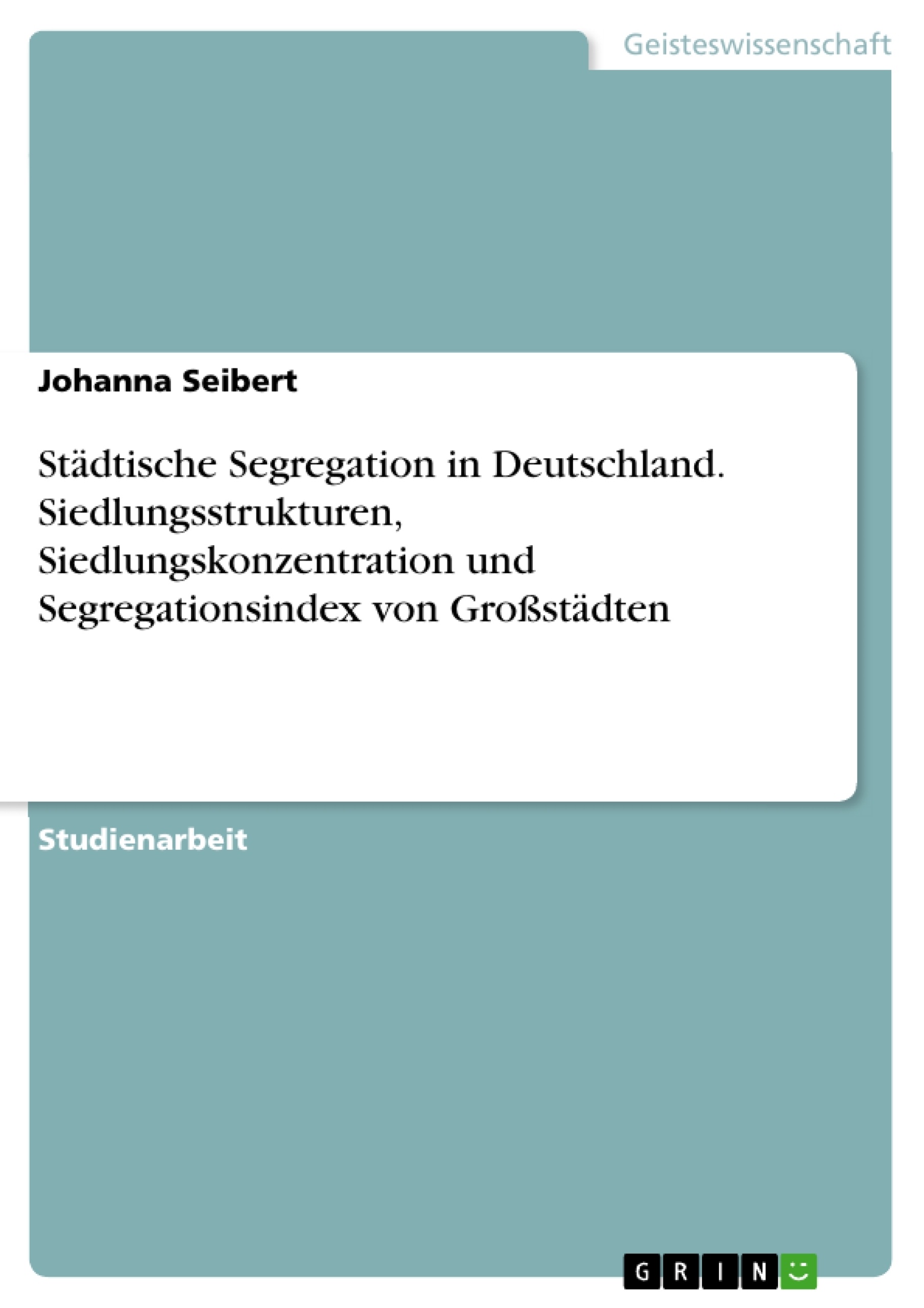Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe der soziologischen Theorie zum Thema Segregation die Situation der Großstädte anhand der Siedlungsstrukturen, Siedlungskonzentration und des Segregationsindex in Deutschland zu skizzieren. Das zweite Kapitel ist auf die Bearbeitung der theoretischen Grundlagen und die Ausarbeitung der Definitionen, Dimensionen, Erklärungsansätze sowie Effekte fokussiert. Im dritten Kapitel werden Daten aus der Studie der Arbeitsstelle für Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung herangezogen, um die aktuelle Situation aufzuzeigen. Die hier verwendeten Daten sind die Ergebnisse von Analysen aus der amtlichen Statistik der Städte und des Datensatzes der Innerstädtischen Raumbeobachtung (IRB). Aufgrund der Dimension dieser Arbeit und der Datenlage in Deutschland können nur Grundzüge der Siedlungsstrukturen von Migranten aufgezeigt werden (Schönwälder und Söhn 2007). Die Ergebnisse dieser Studie und deren Konsequenzen werden im vierten Kapitel diskutiert.
Der Ursprung der Stadt- und Raumsoziologie geht auf das beginnende 20. Jahrhundert zurück. Im Zuge der Industrialisierung und des damit einhergehenden Prozesses der Urbanisierung kam es zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum in den Städten. Seitdem werden die Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen im Kontext der Stadt untersucht. Weitere Themenfelder der Stadt- und Raumsoziologie sind das Beobachten von ethnischen Gemeinschaften innerhalb des städtischen Raums sowie die Untersuchung von geschlechtsspezifischen Lebensfeldern (Kneer und Schroer 2010). Der Forschungsstand dieser Themen wird im Folgenden dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 2.1 Definitionen: Integration und Segregation
- 2.2 Dimensionen der Segregation
- 2.2.1 Demographische Segregation
- 2.2.2 Soziale Segregation
- 2.2.3 Ethnische Segregation
- 2.3 Erklärungsansätze für Segregation in Städten
- 2.3.1 Wohnstandortwahl
- 2.3.2 Strukturelle Bedingungen
- 2.3.3 Soziale Distanz und Diskriminierung
- 2.3.4 Aufenthaltsdauer
- 2.4 Effekte der Segregation
- 2.4.1 Positive Effekte
- 2.4.2 Negative Effekte
- 3 Empirie
- 3.1 Siedlungsstrukturen einzelner Nationalitäten
- 3.2 Migrantenviertel und Siedlungskonzentration
- 3.3 Segregationsindex
- 4 Konsequenzen der Segregation in Deutschland
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die städtische Segregation in Deutschland unter Einbezug soziologischer Theorien. Sie skizziert die Situation in Großstädten anhand von Siedlungsstrukturen, Siedlungskonzentration und dem Segregationsindex. Die Arbeit analysiert theoretische Grundlagen, Definitionen, Dimensionen, Erklärungsansätze und Effekte der Segregation.
- Definition und Dimensionen von Integration und Segregation
- Erklärungsansätze für Segregation in städtischen Räumen
- Analyse von Siedlungsstrukturen und Migrantenvierteln
- Der Segregationsindex als Messinstrument
- Konsequenzen der Segregation in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema städtische Segregation ein und beschreibt den Forschungsstand. Sie benennt den Fokus der Arbeit auf die Analyse der Situation in deutschen Großstädten mithilfe soziologischer Theorien und die Verwendung empirischer Daten zur aktuellen Situation. Die Arbeit verweist auf bestehende Literatur und Forschungslücken hinsichtlich kontinuierlicher Berichterstattung über Segregationsprozesse.
2 Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert die Begriffe Integration und Segregation nach verschiedenen soziologischen Perspektiven, unterscheidet die Dimensionen der Segregation (demografisch, sozial, ethnisch) und erläutert verschiedene Erklärungsansätze wie Wohnstandortwahl, strukturelle Bedingungen, soziale Distanz, Diskriminierung und Aufenthaltsdauer. Es beschreibt außerdem die positiven und negativen Effekte von Segregation.
3 Empirie: Das Kapitel präsentiert empirische Daten, hauptsächlich aus Studien der Arbeitsstelle für Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI), um die aktuelle Situation der städtischen Segregation in Deutschland zu beleuchten. Es analysiert Siedlungsstrukturen einzelner Nationalitäten, Migrantenviertel und Siedlungskonzentrationen und verwendet den Segregationsindex als Messinstrument. Aufgrund des Umfangs der Arbeit und der Datenlage können nur Grundzüge der Siedlungsstrukturen von Migranten dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Städtische Segregation, Integration, Segregation, Demographische Segregation, Soziale Segregation, Ethnische Segregation, Siedlungsstrukturen, Migrantenviertel, Siedlungskonzentration, Segregationsindex, Deutschland, Soziologie, Soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Städtische Segregation in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die städtische Segregation in Deutschland unter Einbezug soziologischer Theorien. Sie analysiert theoretische Grundlagen, Definitionen, Dimensionen, Erklärungsansätze und Effekte der Segregation und beleuchtet die Situation in deutschen Großstädten anhand von Siedlungsstrukturen, Siedlungskonzentration und dem Segregationsindex. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten, hauptsächlich von der Arbeitsstelle für Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Dimensionen von Integration und Segregation; Erklärungsansätze für Segregation in städtischen Räumen; Analyse von Siedlungsstrukturen und Migrantenvierteln; Der Segregationsindex als Messinstrument; Konsequenzen der Segregation in Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlage (inkl. Definitionen, Dimensionen und Erklärungsansätze von Segregation sowie deren Effekte), Empirie (Analyse von Siedlungsstrukturen, Migrantenvierteln und dem Segregationsindex), Konsequenzen der Segregation in Deutschland und Zusammenfassung.
Wie werden Integration und Segregation definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe Integration und Segregation nach verschiedenen soziologischen Perspektiven und unterscheidet die Dimensionen der Segregation (demografisch, sozial, ethnisch).
Welche Erklärungsansätze für Segregation werden betrachtet?
Die Arbeit erläutert verschiedene Erklärungsansätze für Segregation, darunter Wohnstandortwahl, strukturelle Bedingungen, soziale Distanz, Diskriminierung und Aufenthaltsdauer.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die empirischen Daten stammen hauptsächlich aus Studien der Arbeitsstelle für Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) und beleuchten die Siedlungsstrukturen einzelner Nationalitäten, Migrantenviertel und Siedlungskonzentrationen. Der Segregationsindex wird als Messinstrument verwendet.
Welche Konsequenzen der Segregation werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Konsequenzen der Segregation in Deutschland, obwohl der Umfang der Arbeit und der Datenlage nur Grundzüge der Siedlungsstrukturen von Migranten darstellen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Städtische Segregation, Integration, Segregation, Demographische Segregation, Soziale Segregation, Ethnische Segregation, Siedlungsstrukturen, Migrantenviertel, Siedlungskonzentration, Segregationsindex, Deutschland, Soziologie, Soziale Ungleichheit.
Welche Forschungslücken werden angesprochen?
Die Arbeit verweist auf bestehende Forschungslücken hinsichtlich kontinuierlicher Berichterstattung über Segregationsprozesse.
Wo finde ich mehr Informationen?
Nähere Informationen finden sich im vollständigen Text der Arbeit (hier nur ein Auszug).
- Arbeit zitieren
- Johanna Seibert (Autor:in), 2016, Städtische Segregation in Deutschland. Siedlungsstrukturen, Siedlungskonzentration und Segregationsindex von Großstädten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/922938