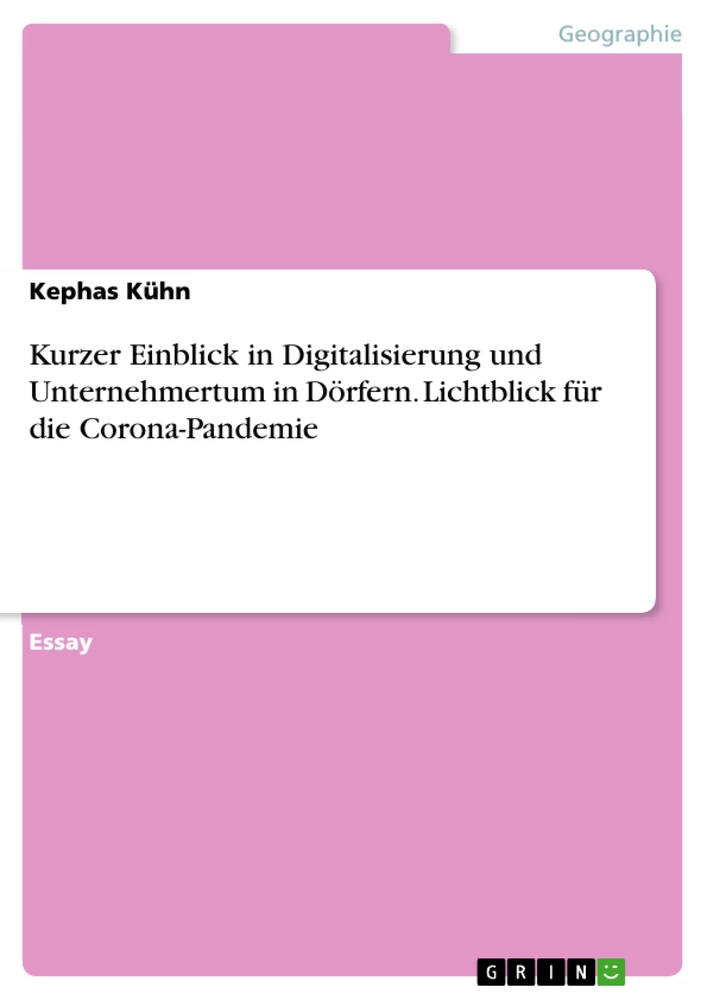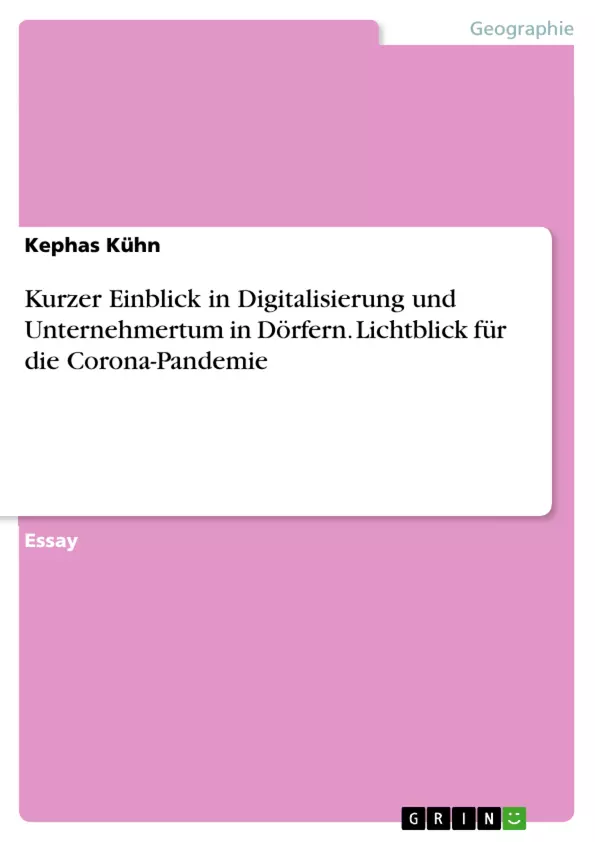Ausgehend von den beschriebenen Möglichkeiten der Digitalisierung im ländlichen Raum und der vorhandenen Wirtschaftsstruktur, ergeben sich für mich folgende Themenbereiche: Die Corona-Pandemie bestimmt mittlerweile den Alltag von allen Menschen, die im Tagesablauf ganz neue Herausforderungen bewältigen müssen. Dadurch stehen wir nicht nur im direkten privaten Umfeld, sondern auch im Berufsleben, bei ehrenamtlichen Tätigkeiten und bei der Gestaltung unserer Freizeit vor erheblichen Einschränkungen und müssen unseren Lebensalltag neu strukturieren. Das ist eine Gesamtkonstellation, die nicht nur von der Bundeskanzlerin Angela Merkel als ein historisches Ereignis bezeichnet wird, welches es seit dem zweiten Weltkrieg in diesem Umfang nicht gegeben hat.
Dieser Notstand beinhaltet jedoch auch die Chance, die Vorteile der Strukturen im ländlichen Raum im Vergleich zu dem eher unpersönlichen Lebensalltag der Städte wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Dorfbewohner kennen sich untereinander und können sich so gegenseitig unterstützen. Die berufliche Abhängigkeit von größeren Zentren in der Umgebung, führt jedoch zu einem Rückgang dieser persönlichen Kontakte. Auch der Rückgang der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum und der Abbau von dörflichen Strukturen erschwert in dieser Notsituation dennoch die Lösung von Anforderungen im Alltag.
An diesem Punkt stellt sich mir die Frage, wie auf der einen Seite mit Hilfe der digitalen Technologien eine Vereinfachung der Lösungsstrategien erreicht werden kann? Auf der anderen Seite sehe ich aber auch neue Herausforderungen durch den häufig auch im ländlichen Raum eher unpersönlichen Kontakt. Es gilt also an dieser Stelle einen optimalen Mittelweg zwischen diesen Thesen zu finden. Wenn also beispielsweise in einer größeren Gemeinde ein Familienzentrum besteht, welches die Unterstützung von älteren Gemeindemitgliedern beim Einkauf des täglichen Bedarfs gewährleistet, so erfordert die Corona-Pandemie einen kontaktlosen Austausch von Informationen.
Dafür gilt es sowohl die Berührungsängste der Dorfbewohner in Bezug auf die Nutzung von digitalen Technologien zu senken, als auch die Entwicklung von digitalen Lösungen voranzutreiben. Hier muss auch der Vergleich zwischen unterschiedlichen Regionen gezogen werden, um herauszufinden, welche Unterschiede bei den Eigenschaften der ländlichen Räume und bei der Umsetzung von neuen Problemlösungen relevant sind. Es gilt also zu erforschen, welche Akteure für die Umsetzung nötig sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Thematischer Einstieg
2. Struktur im ländlichen Raum
3. Die Zielsetzung einerVorgehensweise
4. Ausblick auf Forschungsergebnisse
5. Literaturverzeichnis
1. Thematischer Einstieg
Neben der Erprobung von zukunftsfähigen Lösungen durch die Digitalisierung in urbanen Räumen, sind auch für den ländlichen Raum Modellprojekte in den Bereichen Mobilität, Daseinsvorsorge und Arbeitsalltag von großem Nutzen. Gerade für die Überbrückung von Distanzen im ländlichen Raum sind neue Logistikkonzepte oder die Vereinfachung von Medizi- nischerVersorgung durch die Digitalisierung von großem Vorteil. Schon jetztwerden im Bundesgebiet Projekte im ländlichen Raum realisiert, welcher 90% der Fläche einnimmt und 50 % der Bevölkerung beheimatet, (vgl. BMEL 2017: 2)
Voraussetzung für die Umsetzung dieser Modellprojekte ist ein lückenloser Ausbau der Breitbandtelekommunikationsnetze, welcher aktuell von der Bundesregierung gefördert und umgesetzt wird. Bereits 75% derAnschlüsse ermöglichen die Nutzung von leistungsfähigem Internet, wobei es noch eine ungleiche Verteilung zwischen urbanen Zentren und den ländlichen Gebieten in Deutschland zu verzeichnen gibt. Diese Tatsache behindert aktuell noch die wirtschaftliche Weiterentwicklung und die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und sollte durch eine bundesweite Strategie für die Digitalisierung ausgeglichen werden. (vgl. BMEL2017:7)
Für die Realisierung von innovativen Digitalisierungsprojekten im ländlichen Raum bietet sich eine integrative Umsetzung an, in der der Bund, die Kommunen, die Unternehmen und die Bevölkerung über alle Dimensionen hinweg kooperieren. Dafür wurde das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) aufgebaut, mit dem durch die Umsetzung von Modellprojekten, wie „Land.Digital", auch die Nutzung der Digitalisierung für neue Lösungsansätze erprobt wird. (vgl. BMEL 2019: 8-11)
Daraus ergeben sich innovative Herangehensweisen, um dem demografischen Wandel, der wirtschaftlichen Weiterentwicklung und der Fachkräftesicherung im ländlichen Raum zu begegnen. Vergangene Entwicklungsmaßnahmen waren in erster Linie auf die Agrarwirtschaft bezogen, welche in vielen Regionen vorherrscht. Für die Zukunft ist es jedoch notwendig alle Wirtschaftsbereiche in vielfältige Wertschöpfungsketten zusammenzufassen, um eine zukünftige Gestaltung des ländlichen Raumes zu ermöglichen, (vgl. ZDH 2018)
2. Struktur im ländlichen Raum
Die Bedeutung von ländlichen Räumen nimmt aktuell wieder zu, weil diese viele Funktionen für den täglichen Lebensbedarf erfüllen und in erster Linie als Wohn- aber auch als Arbeitsort dienen. Neben der Nutzung durch die Agrar- und Waldwirtschaft gewinnen sie auch als Standort für Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen wieder an Bedeutung. Dabei handelt es sich in erster Linie um kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), welche im produzierenden Gewerbe oder im Dienstleistungssektor tätig sind. Hinzu kommen wichtige Naturschutzfunktionen und die Nutzung als Naherholungsgebiet, (vgl. BMEL 2016: 4)
In Deutschland finden sich in ländlichen Regionen neben klassischen und innovativen KMU auch einige „HiddenChampions“, die sich durch eine Spezialisierung als Weltmarktführer etabliert haben. Diese Unternehmensstruktur hat eine große Bedeutung für die nationale Wirtschaft und trägt entscheidend zum globalen Exporterfolg von Deutschland bei. Im ländlichen Raum sind 75% der Mitarbeiter in KMU angestellt, die sich oft durch eine Verknüpfung von Unternehmensführung und-eigentümer auszeichnen, (vgl. Margarian 2019: 12-13) Die Eigenschaften des Lebens der Bewohner in ländlichen Räumen nähern sich durch Pendelverkehr und insbesondere durch die Nutzung von neuen Medien dem Bevölkerungsverhalten in Oberzentren an. Die Abgrenzung zu diesen Zentren erfolgt über folgende Eigenschaften: geringere Bevölkerungs- und Siedlungsdichte, großer Anteil an landwirtschaftlicher Fläche, Wäldern und Gewässer, weniger Bebauung und eine größere Entfernung zu den Zentren. Die Struktur der ländlichen Gebiete und deren Entwicklungsstand unterscheiden sich im gesamten Bundesgebiet deutlich, (vgl. BMEL 2016: 4)
In der Bundesrepublik haben im ländlichen Raum circa 87% der Unternehmen bis zu 10 Mitarbeiter und werden als Kleinstunternehmen bezeichnet. Betrachtet man den Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen, so entfallen in den neuen Bundesländern zwölf Prozent und in den alten Bundesländern meistens einen halben Prozentanteil mehr auf diese Unternehmensgröße. Lediglich in den Oberzentren ohne einen angegliederten Kreis beträgt der Anteil etwa 11%. (vgl. Margarian 2019: 12-13)
Diese Unternehmen können neben den großen Unternehmen in Großstädten bestehen, weil sie im Gegensatz zu diesen Wettbewerbern weniger Personal mit hohen Qualifikationen einstellen und sich auf Wirtschaftsbereiche konzentrieren, in denen weniger Wissen gefordert wird. Weiter nutzen die Unternehmen im ländlichen Raum andere Einsatzmittel als die großen Firmen in Großstädten und erhalten sich dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit, (vgl. Margarian 2019: 12-13) Um diese Bedeutung für die Wirtschaft in Deutschland zu erhalten, bedarf es einer gleichwertigen Unterstützung durch eine moderne Verkehrsanbindung und leistungsfähigen Breitbandausbau mit mobilem Internet, (vgl. ZDH 2018)
3. Die Zielsetzung einer Vorgehensweise
Ausgehend von den beschriebenen Möglichkeiten der Digitalisierung im ländlichen Raum und der vorhandenen Wirtschaftsstruktur, ergeben sich für mich folgende Themenbereiche: Die Corona-Pandemie bestimmt mittlerweile den Alltag von allen Menschen, die im Tagesablauf ganz neue Herausforderungen bewältigen müssen. Dadurch stehen wir nicht nur im direkten privaten Umfeld, sondern auch im Berufsleben, bei ehrenamtlichen Tätigkeiten und bei der Gestaltung unserer Freizeit vor erheblichen Einschränkungen und müssen unseren Lebensalltag neu strukturieren. Das ist eine Gesamtkonstellation, die nicht nur von der Bun- deskanzlerin Angela Merkel als ein historisches Ereignis bezeichnet wird, welches es seit dem zweiten Weltkrieg in diesem Umfang nicht gegeben hat.
Dieser Notstand beinhaltetjedoch auch die Chance, die Vorteile der Strukturen im ländlichen Raum im Vergleich zu dem eher unpersönlichen Lebensalltag der Städte wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Dorfbewohner kennen sich untereinander und können sich so gegenseitig unterstützen. Die berufliche Abhängigkeit von größeren Zentren in der Umgebung, führt jedoch zu einem Rückgang dieser persönlichen Kontakte. Auch der Rückgang der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum und der Abbau von dörflichen Strukturen erschwert in dieser Notsituation dennoch die Lösung von Anforderungen im Alltag.
An diesem Punkt stellt sich mir die Frage, wie auf der einen Seite mit Hilfe der digitalen Technologien eine Vereinfachung der Lösungsstrategien erreicht werden kann? Auf der anderen Seite sehe ich aber auch neue Herausforderungen durch den häufig auch im ländlichen Raum eher unpersönlichen Kontakt. Es gilt also an dieser Stelle einen optimalen Mittelweg zwischen diesen Thesen zu finden. Wenn also beispielsweise in einer größeren Gemeinde ein Familienzentrum besteht, welches die Unterstützung von älteren Gemeindemitgliedern beim Einkauf des täglichen Bedarfs gewährleistet, so erfordert die Corona- Pandemie einen kontaktlosen Austausch von Informationen.
Dafür gilt es sowohl die Berührungsängste der Dorfbewohner in Bezug auf die Nutzung von digitalen Technologien zu senken, als auch die Entwicklung von digitalen Lösungen voranzutreiben. Hier muss auch derVergleich zwischen unterschiedlichen Regionen gezogen werden, um herauszufinden, welche Unterschiede bei den Eigenschaften der ländlichen Räume und bei der Umsetzung von neuen Problemlösungen relevant sind. Es gilt also auch zu erforschen, welche Akteure für die Umsetzung der Modellprojekte und die Aktivierung von wichtigen Lernprozessen erforderlich sind, um die ländlichen Räumewieder zu einem wahrgenommenen und attraktiven Lebensraum zu machen. Vielleicht können diese sogar die Städte bei der erfolgreichen Bewältigung von dieser Notlage, die für die heutige Generation völlig unbekannt ist, noch mit ihren historischen Vorteilen einholen.
4. Ausblick auf Forschungsergebnisse
In diesem Jahr steht die Welt vor zum Teil völlig neuen Herausforderungen. Das Gesundheitswesen sieht sich einer neuen Aufgabe gegenüber, die Wirtschaft muss für dieses Geschäftsjahr neue sozialverträgliche Konzepte entwickeln und die Bevölkerung steht einem neuen Alltag gegenüber, den es zusammen zu bewältigen gilt. Dieses neue Miteinander will natürlich erstmal gelernt sein und erfordert aufbauend auf den bisherigen Forschungsergebnissen der letzten 10 Jahre einen Neustart in eine neue Förderperiode mit neuen Ideen und der Nutzung von natürlichen Ressourcen. Ausgehend von einer Wirtschaftskrise, welche sich in vier Phasen, aufbauend auf den Bemühungen der letzten zehn Jahre entwickeln wird, kann eine Vorgehensweise für die Entwicklung einer neuen Strategie mit der Integration von Forschungsergebnissen entwickelt werden, (vgl. Stelter2020)
In der digitalen Transformation entstehen exponentielle Prozesse, welche unter dem Metatrend „Digitalisierung“ zusammengefasst werden. Grundlage dieser Prozesse sind Algorithmen, welche sowohl eine mathematische Abfolge von Entscheidungsfindungen als auch die Ideen und Forschungsergebnisse von beteiligten Mitarbeitern enthalten, (vgl. Harhoff, Cuntz 2015: 178) Im Anschluss an die Entwicklungskonzepte für die Einführung von Industrie 4.0 erfordern diese neuen Prozesse, eine Neuaufstellung der unternehmensinternen Mitarbeiterprozesse, welche die Führungsebene vor neue Entscheidungsführungen stellt, um die externen Angebote auf die Bedürfnisse von neuen Kundengruppen abzuwandeln und die Gesellschaftsbedürfnisse zu integrieren, (vgl. Schellinger, u.A. 2020: 1-9)
Das bisher entwickelte „Computer Integratet Manufacturing“ (CIM) für die Steuerung von Supply-Chain-Prozessen hat Produktionsprozesse mit digitalen Prozessen verknüpft, um eine bedarfsgerechte Steuerung zu ermöglichen. Zu dieser Zeit wurde der Maschinenbau in den Vordergrund gestellt und die Steuerung auf die Bemessung von Input- und OutputFaktoren fokussiert, welchejedoch die Auswirkungen der industriellen Tätigkeit durch einen zentralisierten Ansatz außer Acht gelassen haben. Aktuell steht jedoch Schritt für Schritt ein dezentralerAnsatz im Vordergrund um die zukünftigen Auswirkungen der Unternehmensführung zu integrieren, welcher sich erheblich von den bisherigen Erfolgskonzepten unterscheidet. Hinzu kommt, dass die neuen Prozesse eine Steigerung der Innovationsfähigkeit und die Integration von neuen Aspekten ermöglichen können, (vgl. von See 2019: 1-4) Diese neuen Aspekte können andere Werte der Gesellschaft, wie die sozialverträgliche Entwicklung von Mitarbeitern oder die Einplanung von Freizeitgestaltung beinhalten und ermöglichen weiter eine Verknüpfung von Familiengestaltung und beruflichen Aspekten. Hier gilt es auch die kleinen und mittleren Unternehmen auf dem Land zu unterstützen, um die unbestrittene Bedeutung für die deutsche Wirtschaft wieder in den Vordergrund zu stellen und das Wissen aus den urbanen Räumen auch hier nutzbar zu machen, (vgl. Harhoff, Cuntz 2015: 184) Ausgründungen aus den Hochschulen sollten sich auch verstärkt auf die Aspekte im ländlichen Raum beziehen, um durch den Austausch von Erfahrungen auch hier wieder einen angenehmen Lebensalltag mit den notwendigen Dingen des Alltags im Rahmen einer ausgeglichenen Daseinsvorsorge zu ermöglichen, (vgl. Wehmeier 2012: 47)
Im Rahmen eines integrativen Wissens- und Technologietransfers ermöglicht die Digitalisierung im ländlichen Raum eine schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeitzwischen KMU und Hochschulen der Region. Ein Austausch von gesammelten Daten und die Zusammenarbeit in Modellprojekten kann durch die Nutzung von schnellen Datentransferverbindungen erleichtert werden. Das wiederum ermöglicht eine schnellere Entwicklung von Innovationen und einen stetigen Austausch von fachbezogenen Fragen und dazu passenden Lösungsvorschlagen, (vgl. Hirte 2018: 11-13) DerAustausch von Studierenden und die Weiterqualifizierung von Fachpersonal kann durch diese neuen Kontaktwege wesentlich erleichtert werden, weil auch der Transfer von Ausschreibungen und Qualifizierungsmaterial wesentlich erleichtert wird. Da bisher noch deutliche Vorbehalte in Bezug auf den Austausch von sensiblen Informationen bei allen beteiligten Akteuren bestehen, gilt es die Zusammenarbeit durch geschickte Maßnahmen zu unterstützen. Dafür gibt es interessante Ansätze, wie die Integration von digitalen Lösungsansätzen in KMU durch entsprechend geschulte Auszubildende, welche kreative Ideen in die Unternehmen einbringen können, (vgl. Heitzer-Priem 2018: 7-9)
Im ländlichen Raum bietet die Digitalisierung gegenüber den urbanen Einsatzmöglichkeiten völlig neue Möglichkeiten, welche gerade die Land- und Forstwirtschaft bei der Bewältigung von neuen klimatischen Bedingungen unterstützen kann. Der Klimawandel stellt die Politik in der Zusammenarbeit mit ländlichen Wirtschaftszweigen vor neue Herausforderungen, die durch digitale Lösungsansätze bewältigt werden können, (vgl. Gonstalla 2019: 6-7) Die umweltbezogenen Auswirkungen der exponentiellen Steigerung der Wirtschaftsprozesse betreffen durch die damit einhergehenden klimatischen Veränderungen gerade den ländlichen Raum, wobei genau in diesen Regionen wiederum auch die Möglichkeiten für die Absenkung der klimatischen Erwärmung enthalten sind. Im Rahmen der Nachhaltigkeit können durch die Digitalisierung effektive Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden, um eine integrierte Regionalentwicklung zu ermöglichen und den nachhaltigen Tourismus weiter zu entwickeln, (vgl. Sühlmann-Faul, Rammler 2018: 144 ff.)
Die ökologischen Aspekte der digitalen Transformation und die Nutzung von natürlichen Rohstoffen betreffen auch den ländlichen Raum und haben Auswirkungen auf die Politik, die Wirtschaftszweige und die Gesellschaft. Für die Bewältigung des Klimawandels stellt die Schonung der natürlichen Ressourcen die beteiligten Akteure vor neue Aufgaben, welche durch den Einsatz von digitalen Technologien gelöst werden können, (vgl. Schellinger, u.A. 2020: 41-42) Abschließend können meiner Meinung nach unterschiedliche Veränderungen und Herausforderungen der heutigen Zeit, wie der Klimawandel, die Corona-Pandemie, die gesellschaftlichen Veränderungen und die Weiterentwicklung der Wirtschaft durch die Nutzung von digitalen Technologien bewältigt werden. Daneben gilt es jedoch auch die Auswirkungen der digitalen Transformation unter der Berücksichtigung von nachhaltigen Gesichtspunkten zu untersuchen und Lösungsansätze für die Klimaanpassung der integrierten Regionalentwicklung zu erarbeiten. Dies kann unter der Berücksichtigung von Wirkungszusammenhängen zwischen der Ressourceneffizienz, dem Demografischen Wandel und der Innovationsfähigkeit durchgeführt werden, um die Verbindung zu den oben genannten Strukturen im ländlichen Raum herstellen zu können, (vgl. Miosga, Hafner 2014: 57 ff.)
5. Literaturverzeichnis
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume, (2016)
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Digitale Perspektiven für das Land, (2017)
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundesprogramm Ländliche Entwicklung, (2019)
Gonstalla, E., Das Klimabuch, Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken, Bundeszentrale für politische Bildung, Band 10467, (2019)
Harhoff, D., Cuntz, A., Digitale Transformation - Quo vadis, Deutschland?, in: Zeitschrift für Politikberatung (ZPB) / Policy Advice and Political Consulting , Vol. 7, No. 4 (2015), pp. 176188
Heitzer-Priem, U., Den Pfad aufden Gipfel finden, in: RKW-Magazin, (4/2018), Herausgeberin Pastohr, M.
Hirte, C., Ausbildung und Digitalisierung in KMU, in: RKW-Magazin, (4/2018), Herausgeberin Pastohr, M.
Margarian, A., Klein aber fein, Thünen-Institut für Ländliche Räume, in: LandlnForm, Magazin für Ländliche Räume, Ausgabe 4, (2019)
Miosga, M., Hafner, S., Regionalentwicklung im Zeichen der Großen Transformation, Strategien für Ressourceneffizienz, demografischen Wandel und Innovationsfähigkeit, oekom Verlag, München, (2014)
Schellinger, J., Tokarski, K.-O., Kissling-Näf, I., Digitale Transformation und Unternehmensführung, Trends und Perspektiven für die Praxis, Springer Gabler, (2020)
Stelter, D., Wir sind erst in Phase 2 einer vierstufigen Krise - am Ende wird es um alles gehen, in Focus Money Online, URL: https://www.focus.de/finanzen/boerse/experten/was-die- weltwirtschaft-noch-erwartet-krise-wir-sind-jetzt-in-phase-2-von-4-kann-das-system- bestehen_id_11775960.html?x-fol-utm=true, abgerufen am 20.03.2020
Sühlmann-Faul, F., Rammler, S., Der blinde Fleck der Digitalisierung Wie sich Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Einklang bringen lassen, oekom Verlag, München, (2018) Von See, B., Ein Handlungsrahmen für die digitale Transformation in Wertschöpfungsnetzwerken, Vom Promotionsausschuss der Technischen Universität Hamburg zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.) genehmigte Dissertation, (2019)
Wehmeier, A., Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie als Chance für die ländliche Versorgung, in: Gesundheits- und Sozialpolitik , Vol. 66, No. 6, Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Regionen (2012), pp. 47-54 Nomos Verlagsgesellschaft mbH
Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH), Regionalpolitik und Handwerk - Rahmenbedingungen für Unternehmen vor Ort nachhaltig sichern, (2018)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es befasst sich mit der Digitalisierung im ländlichen Raum und deren Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie Mobilität, Daseinsvorsorge, Arbeitsalltag und Wirtschaft.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis angesprochen?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Themen:
- Thematischer Einstieg
- Struktur im ländlichen Raum
- Die Zielsetzung einer Vorgehensweise
- Ausblick auf Forschungsergebnisse
- Literaturverzeichnis
Was sind die zentralen Punkte im thematischen Einstieg?
Der thematische Einstieg betont die Bedeutung von Modellprojekten im ländlichen Raum, die sich auf Bereiche wie Mobilität, Daseinsvorsorge und Arbeitsalltag konzentrieren. Der Ausbau der Breitbandnetze wird als Voraussetzung für die Umsetzung dieser Projekte hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit einer bundesweiten Digitalisierungsstrategie, um die Ungleichverteilung zwischen urbanen und ländlichen Gebieten auszugleichen. Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) wird als Beispiel für eine integrative Umsetzung von Digitalisierungsprojekten genannt.
Welche Strukturen prägen den ländlichen Raum?
Der ländliche Raum erfüllt vielfältige Funktionen als Wohn-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) spielen eine wichtige Rolle. Naturschutz und Naherholung sind ebenfalls bedeutende Aspekte. Es gibt Unterschiede im Entwicklungsstand der ländlichen Gebiete innerhalb Deutschlands, wobei Kleinstunternehmen (bis 10 Mitarbeiter) den Großteil der Unternehmen ausmachen.
Welche Ziele werden mit einer bestimmten Vorgehensweise verfolgt?
Die Zielsetzung konzentriert sich auf die Vereinfachung von Lösungsstrategien mithilfe digitaler Technologien im Kontext der Corona-Pandemie. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Vorteile der Strukturen im ländlichen Raum im Vergleich zu urbanen Lebensweisen wieder in den Vordergrund gestellt werden können, während gleichzeitig die Herausforderungen des unpersönlichen Kontakts berücksichtigt werden. Die Entwicklung digitaler Lösungen und die Senkung von Berührungsängsten gegenüber digitalen Technologien bei der Bevölkerung werden angestrebt. Es wird auch der Vergleich zwischen unterschiedlichen Regionen angestrebt, um relevaten Unterschiede bei Eigenschaften ländlicher Räume und Problemlösungsansätzen zu identifizieren.
Welche Forschungsergebnisse werden in Aussicht gestellt?
Der Ausblick auf Forschungsergebnisse befasst sich mit den Herausforderungen, die sich durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel ergeben. Es wird auf die Notwendigkeit einer neuen Förderperiode mit neuen Ideen und der Nutzung natürlicher Ressourcen hingewiesen. Die digitale Transformation wird als Metatrend betrachtet, der exponentielle Prozesse auslöst. Die Bedeutung eines dezentralen Ansatzes bei der Unternehmensführung, der soziale und ökologische Aspekte integriert, wird hervorgehoben. Es wird auch auf die Unterstützung von KMU im ländlichen Raum und den Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen eingegangen. Die Rolle der Digitalisierung bei der Bewältigung klimatischer Veränderungen und der Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung wird betont.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis enthält verschiedene Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie Studien und Artikel zu Themen wie ländliche Entwicklung, Digitalisierung, Klimawandel und Unternehmensführung. Genannt werden unter anderem: "Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume (2016)", "Digitale Perspektiven für das Land (2017)", "Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (2019)" sowie Werke von Gonstalla, Harhoff, Heitzer-Priem, Margarian und weiteren Autoren.
- Quote paper
- Kephas Kühn (Author), 2020, Kurzer Einblick in Digitalisierung und Unternehmertum in Dörfern. Lichtblick für die Corona-Pandemie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/921121