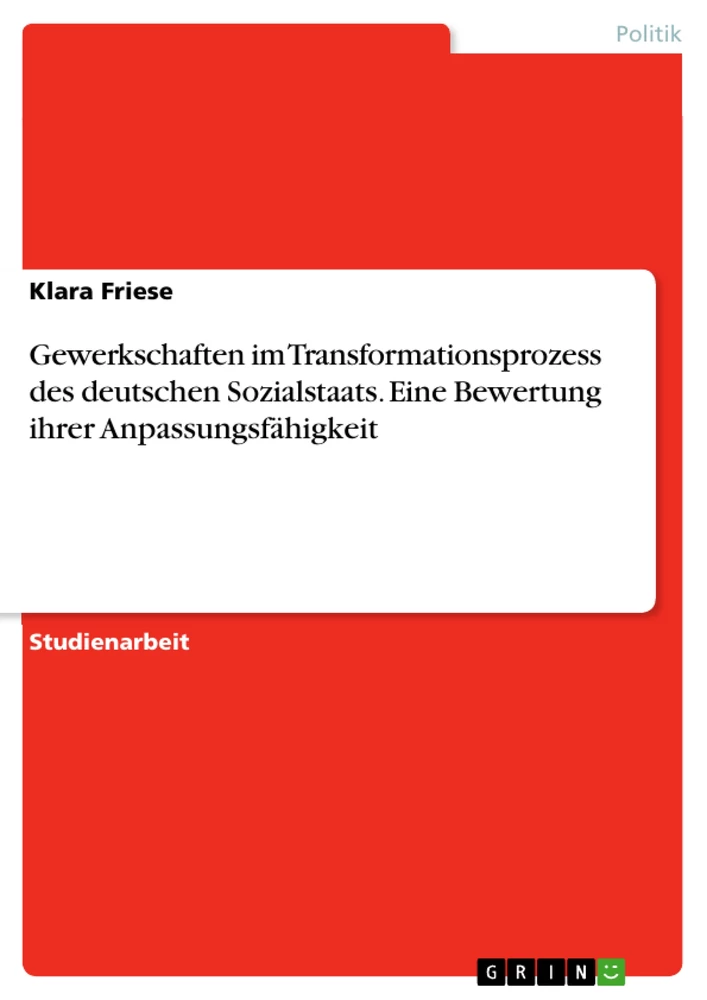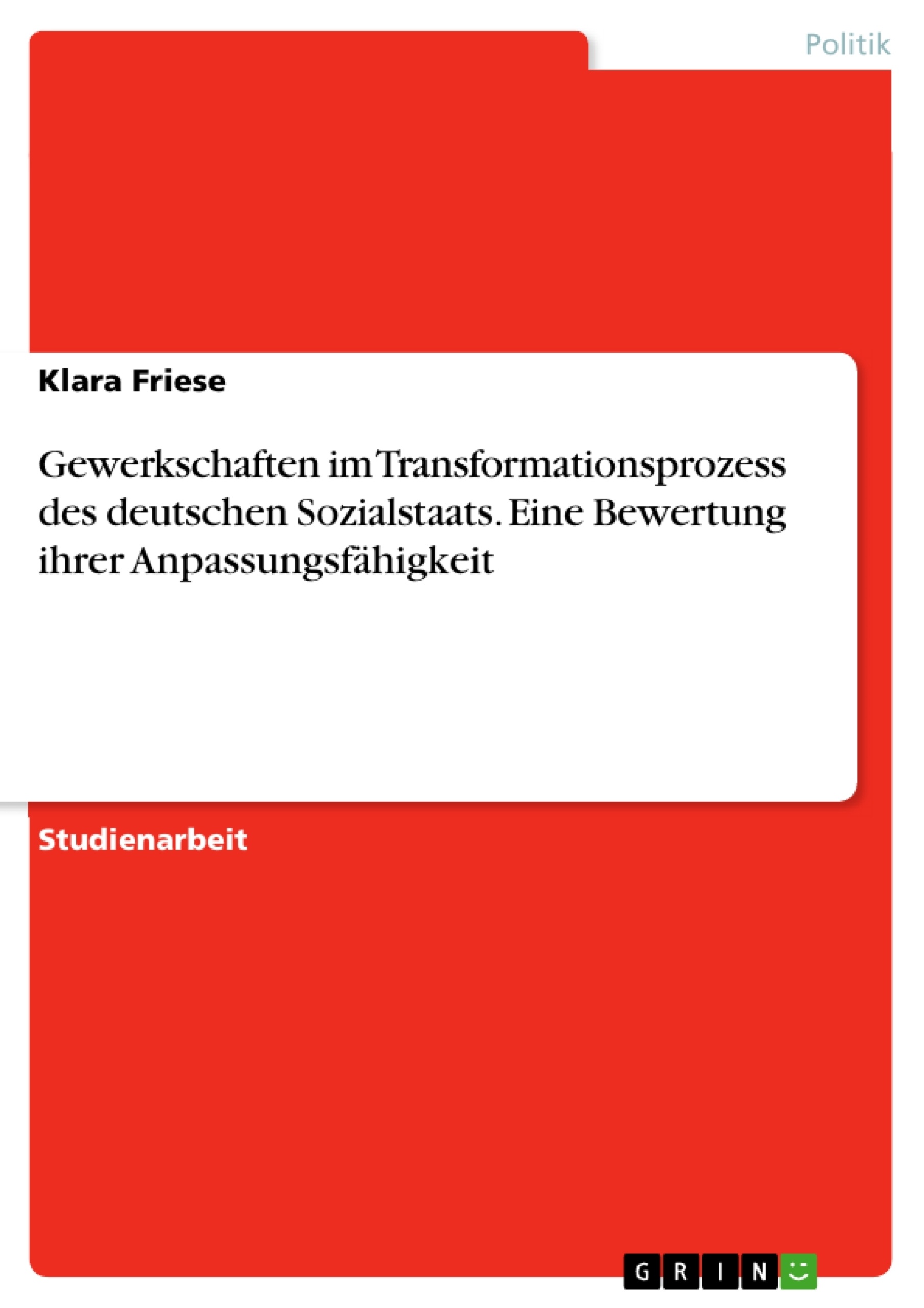Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besteht darin festzustellen, inwiefern Gewerkschaften in dem Kontext des Tranformationsprozesses des deutschen Sozialstaats als anpassungsfähige sozialpolitische Akteure bewertet werden können und somit weiterhin den deutschen Sozialstaat mitgestalten.
Vor allem der zuletzt genannte Aspekt ist interessant, da in der sozialwissenschaftlichen Literatur in diesem Kontext oft von der "Niedergangsthese" der Gewerkschaften zu lesen ist. Um die Forschungsfrage dieser Arbeit angemessen beantworten zu können, sollen zunächst die grundlegenden Funktionen von Gewerkschaften beschrieben werden. Auch werden hier zwei Thesen vorgestellt, die den Gewerkschaften Anpassungsfähigkeit zuschreiben und grundlegend für die Argumentation dieser Arbeit sind.
Im dritten Kapitel wird dann der Machtressourcen-Ansatz vorgestellt, der aus einer theoretischen Perspektive den Wandel des Sozialstaats zu erklären versucht. Des weiteren lassen sich aus diesem Ansatz Kriterien ableiten, an Hand derer die sich im historischen Kontext wandelnde sozialpolitische Funktion von Gewerkschaften bewerten lässt. Diese sich wandelnde Funktion und die These der Anpassungsfähigkeit wird im vierten Kapitel vertieft und historisch chronologisch herausgearbeitet.
Ziel dieses Abschnitts ist es ebenfalls die konfliktgeladene und symbiotische Beziehung zwischen Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft, sowie den Wandel des deutschen Sozialstaats darzustellen. Im fünften Kapitel wird an den Beispielen der Riester- und Hartz-Reform erläutert, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass Gewerkschaften Schwierigkeiten hatten, sozialpolitische Erfolge zu verzeichnen.
Die abschließende Betrachtung der Einführung des Mindestlohns soll hingegen zeigen, dass sich jedoch wieder eine erstarkende sozialpolitische Funktion von Gewerkschaften ausmachen lässt. Im Fazit werden nochmals alle Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gewerkschaften und ihre Funktionen
- 3 Sozialstaatstheorie
- 3.1 Machtressourcen-Ansatz und der Wohlfahrtsstaat
- 3.2 Machtressourcen-Ansatz und Gewerkschaften
- 4 Sozialpolitische Funktionen von Gewerkschaften im historischen Wandel
- 4.1 Von der Industrialisierung bis zum Ende der Weimarer Republik
- 4.2 Der Aufbau des Sozialstaats
- 4.3 Der Ausbau des Sozialstaats
- 4.4 Der Rück-und Umbau des Sozialstaats
- 4.5 Zwischenfazit
- 5 Gewerkschaftlicher Einfluss auf sozialpolitische Refomen seit 2000
- 5.1 Die Riester-Reform und Gewerkschaften
- 5.2 Die Agenda 2010 und Gewerkschaften
- 5.3 Der gesetzliche Mindestlohn und Gewerkschaften
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Anpassungsfähigkeit von Gewerkschaften im Kontext des Transformationsprozesses des deutschen Sozialstaats. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Gewerkschaften im Wandel des Sozialstaats als anpassungsfähige und einflussreiche Akteure betrachtet werden können, die weiterhin an der Gestaltung des Sozialstaats beteiligt sind.
- Die Bedeutung und Funktionen von Gewerkschaften in der deutschen Gesellschaft
- Die Entwicklung des deutschen Sozialstaats im historischen Kontext
- Die Rolle von Gewerkschaften im Transformationsprozess des Sozialstaats
- Die Herausforderungen, denen Gewerkschaften im Kontext der Globalisierung und des neoliberalen Wandels gegenüberstehen
- Der Einfluss von Gewerkschaften auf wichtige sozialpolitische Reformen in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Rolle von Gewerkschaften im Wandel der politischen und wirtschaftlichen Strukturen. Es wird die Bedeutung des deutschen Sozialstaats und die eingeordnete Rolle von Gewerkschaften im Hinblick auf den Aufbau und Ausbau des Sozialstaats im Nachkriegsdeutschland dargestellt. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern diese Einschätzung in der heutigen Zeit noch gültig ist, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der Herausforderungen für den deutschen Sozialstaat.
Das zweite Kapitel definiert die grundlegenden Funktionen von Gewerkschaften und analysiert deren historischen Wandel im Kontext der kapitalistischen Vergesellschaftung. Die Arbeit stellt die drei Funktionen von Gewerkschaften nach Franz Neumann vor, die sich als Genossenschaften, Marktfunktionen und politische Verbände manifestieren. Es wird darauf eingegangen, dass diese Funktionen in Abhängigkeit von den historischen, ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen unterschiedlich stark gewichtet werden.
Das dritte Kapitel widmet sich der Theorie des Machtressourcen-Ansatzes und der Frage, inwiefern dieser den Wandel des Sozialstaats erklärt. Der Ansatz dient als theoretisches Fundament, um die sich im historischen Kontext wandelnde sozialpolitische Funktion von Gewerkschaften zu bewerten.
Kapitel vier befasst sich mit der historischen Entwicklung der sozialpolitischen Funktionen von Gewerkschaften im Kontext des deutschen Sozialstaats. Von der Industrialisierung bis zum heutigen Tag wird die Entwicklung der Beziehung zwischen Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft beleuchtet, mit dem Fokus auf die Herausforderungen und Veränderungen des deutschen Sozialstaats.
Das fünfte Kapitel analysiert den Einfluss von Gewerkschaften auf sozialpolitische Reformen seit dem Jahr 2000, insbesondere die Riester- und Hartz-Reform. Das Kapitel zeigt auf, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass Gewerkschaften in diesen Reformen nur geringen Einfluss hatten. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wird hingegen als Beispiel für eine wiedererstarkte sozialpolitische Funktion von Gewerkschaften aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Gewerkschaften, Sozialstaat, Transformationsprozess, Anpassungsfähigkeit, Wohlfahrtsstaat, Machtressourcen-Ansatz, Sozialpolitik, Globalisierung, neoliberaler Wandel, Riester-Reform, Agenda 2010, Mindestlohn
- Quote paper
- Klara Friese (Author), 2019, Gewerkschaften im Transformationsprozess des deutschen Sozialstaats. Eine Bewertung ihrer Anpassungsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/918572