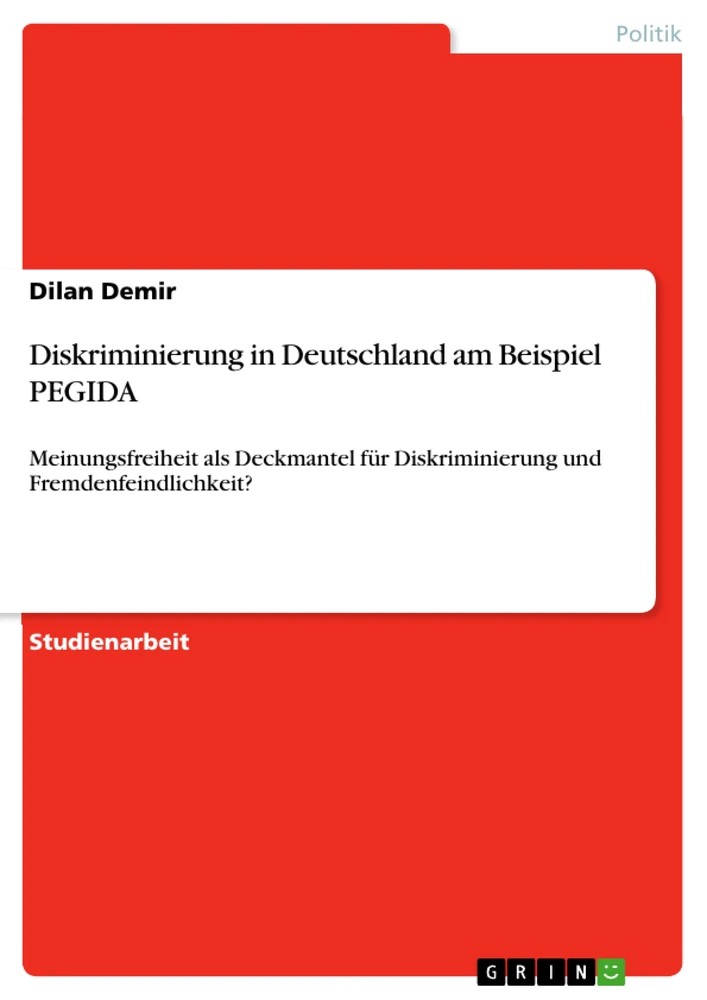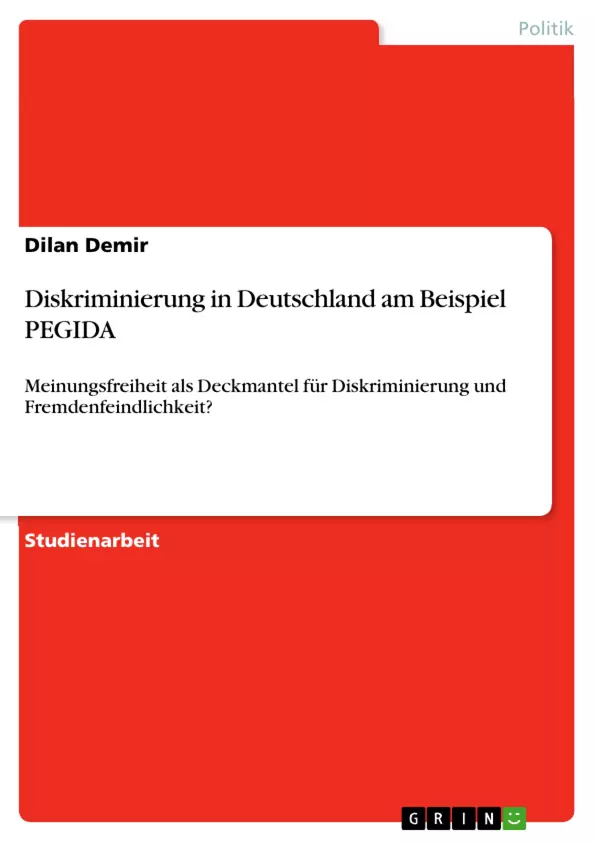Ziel dieser Arbeit ist es, die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierung am Beispiel von PEGIDA herauszuarbeiten. Dabei wird gezielt der Frage nachgegangen, ob die als universell beschriebenen Grundwerte der Meinungsfreiheit und Gleichheit, essentielle demokratische Werte, auch für PEGIDA gelten oder ob diese Werte aus Interessengründen missbraucht werden.
Hierbei ist es wichtig zu überprüfen, um welche Motive es sich bei den Demonstranten handelt und wie diese entstanden sind. Aufgrund des Umfangs der Hausarbeit, beschränke ich mich darauf, die für die Fragestellung exemplarisch wichtigsten Methoden und Konzepte wiederzugeben. Vorerst werden im zweiten Kapitel die wichtigsten Begrifflichkeiten im Rahmen dieser Arbeit erklärt. Anschließend wird im Hauptteil ein genaues Portrait der Bewegung PEGIDA herausgearbeitet, um die Entwicklung und Motive der Bewegung und der Teilnehmer zu verstehen.
Außerdem werden dabei die Ziele der Bewegung dargestellt, um zu überprüfen, welche Interessen die Mitglieder, sowie die Anhänger verfolgen. Danach werden mit dem von Wilhelm Heitmeyer entwickelten theoretischen Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit die herausgearbeiteten Erkenntnisse analysiert.
Im Anschluss wird im vierten Kapitel anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht, welche Folgen und Gefahren eine grenzenlose und menschenverachtende Haltung, die auf Meinungsfreiheit beruht, mit sich ziehen kann und wie man diesen aus Sicht der sozialen Arbeit professionell entgegen kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- PEGIDA
- Meinungsfreiheit
- Fremdenfeindlichkeit - Diskriminierung
- Hauptteil
- Die Entwicklung und Motive von PEGIDA
- Ziele und Forderungen von PEGIDA
- Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nach Heitmeyer
- Praxisgestaltung
- Fallbeispiel „Escheburg“
- Rolle der sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern in Deutschland das Recht auf Meinungsfreiheit als Deckmantel für Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit benutzt wird. Am Beispiel der Bewegung PEGIDA wird untersucht, wo die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierung liegen und ob die universellen Grundwerte der Meinungsfreiheit und Gleichheit auch für PEGIDA gelten.
- Entwicklung und Motive von PEGIDA
- Ziele und Forderungen der Bewegung
- Das Konzept der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ nach Heitmeyer
- Die Folgen und Gefahren einer grenzenlosen und menschenverachtenden Haltung
- Die Rolle der sozialen Arbeit im Umgang mit Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bewegung PEGIDA vor und beschreibt ihren Aufstieg im Kontext der Flüchtlingskrise. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und wo die Meinungsfreiheit einzelner endet, wenn andere Menschen durch deren Meinung abgewertet werden.
Begriffserklärungen
In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe der Arbeit, wie PEGIDA, Meinungsfreiheit und Fremdenfeindlichkeit, wissenschaftlich definiert.
Hauptteil
Der Hauptteil beleuchtet die Entwicklung und Motive von PEGIDA sowie ihre Ziele und Forderungen. Der theoretische Rahmen des Konzepts „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ nach Heitmeyer wird vorgestellt und zur Analyse der Erkenntnisse genutzt.
Praxisgestaltung
Das Kapitel untersucht die Folgen und Gefahren einer grenzenlosen und menschenverachtenden Haltung am Beispiel des Fallbeispiels „Escheburg“. Außerdem wird die Rolle der sozialen Arbeit im Umgang mit Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Meinungsfreiheit, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, PEGIDA, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, soziale Arbeit, und Fallbeispiel Escheburg.
- Quote paper
- Dilan Demir (Author), 2019, Diskriminierung in Deutschland am Beispiel PEGIDA, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/915391