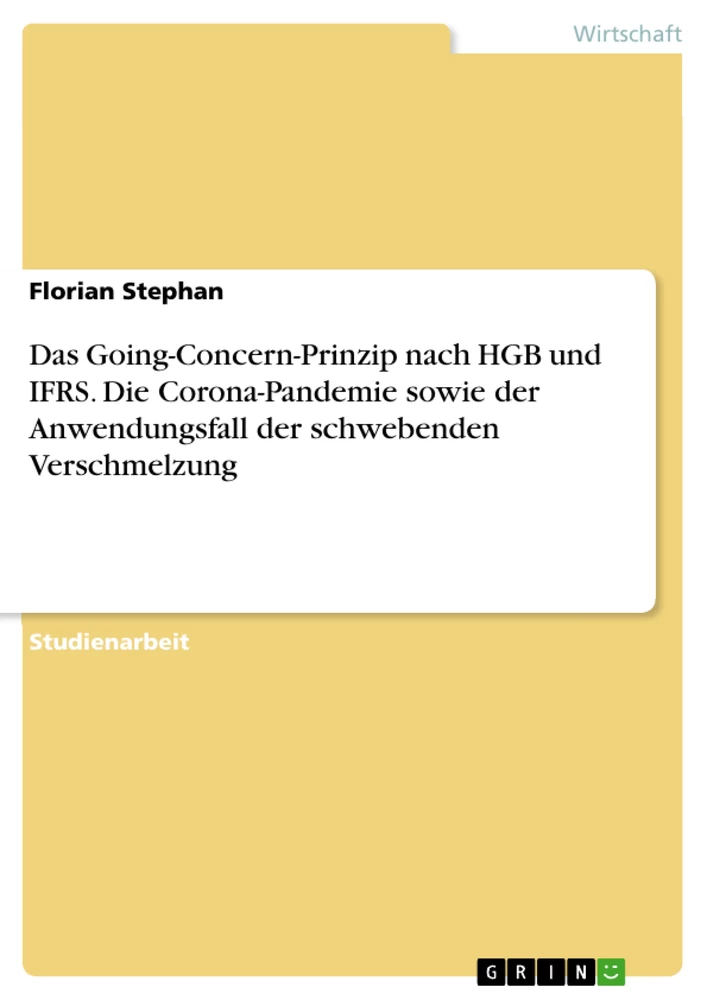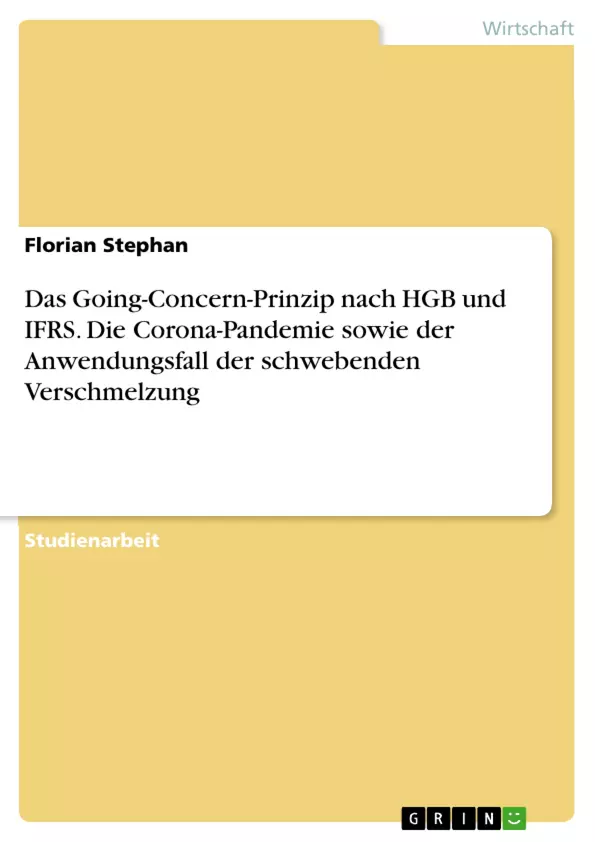Die Arbeit befasst sich mit dem Going-Concern-Prinzip (GCP) als Fundamentalprinzip der nationalen und internationalen Rechnungslegung nach HGB und IFRS. Zunächst werden die rechtlichen Grundlagen und bilanziellen Auswirkungen aufgezeigt und anhand der Corona-Pandemie beispielhaft skizziert. Ferner wird die Arbeit das Going-Concern-Prinzip und dessen Beurteilung in dem (annahmegemäß) verpflichtend aufzustellenden Jahresabschluss des übertragenden Rechtsträgers im Anwendungsfall einer schwebenden Verschmelzung zum Gegenstand haben.
Ziel dieser Arbeit ist es, das GCP im nationalen Kontext nach Handelsrecht sowie im internationalen Kontext nach IFRS/IAS in seinen Grundzügen darzustellen, dessen bilanzielle Auswirkungen aufzuzeigen sowie sich ergebende Ermessensspielräume festzustellen. Diese werden im Nachgang auf den Anwendungsfall einer schwebenden Verschmelzung übertragen. Die Arbeit wird im Folgenden ausschließlich das GCP im Rahmen der Vorschriften des HGB und der IFRS/IAS berücksichtigen, nicht jedoch die Vorschriften des US-GAAP.
Zunächst werden in Kapitel B.I. die Grundzüge sowie bilanzielle Auswirkungen erläutert. Kapitel B.II. befasst sich nachfolgend mit den Gründen und Folgen einer Abkehr vom GCP. Darauf aufbauend wird in Kapitel C die Anwendung des GCP auf den annahmegemäß verpflichtend (noch) zu erstellenden Einzelabschluss des übertragenden Rechtsträgers im Rahmen einer schwebenden Verschmelzung dargelegt und diskutiert. Hierzu werden zuvor in Kapitel C.I. wichtige Grundlagen der Verschmelzung geklärt und im Nachgang auf die Ermessensspielräume im Rahmen der Abschlusserstellung eingegangen. Schließlich folgt in Kapitel D die Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundzüge des Going-Concern-Prinzips nach HGB und IFRS
- I. Rechtliche Grundlagen und bilanzielle Auswirkungen
- II. Grenzen und Abkehr von Going-Concern
- C. Das Going-Concern-Prinzip im Anwendungsfall der schwebenden Verschmelzung
- I. Grundlagen der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG)
- II. Anwendung auf den Jahresabschluss des übertragenden Rechtsträgers
- D. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Going-Concern-Prinzip, einem zentralen Grundsatz der Rechnungslegung. Ziel der Arbeit ist es, die rechtlichen Grundlagen und bilanzielle Auswirkungen des Prinzips sowohl nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) als auch nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu beleuchten. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich das Going-Concern-Prinzip im Anwendungsfall der schwebenden Verschmelzung auswirkt.
- Rechtliche Grundlagen des Going-Concern-Prinzips
- Bilanzielle Auswirkungen des Going-Concern-Prinzips
- Grenzen und Abkehr vom Going-Concern-Prinzip
- Anwendbarkeit des Going-Concern-Prinzips bei einer schwebenden Verschmelzung
- Auswirkungen des Going-Concern-Prinzips auf den Jahresabschluss des übertragenden Rechtsträgers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Going-Concern-Prinzips ein und erläutert die Bedeutung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) für die Rechnungslegung von Unternehmen. Kapitel B beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen und bilanziellen Auswirkungen des Prinzips nach HGB und IFRS. Dabei werden die relevanten Vorschriften und die konkrete Anwendung des Prinzips in der Praxis beleuchtet. In Kapitel C wird das Going-Concern-Prinzip im Kontext der schwebenden Verschmelzung analysiert. Es werden die rechtlichen Grundlagen der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) und die Auswirkungen des Going-Concern-Prinzips auf den Jahresabschluss des übertragenden Rechtsträgers behandelt.
Schlüsselwörter
Going-Concern-Prinzip, Rechnungslegung, Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), Jahresabschluss, Verschmelzung, Umwandlungsgesetz (UmwG), Bilanzierung, Bewertung, Vermögensgegenstände, Schulden, Fortführungs-fähigkeit.
- Arbeit zitieren
- Florian Stephan (Autor:in), 2020, Das Going-Concern-Prinzip nach HGB und IFRS. Die Corona-Pandemie sowie der Anwendungsfall der schwebenden Verschmelzung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/915190