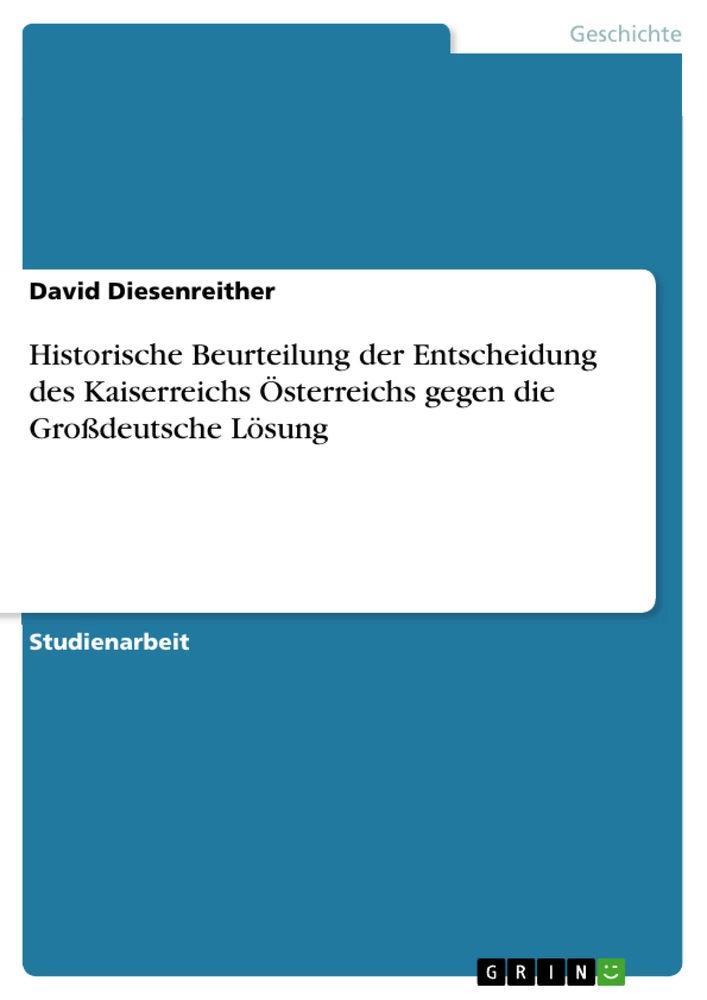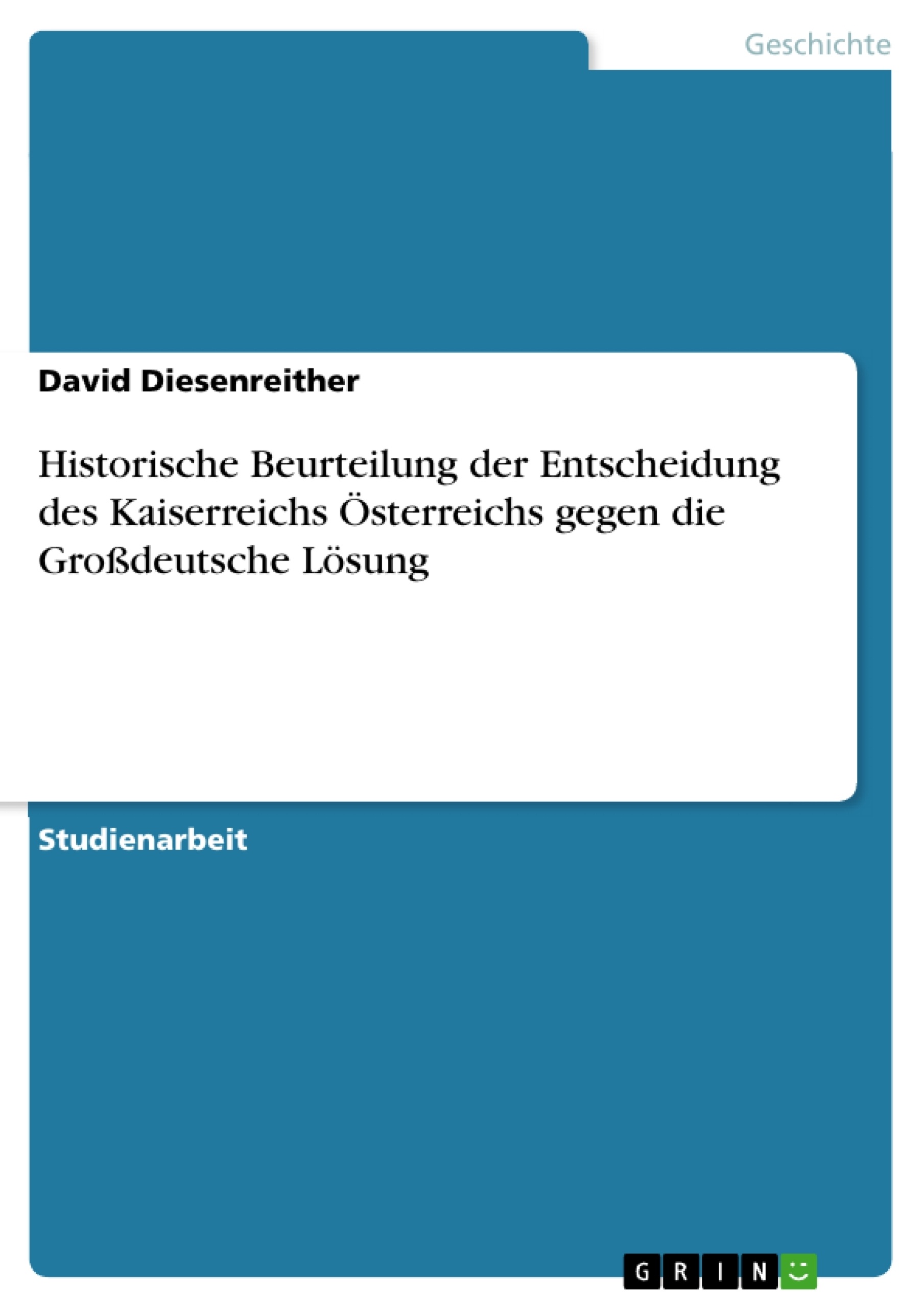Wenn man heute an dieses Thema denkt, scheint es doch sehr fern. Ein Zusammenschluss von Österreich und Deutschland wäre absolut undenkbar. Die meisten österreichischen Staatsbürger fühlen sich als Österreicher, nicht als Deutsche und sehen die Menschen in Deutschland doch sehr differenziert zu denen in Österreich. Dieses Gefühl der eigenen Nationalität bildete sich ganz stark nach dem zweiten Weltkrieg. Doch vorher sahen sich die Österreicher keineswegs als eigenes „Volk“. Sie sahen sich dem deutschen Volk zugehörig, denn Sprache, Kultur und Traditionen teilte man sich mit allen Deutschen.
Das soll also heißen, im Vielvölkerreich, dem Kaiserreich Österreich, fühlte man sich nicht als Österreicher, sondern vielmehr als Kroate, Ungar, Tscheche oder eben Deutscher, und keiner davon hatte einen eigenen, unabhängigen Staat. Das Nationalstaatsbewusstsein, das sich in vielen anderen Staaten in den Jahrhunderten zuvor langsam entwickelt hatte, fehlte im Deutschen, aber auch im mittel- und südeuropäischen Raum durch die Jahrhunderte lange Unterdrückung durch Großmächte und Herrscherhäuser total. Zum ersten Mal kam der deutsche Nationalgedanke bei einem Fest in Hambacher Schloss in größerem Ausmaß zum Vorschein. Bei einem Nationalfest auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt an der Hardt vom 27.-30 Mai 1932, nahmen zwanzig- bis dreißigtausend Menschen aus allen Volksschichten Teil. Unter der Parole: "Nur eine Farbe und ein Vaterland" marschierten die Menschen und kämpften damit für ein Land für alle Deutschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2.1 Warum wollte Österreich kein Teil eines Großdeutschen Reichs werden?
- 3 Die Situation nach der Deutschen Revolution 1848
- 3.1 Die Interessen Österreichs
- 3.2 Die Interessen der übrigen deutschen Staaten
- 3.3 Die Interessen der übrigen Großmächte
- 4 Die Entscheidung gegen die Vereinigung der Deutschen Staaten
- 4.1 Aus der Sicht Österreichs
- 4.2 Aus der Sicht Preußens
- 4.3 Aus der Sicht der übrigen Großmächte
- 5 Die Folgen der Entscheidung Österreichs
- 5.1 Folgen für den europäischen Raum
- 5.2 Folgen für das Kaiserreich Österreich
- 5.3 Folgen für den deutschen Raum
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Österreichs Entscheidung, sich nicht dem Großdeutschen Reich anzuschließen. Die Arbeit analysiert die Gründe für diese Entscheidung und untersucht die Folgen für Österreich, den deutschen Raum und den europäischen Raum im Allgemeinen.
- Die Rolle Österreichs im Deutschen Bund vor dem Hintergrund der deutschen Einheitsbewegung
- Die Interessen Österreichs, Preußens und der anderen Großmächte während der Deutschen Revolution 1848
- Die Entscheidung Österreichs gegen die Vereinigung der deutschen Staaten und die Gründe dafür
- Die Auswirkungen der Entscheidung Österreichs auf die Entwicklung des deutschen Reichs und des europäischen Raumes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die historische Bedeutung der Entscheidung Österreichs. Kapitel 2.1 befasst sich mit den Gründen, warum Österreich kein Teil eines Großdeutschen Reichs werden wollte. Kapitel 3 untersucht die Situation nach der Deutschen Revolution 1848 und die Interessen der verschiedenen deutschen Staaten und Großmächte. In Kapitel 4 wird die Entscheidung gegen die Vereinigung der deutschen Staaten aus den Perspektiven Österreichs, Preußens und der anderen Großmächte betrachtet. Kapitel 5 analysiert die Folgen der Entscheidung Österreichs für den europäischen Raum, das Kaiserreich Österreich und den deutschen Raum. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: Österreich, Deutsches Reich, Deutsche Revolution 1848, Nationalstaat, Großdeutsche Lösung, Kleindeutsche Lösung, europäische Großmächte, Interessenkonflikt, Folgen der Entscheidung.
- Quote paper
- David Diesenreither (Author), 2019, Historische Beurteilung der Entscheidung des Kaiserreichs Österreichs gegen die Großdeutsche Lösung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/914554