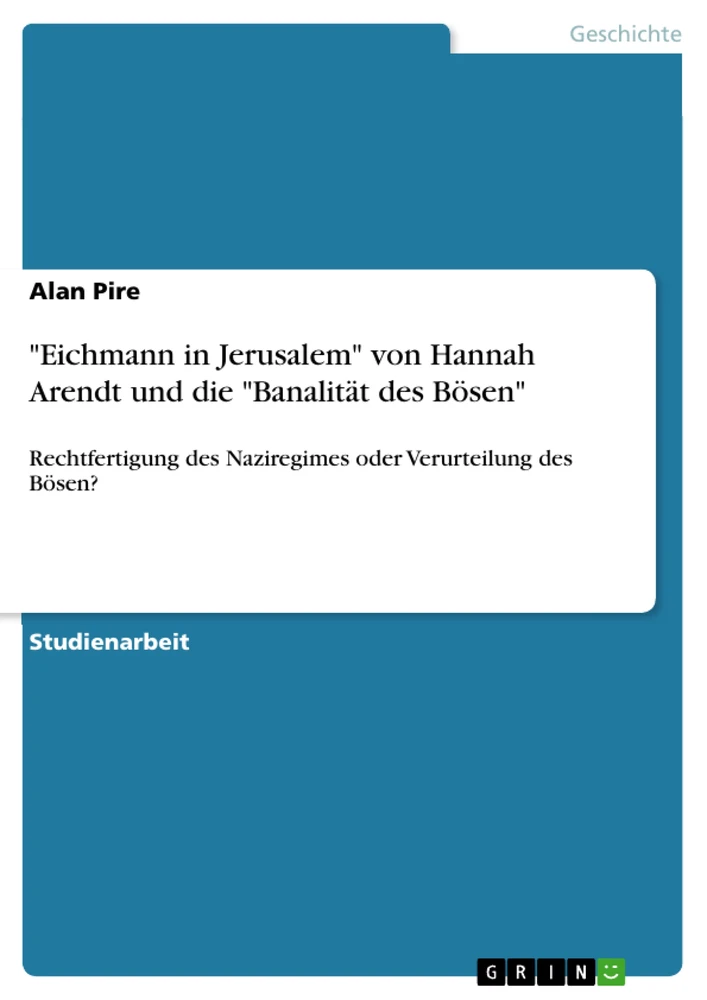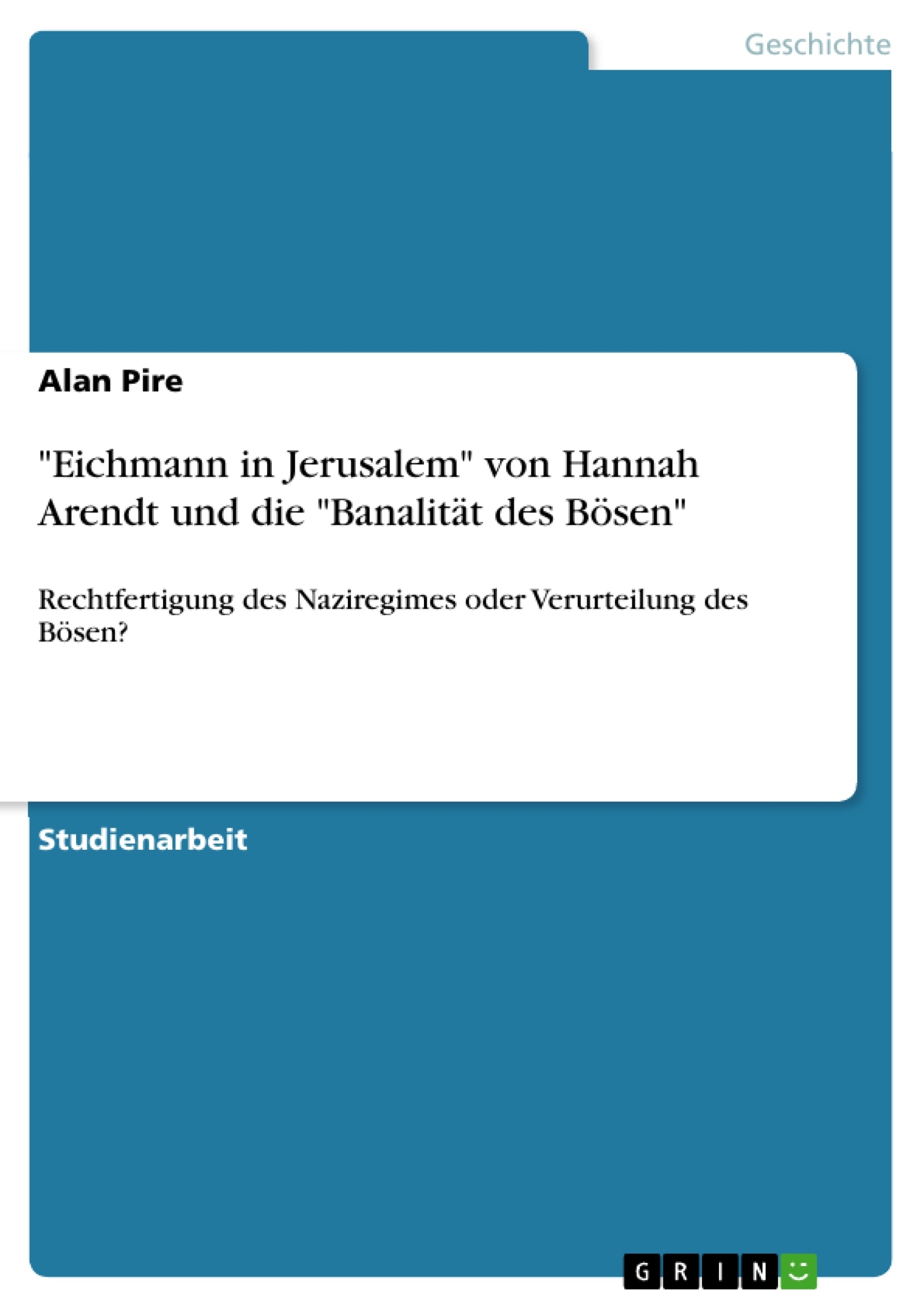Die Berichte der deutsch-jüdischen Historikerin und Politiktheoretikerin Hannah Arendt gegen einen ehemaligen SS-Obersturmbannführer namens Adolf Eichmann in Jerusalem, haben unmittelbar nach deren Veröffentlichung in den jüdischen Kreisen aber auch in den deutschen unter Intellektuellen und zahlreichen Wissenschaftlern für große Kontroversen gesorgt.
Die Arbeit setzt sich mich mit einer qualitativen Inhaltsanalyse der bestehenden wissenschaftlichen Literatur mit der Kontroverse, die infolge ihrer These "Banalität des Bösen" in einem öffentlichen Diskurs sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im Kontext der US-amerikanischen Wahrnehmung der Sache Eichmanns aber auch der Einstellung von Arendt gegenüber der jüdischen Frage im Großen und Ganzen, entstanden ist, auseinander.
Hannah Arendt hat die Persönlichkeit Eichmanns als "NO Body" und sein Böse als "banal" bezeichnet, eine Art Verurteilung, mit der sie in ihrem Buch "Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen" veröffentlicht im Jahre 1963, sagen wollte, dass der Böse an sich selbst sehr zu banal ist, und Eichmann war einer der Opfer dieser Banalität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprung der Kontroverse
- Was beinhaltet der Bericht Arendts von der Banalität des Bösen?
- Das Böse ist „banal“. Die BefürworterInnen Hannah Arendts These
- Arendt „entlastet“ Eichmann von seiner Schuld als Mörder. Die GegnerInnen Hannah Arendts These
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Artikel befasst sich mit der Kontroverse, die durch Hannah Arendts These der „Banalität des Bösen“ im Kontext des Eichmann-Prozesses ausgelöst wurde. Ziel ist es, die wissenschaftliche und öffentliche Debatte zu dieser These zu analysieren, die Befürworter und Gegner der These zu identifizieren und die Auswirkungen dieser Kontroverse auf die Wahrnehmung des Naziregimes und der jüdischen Frage zu beleuchten.
- Die „Banalität des Bösen“ als zentrale These von Hannah Arendt
- Die Interpretation von Eichmanns Persönlichkeit und seinen Taten
- Die Kritik an Arendts These und ihre Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft
- Die Rolle des Verwaltungsbetriebs im Naziregime und die Frage der individuellen Verantwortung
- Die Kontroverse im Kontext der deutschsprachigen und US-amerikanischen Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kontroverse um Hannah Arendts These der „Banalität des Bösen“ ein. Sie beleuchtet den historischen Hintergrund des Eichmann-Prozesses und die Bedeutung von Arendts Bericht für die öffentliche Debatte.
Das Kapitel „Ursprung der Kontroverse“ analysiert die zentralen Punkte in Arendts Bericht. Es geht insbesondere auf die Darstellung Eichmanns als „gesetztreuen Bürger“ und die Kritik an der Prozessführung ein.
Das Kapitel „Das Böse ist „banal“. Die BefürworterInnen Hannah Arendts These“ beschäftigt sich mit den Argumenten der Befürworter von Arendts These. Es wird unter anderem auf die Vorstellung Eichmanns als „gedankenloser“ Mensch und die Kritik an der Bezeichnung „Völkermord“ eingegangen.
Schlüsselwörter
Hannah Arendt, Eichmann-Prozess, „Banalität des Bösen“, „Gedankenlosigkeit“, Verwaltungsbetrieb, Naziregime, Antisemitismus, Holocaust, Kontroverse, öffentliche Meinung, wissenschaftliche Meinung, Befürworter, Gegner, jüdische Frage, US-amerikanische Wahrnehmung, deutschsprachiger Raum, Bettelheim
- Arbeit zitieren
- Alan Pire (Autor:in), 2020, "Eichmann in Jerusalem" von Hannah Arendt und die "Banalität des Bösen", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/913365