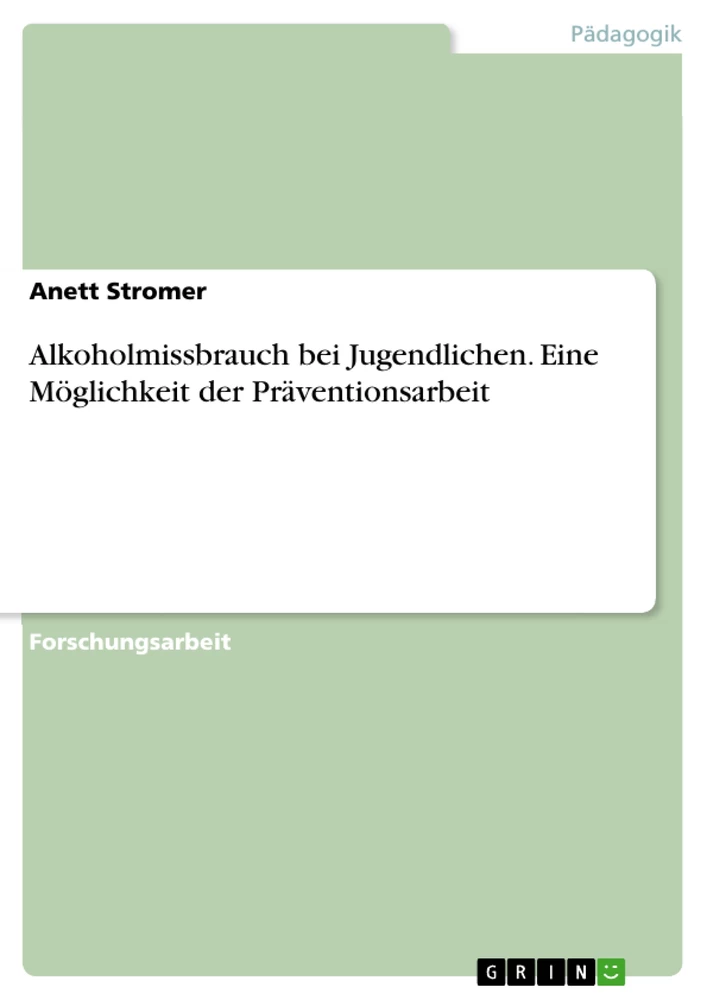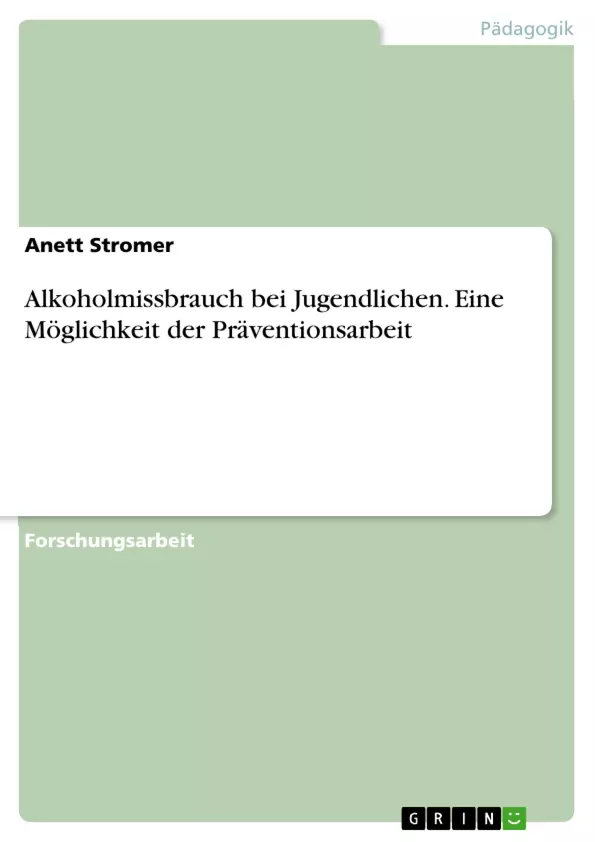Alkoholische Getränke – besonders Bier und Wein – stellen uralte Genussmittel dar, die schon seit Jahrtausenden von Menschen hergestellt und konsumiert werden. Alkohol ist die weltweit am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz und auch die Alkoholabhängigkeit ist weltweit eine der häufigsten Erkrankungen (vgl. Bellutti 2006, S. 63).
In Deutschland trinken mehr als zehn Millionen Menschen Alkohol in gesundheitlich riskanter Form und überschreiten damit regelmäßig die empfohlenen Grenzen des Konsums. Als alkoholabhängig gelten circa 1,6 Millionen Menschen, 20 Prozent im Alter von 12 bis 25 Jahren trinken in Deutschland regelmäßig Alkohol. Sie folgen dabei einer in der Gesellschaft weit verbreiteten unkritisch positiven Einstellung zum Alkohol. Der Pro-Kopf-Verbrauch eines Deutschen liegt bei zehn Liter reinem Alkohol pro Jahr. Somit liegt Deutschland im oberen Drittel des internationa-len Vergleichs. Alkoholische Getränke sind in Deutschland zu anderen Lebenshaltungskosten relativ billig (vgl. Tücke/Burger 2007, S. 379).
Alkohol wird häufig nicht als Droge, sondern als Genussmittel angesehen – er ist integraler und ritualisierter Bestandteil unserer Kultur (Tossmann/Weber 2001, S. 15). Dies gilt selbst dann, wenn der Alkoholkonsum dazu dient, einen Rauschzustand hervorzurufen (vgl. Alb-recht/Groenemeyer/Stallberg 1999, S. 174). Alkohol wird von Angehörigen aller gesellschaftli-chen Schichten in nahezu allen Lebenssituationen, auch weitgehend unabhängig vom Alter, ge-trunken. Eine positive, sozial erwünschte Wirkung des Alkohols besteht in der Steigerung des Wohlbefindens, der Erhöhung der Stimmung und Kontaktfähigkeit sowie der Minderung von Hemmungen, Unsicherheiten und Ängsten. Besonders bei Familienfeiern, Partys, Vereinsgesell-schaften und Betriebsausflügen wird das „Über-den-Durst-Trinken“ von den meisten Menschen für legitim gehalten (vgl. Hurrelmann/Bründel 1997, S. 174f.).
Bereits Kinder erfahren in frühen Jahren Alkoholgenuss als sozial eingewobenes und akzeptiertes Genussmittel. Bereits in der Herkunftsfamilie, der Verwandtschaft und im gesamten Bekanntenkreis der Eltern erfahren sie die hohe Bedeutung des Konsums dieses Stoffes – er gehört zur Normalität des Alltags. Für Jugendliche erhält Alkohol seine hohe Attraktivität durch das ihm zugeschriebene Reifeversprechen...
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Zugang zum Thema
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau
- 1.3 Forschungsstand
- Teil II: Zahlen und Fakten
- 2. Statistik
- 2.1 Häufigkeit des Konsums alkoholischer Getränke
- 2.2 Art der konsumierten Getränke
- 2.2.1 Konsumfertig gemischte bier- bzw. weinhaltige Mischgetränke
- 2.2.2 Bier
- 2.2.3 Spirituosen
- 2.3 Konsummuster
- Teil III: Begrifflichkeiten
- 3. Das Jugendalter
- 3.1 Historische Betrachtung
- 3.2 Definition und Abgrenzung
- 3.2.1 Abgrenzung Kindheitsalter – Jugendalter
- 3.2.2 Abgrenzung Jugendalter – Erwachsenenalter
- 3.2.3 Die „Peer-Group“
- 4. Alkohol - was ist das?
- 4.1 Wirkung des Alkohols
- 4.1.1 Wirkung auf den Organismus
- 4.1.2 Wirkung auf das Verhalten
- 5. Alkoholmissbrauch und - sucht
- 6. Verlaufsphasen des Alkoholismus
- 6.1 Voralkoholische Phase
- 6.2 Einstiegsphase
- 6.3 Kritische Phase
- 6.4 Chronische Phase
- 7. Haupttypen von Alkoholkranken
- 8. Faktoren des jugendlichen Alkoholkonsums
- 8.1 Ursachen
- 8.2 Konsum im sozialen Umfeld
- Teil IV: Methoden
- 9. Datenerhebung
- 9.1 Qualitative Interviews
- 9.2 Warum narratives Interview?
- 9.3 Biographisches Interview
- 9.3.1 Narratives Interview
- 9.3.1.1 Darstellungsformen in Erzählungen
- 9.3.1.2 Phasen des narrativen Interviews
- 9.3.1.3 Leitfrageninterview
- Teil V: Auswertung der Interviews
- 10. Typenbildung
- 10.1 Alkoholabstinenz
- 10.2 Erstkonsum in der Herkunftsfamilie
- 10.3 Konsum in der Gleichaltrigengruppe
- 11. Auswertung der Interviews im Hinblick auf die zu planende Präventionsmaßnahme
- Teil VI: Prävention
- 12. Was ist Prävention?
- 13. Arten von Prävention
- 13.1 Primärprävention
- 13.2 Sekundärprävention
- 13.3 Tertiärprävention
- 14. Außerschulische Präventionsarbeit
- Teil VII: Präventionsmaßnahme: Dem Alkohol (k)eine Chance…
- 15. Situations- und Problembeschreibung
- 16. Planung der Maßnahme
- 16.1 Der geeignete Ort
- 16.2 Festlegung der Ziele
- 16.2.1 Zielebenen
- 16.2.2 Zielbereiche
- 16.3 Festlegung der Inhalte
- 16.4 Didaktisch-methodische Vorgehensweise
- 16.5 Auswahl der geeigneten Lehr- und Lernmittel
- 16.6 Zeitplanung
- 16.7 Teilnehmer
- 16.8 Vorbereitung der Veranstaltung
- 17. Erfolgssteuerung in der Trainingsphase – Maßnahmen zur prozessorientierten und ergebnisorientierten Erfolgssteuerung
- 17.1 Prozessbegleitende Erfolgssteuerung = begleitende Beobachtung und Einflussnahme im laufenden Prozess
- 17.2 Ergebnisorientierte Erfolgssteuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen und entwickelt eine Präventionsmaßnahme. Ziel ist es, den Forschungsstand zum Thema darzustellen, statistische Daten zu analysieren und durch qualitative Interviews relevante Faktoren des jugendlichen Alkoholkonsums zu ermitteln. Die Ergebnisse dienen der Konzeption einer effektiven Präventionsstrategie.
- Statistische Erfassung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen
- Analyse der Wirkung von Alkohol auf Jugendliche
- Identifikation von Risikofaktoren für Alkoholmissbrauch
- Entwicklung einer Präventionsmaßnahme
- Evaluation der Präventionsmaßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Zugang zum Thema: Dieser einleitende Teil beschreibt die Problemstellung des Jugend-Alkoholmissbrauchs, skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema. Er legt die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel, indem er die Relevanz der Thematik verdeutlicht und die Forschungsfrage definiert.
Teil II: Zahlen und Fakten: Dieser Teil präsentiert statistische Daten zum Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Die Häufigkeit des Konsums, die Art der konsumierten Getränke (Mischgetränke, Bier, Spirituosen) und die Konsummuster werden detailliert untersucht und mit relevanten Studien verglichen. Dieser Abschnitt liefert wichtige quantitative Informationen über die Ausbreitung und die Charakteristika des Alkoholmissbrauchs in der Jugend.
Teil III: Begrifflichkeiten: Dieser Abschnitt beleuchtet wichtige Begriffe, insbesondere das Jugendalter selbst. Er betrachtet das Jugendalter historisch und gibt eine Definition und Abgrenzung zum Kindes- und Erwachsenenalter an. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Konzept der Peer-Group und deren Einfluss. Weiterhin wird der Begriff Alkohol definiert und seine Wirkung auf den Organismus und das Verhalten erläutert. Diese Klärung der Begrifflichkeiten schafft eine solide Basis für die anschließende Analyse.
Teil IV: Methoden: Dieser Teil beschreibt die gewählte Methode der Datenerhebung, nämlich qualitative Interviews. Er begründet die Wahl des narrativen Interviews und erläutert die Vorgehensweise bei der Durchführung und Auswertung der Interviews. Die detaillierte Darstellung der Methodik gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie.
Teil V: Auswertung der Interviews: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Es werden verschiedene Typen von Jugendlichen hinsichtlich ihres Alkoholkonsums gebildet, unter anderem Jugendliche mit Alkoholabstinenz, Jugendliche mit Erstkonsum in der Herkunftsfamilie und Jugendliche mit Konsum in der Gleichaltrigengruppe. Die Auswertung fokussiert auf die Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse für die Planung der Präventionsmaßnahme.
Teil VI: Prävention: Dieser Teil definiert den Begriff der Prävention und differenziert zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Er betrachtet speziell die außerschulische Präventionsarbeit und legt den Grundstein für die im folgenden Teil vorgestellte eigene Präventionsmaßnahme.
Teil VII: Präventionsmaßnahme: Dem Alkohol (k)eine Chance…: Dieser Teil beschreibt detailliert die konzipierte Präventionsmaßnahme, inklusive Situationsbeschreibung, Zielsetzung, Inhaltsfestlegung, didaktisch-methodischem Vorgehen, Auswahl der Lehr- und Lernmittel, Zeitplanung, Teilnehmerauswahl und Vorbereitung der Veranstaltung. Es wird auch ein Ansatz zur Erfolgssteuerung (prozess- und ergebnisorientiert) vorgestellt.
Schlüsselwörter
Alkoholmissbrauch, Jugendliche, Prävention, qualitative Interviews, narratives Interview, Risikofaktoren, Peer-Group, Alkoholkonsum, Statistik, Präventionsmaßnahme, Jugendalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen - Entwicklung einer Präventionsmaßnahme
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen und entwickelt darauf basierend eine konkrete Präventionsmaßnahme. Sie kombiniert statistische Analysen mit qualitativen Forschungsmethoden, um ein tiefgreifendes Verständnis des Problems zu erreichen und eine effektive Interventionsstrategie zu konzipieren.
Welche Teile umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Teile: Teil I (Zugang zum Thema) bietet eine Einleitung, Problemstellung und Forschungsstand. Teil II (Zahlen und Fakten) präsentiert statistische Daten zum Alkoholkonsum Jugendlicher. Teil III (Begrifflichkeiten) klärt zentrale Begriffe wie Jugendalter und Alkoholwirkung. Teil IV (Methoden) beschreibt die angewandte qualitative Interviewmethode. Teil V (Auswertung der Interviews) präsentiert die Ergebnisse der Interviews und Typenbildung. Teil VI (Prävention) definiert Prävention und deren Arten. Teil VII (Präventionsmaßnahme) detailliert die entwickelte Präventionsmaßnahme "Dem Alkohol (k)eine Chance…".
Welche Daten wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf zwei Arten von Daten: Zum einen werden statistische Daten zum Alkoholkonsum Jugendlicher (Häufigkeit, Art der Getränke, Konsummuster) herangezogen. Zum anderen werden qualitative Daten aus narrativen Interviews verwendet, um die individuellen Erfahrungen und Perspektiven Jugendlicher zum Alkoholkonsum zu erfassen.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung angewendet?
Die Datenerhebung erfolgte mittels qualitativer Interviews, insbesondere narrativer Interviews. Die Wahl dieser Methode begründet sich in der Möglichkeit, individuelle Geschichten und Erfahrungen der Jugendlichen zum Thema Alkoholkonsum detailliert zu erfassen und zu analysieren.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Auswertung der Interviews führte zur Bildung verschiedener Typen Jugendlicher hinsichtlich ihres Alkoholkonsums (z.B. Abstinente, Erstkonsum in der Familie, Konsum in der Peer-Group). Diese Ergebnisse flossen direkt in die Konzeption der Präventionsmaßnahme ein.
Wie ist die Präventionsmaßnahme aufgebaut?
Die entwickelte Präventionsmaßnahme "Dem Alkohol (k)eine Chance…" wird im Detail beschrieben, einschließlich Situationsanalyse, Zielsetzung, Inhalt, methodischem Vorgehen, Materialauswahl, Zeitplanung, Teilnehmerauswahl und Erfolgskontrolle (prozess- und ergebnisorientiert). Es werden konkrete Schritte zur Durchführung und Evaluation der Maßnahme dargelegt.
Welche Zielgruppen werden angesprochen?
Die Arbeit richtet sich primär an Jugendliche und Personen, die im Bereich der Jugendhilfe und Prävention tätig sind. Sie liefert sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse zum Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen als auch eine praxisorientierte Anleitung zur Entwicklung und Durchführung einer effektiven Präventionsmaßnahme.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Alkoholmissbrauch, Jugendliche, Prävention, qualitative Interviews, narratives Interview, Risikofaktoren, Peer-Group, Alkoholkonsum, Statistik, Präventionsmaßnahme, Jugendalter.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Aufbau der Arbeit?
Das Inhaltsverzeichnis der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht über die Struktur und die einzelnen Kapitel. Jedes Kapitel wird mit einer kurzen Zusammenfassung versehen, um einen schnellen Überblick über den Inhalt zu ermöglichen.
- Quote paper
- Anett Stromer (Author), 2007, Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. Eine Möglichkeit der Präventionsarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/91136