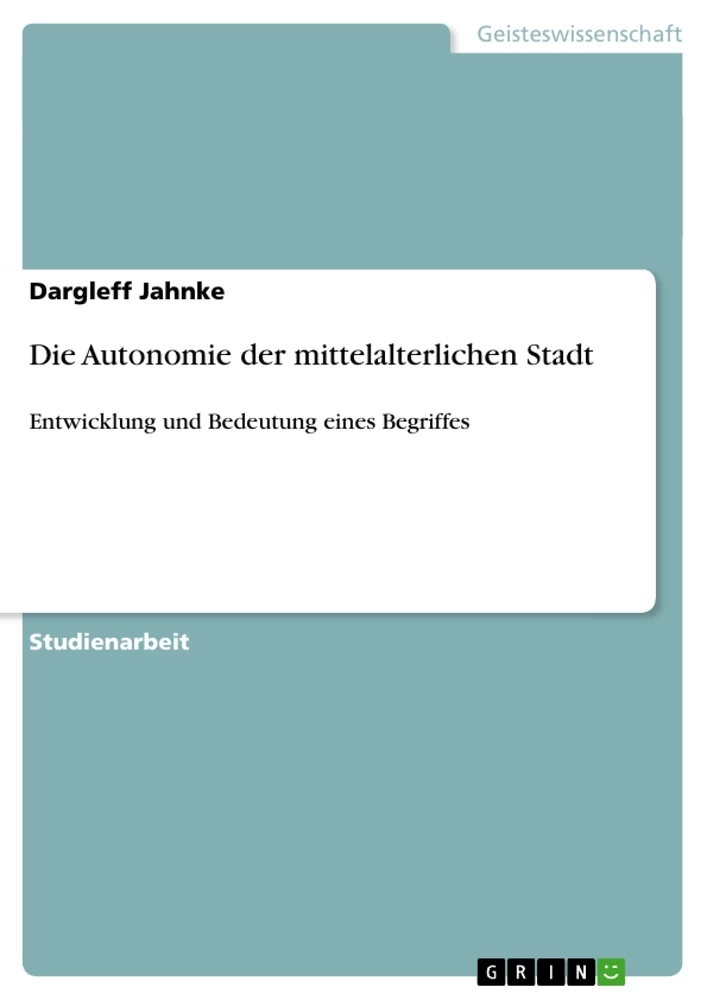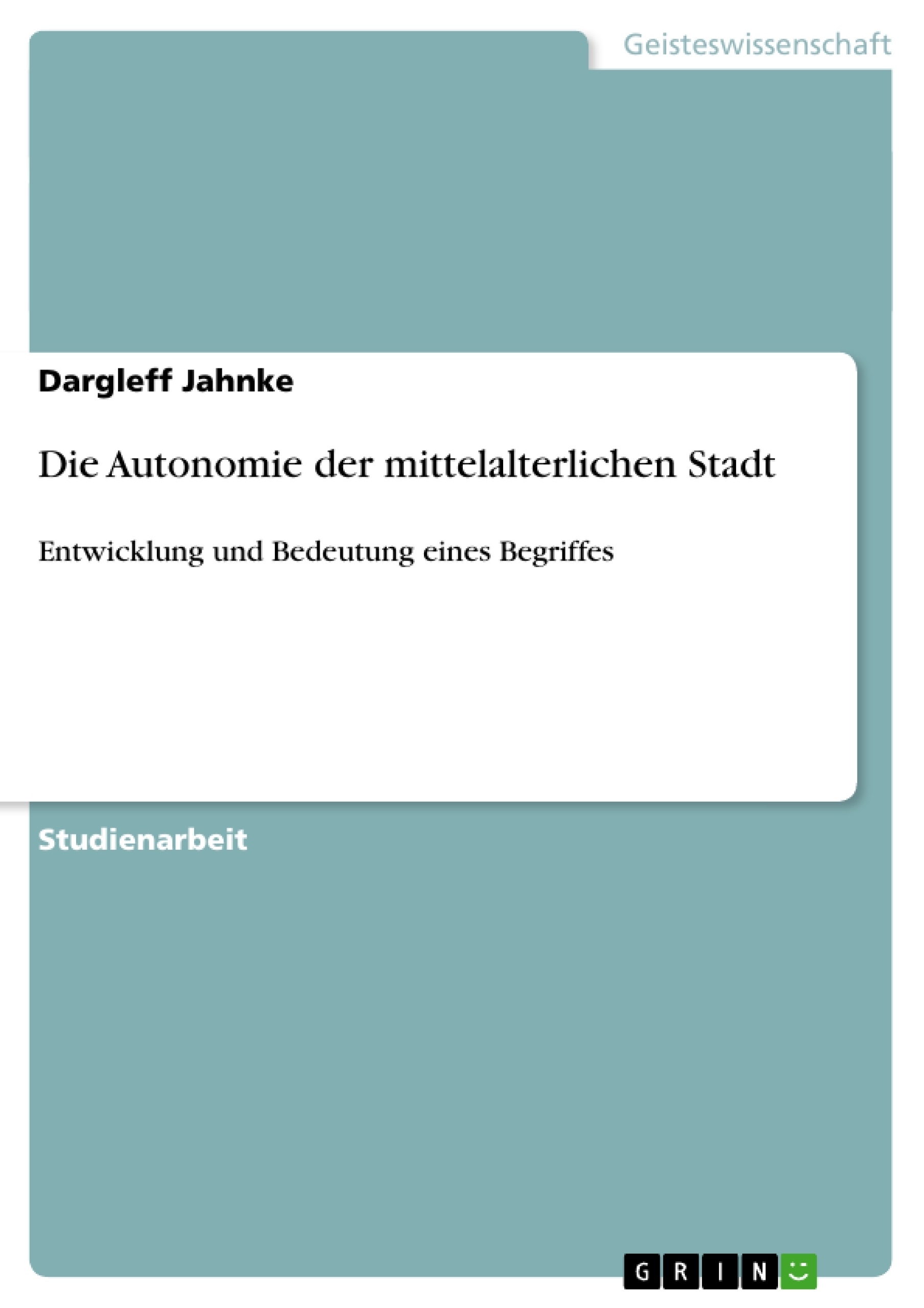Die bürgerlichen Freiheitsrechte, die sich die Bürger der mittelalterlichen Stadt im Laufe der Zeit sichern konnten, werden dabei als die ersten Ansätze eines modernen Staatsbürgerrechts gesehen, aus denen dann neue autonome Rechtskreise entstanden. Die vollständige Abschaffung der Privilegien einer Stadt, die bis dahin die Autonomie der Stadtgemeinde sicherten, begann am 4. August 1789 durch die französische Nationalversammlung. Dieser Prozeß währte insgesamt acht bis neun Jahrzehnte und durchzog ganz West- und Mitteleuropa. Er war gleichzusetzen mit der Modernisierung der Staats- und Gemeindeverfassungen. Im 19. Jahrhundert glich sich die Rechtsstellung von Bürger und Bauer unter dem Zeichen der Staatsbürgerschaft langsam an. Kontinuität und Wandel bestanden in der Übergangsphase um 1800 noch lange nebeneinander. In der westlichen historischen Stadtgeschichtsschreibung wird der Begriff der Autonomie oft gleichgesetzt mit den Verleihungen von Privilegien oder mit der Verleihung des Stadtrechtes. Man sieht schon an dieser kleinen Auswahl an Definitionen, daß die Autonomie für viele verschiedene Aussagen benutzt wurde. Dazu kommt das Problem, daß die Begriffe Autonomie, Selbstverwaltung, Rechtsetzungsgewalt und Freiheit oft synonym benutzt werden und damit die wissenschaftliche Genauigkeit und Bedeutung verloren geht. Das setzt voraus, den Begriff der Autonomie, der für die mittelalterliche Stadtgemeinde das entscheidende Moment war, zunächst einmal genau zu definieren und abzusetzen von den anderen Disziplinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Die mittelalterliche Stadt
- Der Begriff der Autonomie
- Die Entwicklung von der Heteronomie zur städtischen Autonomie im Mittelalter
- Das Entstehen der mittelalterlichen Stadtgemeinde als Voraussetzung für die Autonomie
- Unterschiedliche Grade der Autonomie der mittelalterlichen Städte
- Wandel der Autonomie
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der städtischen Autonomie im Mittelalter. Sie analysiert den Begriff der Autonomie, die Rolle der mittelalterlichen Stadtgemeinde und den Wandel der Autonomie in verschiedenen historischen Phasen.
- Die Entstehung der mittelalterlichen Stadtgemeinde als Voraussetzung für die Autonomie
- Die verschiedenen Grade der Autonomie in mittelalterlichen Städten
- Der Wandel der Autonomie von der Heteronomie zur Autonomie
- Der Einfluss der städtischen Autonomie auf die Entwicklung des Bürgertums und die moderne Staatlichkeit
- Die Bedeutung der städtischen Autonomie im Vergleich zu anderen historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der städtischen Autonomie im Mittelalter ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Stadtgemeinde und den Begriff der Autonomie. Das Kapitel 2.1 analysiert die Entstehung der mittelalterlichen Stadtgemeinde als Voraussetzung für die Autonomie. Es untersucht die unterschiedlichen Grade der Autonomie in mittelalterlichen Städten und den Wandel der Autonomie im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der mittelalterlichen Stadtgeschichte, insbesondere mit der Autonomie der Stadtgemeinde. Die Arbeit analysiert den Begriff der Autonomie, die Entstehung der mittelalterlichen Stadtgemeinde, die verschiedenen Grade der Autonomie in mittelalterlichen Städten und den Wandel der Autonomie im Laufe der Zeit. Weitere wichtige Begriffe sind: Heteronomie, Privilegien, Stadtrecht, Selbstverwaltung, Rechtsetzungsgewalt, Freiheit, Bürgertum, Moderne, Staatlichkeit.
- Arbeit zitieren
- Dargleff Jahnke (Autor:in), 2007, Die Autonomie der mittelalterlichen Stadt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/91113