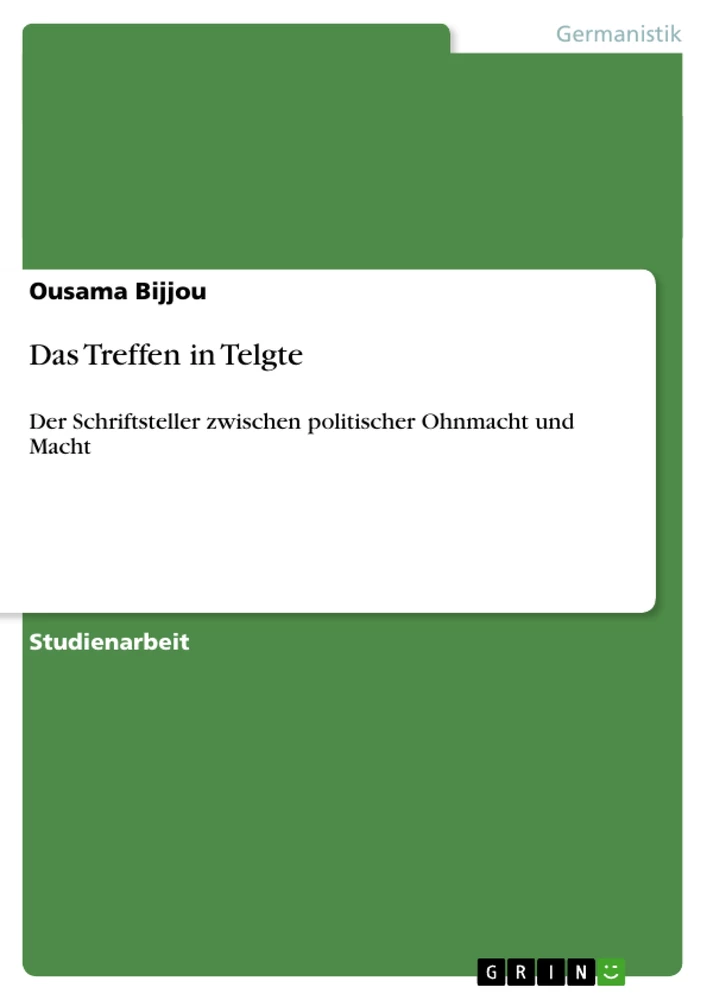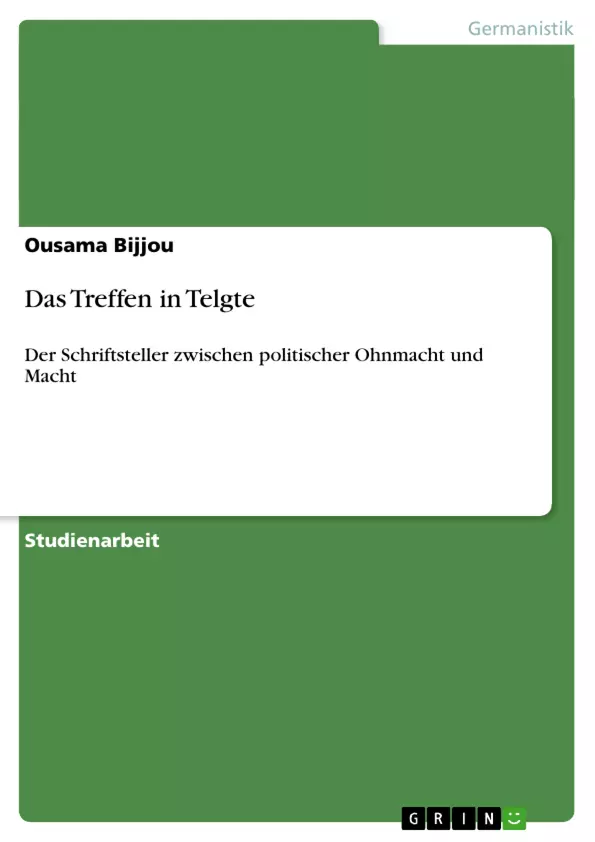Fragt man nach der Rolle des Schriftstellers,1 so stellt sich auch die Frage nach seiner Bedeutung in der Gesellschaft. Durch die Veröffentlichungen seiner Schriften ist automatisch ein öffentlicher Diskurs an ihn und seine Veröffentlichungen gebunden. Publizierte Essays, Aufsätze, Erzählungen oder Reden machen den Schriftsteller zwangsläufig zu einer öffentlichen Person und zu einer intervenierenden Instanz. Doch stellt sich dann die bereits von Günter Grass gestellte Frage, ob sich ein Schriftsteller politisch aktiv engagieren soll, und wenn ja, wie weit er dabei gehen kann? Welche Funktion würde er dann einnehmen und welchen Einfluß kann er auf die politische Realität ausüben? „Ist der Schriftsteller das Gewissen der Nation?“2 Dies sind Fragen, deren Antwort ich im Laufe der Arbeit zu erlangen versuche. Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll Günter Grass' Erzählung Das Treffen in Telgte stehen. Dabei werde ich zunächst eine historische und systematische Perspektivierung der Erzählung durchführen und die intertextuellen Bezüge zur Gruppe 47 herausarbeiten. Im dritten Teil der Arbeit werde ich die oben genannten Fragestellungen anhand der Erzählung analysieren und herausarbeiten, welches Dichterverständnis die Poeten in Das Treffen in Telgte haben, und wie sich dieses verändert. Außerdem werde ich das Verhältnis von politischer Ohnmacht und Macht bei Schriftstellern allgemein erörtern. Anschließend werde ich die Frage aufgreifen, warum Günter Grass gerade die Epoche des Barocks wählte, um die Geschichte um das Poetentreffen zu erzählen. Des Weiteren werde ich das barocke Dichterselbstverständnis auf seine Aktualität hin überprüfen. Da Grass in Das Treffen in Telgte über Schriftsteller schreibt, schreibt er zwangsläufig auch über sich selbst. Deswegen erscheint es sinnvoll, die rhetorischen Strategien zu untersuchen, die der Autor hierfür verwendet. Im 4. Kapitel der Arbeit werde ich auf Grass' Princeton-Rede aus dem Jahre1966 eingehen, die wichtigsten Position kurz untersuchen und auf den Telgte-Text hin überprüfen. Als theoretische Grundlage für diese Arbeit dient der Text „Grabmal des Intellektuellen“ von Jean-Francois Lyotard, das Essay „Ein Intellektueller ist jemand, der etwas gelesen hat“ von Dirk Baecker sowie der Aufsatz „Engagierte Literatur? Zur Poetik des Klartexts“ von Nikolaus Wegmann. Im Schlusswort werde ich zur Analyse Stellung beziehen und die wichtigsten Punkte der Arbeits nochmals aufgreifen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Gruppe (16)47 – Zur Intertextualität in Das Treffen in Telgte
- 3. Das Selbstverständnis der Barockdichter - zwischen Macht und Ohnmacht
- 3.1 Der Barock als Zeitalter der Ohnmacht
- 4. Vom mangelnden Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren unter Berücksichtigung nicht vorhandener Höfe
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Günter Grass' Erzählung „Das Treffen in Telgte“ und untersucht die Rolle des Schriftstellers im Spannungsfeld zwischen politischer Ohnmacht und Macht. Sie beleuchtet das Selbstverständnis der Dichter im Kontext der Gruppe 47 und im Barock, vergleicht beide Epochen und untersucht intertextuelle Bezüge.
- Die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft
- Das Selbstverständnis von Dichtern im Barock und in der Nachkriegszeit
- Intertextualität zwischen „Das Treffen in Telgte“ und der Gruppe 47
- Politische Ohnmacht und Macht im Kontext der Literatur
- Rhetorische Strategien in Grass' Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des Schriftstellers und seiner Bedeutung in der Gesellschaft. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf Günter Grass' „Das Treffen in Telgte“ und kündigt die methodische Vorgehensweise an: eine historische und systematische Perspektivierung der Erzählung, die Herausarbeitung intertextueller Bezüge zur Gruppe 47, die Analyse des Dichterverständnisses in der Erzählung, die Erörterung des Verhältnisses von politischer Ohnmacht und Macht, und die Untersuchung der rhetorischen Strategien Grass'. Die Einleitung benennt auch die theoretischen Grundlagen der Arbeit.
2. Die Gruppe (16)47 - Zur Intertextualität in Das Treffen in Telgte: Dieses Kapitel untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Grass' Erzählung und der Gruppe 47. Es beschreibt die Entstehung und den Kontext der Gruppe 47, ihre Arbeitsmethoden und ihre Auflösung. Es analysiert, wie die Erzählung Themen und Motive der Gruppe 47 aufgreift, darunter die Debatte um Kollektivschuld und die durch den Krieg korrumpierte Sprache. Der Fokus liegt auf den Parallelen zwischen den beiden historischen Kontexten und wie diese Parallelen in der Erzählung dargestellt werden. Die Verlagerung des Handlungszeitpunktes um 300 Jahre in den Barock wird als Ausdruck einer Spannung zwischen verschiedenen Zeitperioden interpretiert, die der Geschichte einen universellen Charakter verleiht.
3. Das Selbstverständnis der Barockdichter - zwischen Macht und Ohnmacht: Das Kapitel erforscht das Selbstverständnis der Barockdichter, analysiert deren Position zwischen Macht und Ohnmacht, und beleuchtet die Relevanz dieser Thematik im Kontext von Grass' Erzählung. Es geht auf die Situation der schreibenden Hofnarren ein und verknüpft dies mit den Erfahrungen der Schriftsteller in der Nachkriegszeit. Die Analyse ergründet, inwiefern das barocke Dichterselbstverständnis für das Verständnis der Figuren und deren Konflikte in Grass' Werk relevant ist und welche Parallelen zu den Schriftstellern der Gruppe 47 gezogen werden können.
4. Vom mangelnden Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren unter Berücksichtigung nicht vorhandener Höfe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen und die begrenzte Macht der Schriftsteller im Barock, die durch das Fehlen traditioneller Höfe noch verstärkt wurden. Es untersucht, wie dieses mangelnde Selbstvertrauen sich in der literarischen Produktion niederschlug und wie es sich mit dem Selbstverständnis der Schriftsteller in der Nachkriegszeit vergleicht. Der Fokus liegt auf den strukturellen und sozialen Bedingungen, welche die Schreibenden beeinflussten und ihre literarischen Werke prägten. Die Analyse setzt die Verbindung zum vorherigen Kapitel über das Selbstverständnis der Barockdichter fort und erweitert den Vergleich mit der Gruppe 47.
Schlüsselwörter
Günter Grass, Das Treffen in Telgte, Gruppe 47, Barock, politische Ohnmacht, politische Macht, Dichterselbstverständnis, Intertextualität, Kollektivschuld, Sprache, Nachkriegsliteratur, rhetorische Strategien.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Treffen in Telgte": Analyse der Rolle des Schriftstellers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Günter Grass' Erzählung "Das Treffen in Telgte" und untersucht die Rolle des Schriftstellers im Spannungsfeld zwischen politischer Ohnmacht und Macht. Der Fokus liegt auf dem Selbstverständnis der Dichter im Kontext der Gruppe 47 und im Barock, einem Vergleich beider Epochen und der Untersuchung intertextueller Bezüge.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft, das Selbstverständnis von Dichtern im Barock und in der Nachkriegszeit, die Intertextualität zwischen "Das Treffen in Telgte" und der Gruppe 47, politische Ohnmacht und Macht im Kontext der Literatur sowie rhetorische Strategien in Grass' Erzählung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise vor. Kapitel 2 ("Die Gruppe (16)47") untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Grass' Erzählung und der Gruppe 47. Kapitel 3 ("Das Selbstverständnis der Barockdichter") erforscht das Selbstverständnis der Barockdichter im Kontext von Macht und Ohnmacht. Kapitel 4 ("Vom mangelnden Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren") konzentriert sich auf die Herausforderungen und die begrenzte Macht der Schriftsteller im Barock. Kapitel 5 (Schlussbemerkung) fasst die Ergebnisse zusammen (genaue Inhalte sind nicht im Preview enthalten).
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine historische und systematische Perspektivierung der Erzählung, die Herausarbeitung intertextueller Bezüge zur Gruppe 47, die Analyse des Dichterverständnisses, die Erörterung des Verhältnisses von politischer Ohnmacht und Macht und die Untersuchung der rhetorischen Strategien Grass'. Die theoretischen Grundlagen sind im Preview nicht explizit genannt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Günter Grass, Das Treffen in Telgte, Gruppe 47, Barock, politische Ohnmacht, politische Macht, Dichterselbstverständnis, Intertextualität, Kollektivschuld, Sprache, Nachkriegsliteratur und rhetorische Strategien.
Wie wird die Gruppe 47 in der Analyse berücksichtigt?
Die Gruppe 47 wird als wichtiger intertextueller Bezugspunkt für "Das Treffen in Telgte" betrachtet. Die Arbeit untersucht die Parallelen zwischen den Themen und Motiven der Gruppe 47 (z.B. Kollektivschuld, durch den Krieg korrumpierte Sprache) und denen in Grass' Erzählung, sowie die Parallelen zwischen den historischen Kontexten beider Epochen.
Welche Rolle spielt der Barock in der Analyse?
Der Barock wird als Vergleichsepoche zur Nachkriegszeit herangezogen, um das Selbstverständnis der Dichter in beiden Epochen zu beleuchten und Parallelen im Umgang mit Macht und Ohnmacht aufzuzeigen. Die Situation der schreibenden Hofnarren im Barock wird mit den Erfahrungen der Schriftsteller in der Nachkriegszeit verglichen.
Welche Bedeutung hat das Thema "politische Ohnmacht und Macht"?
Das Thema "politische Ohnmacht und Macht" ist zentral für die Analyse. Die Arbeit untersucht, wie sich dieses Spannungsfeld im Selbstverständnis der Dichter und in ihren literarischen Werken widerspiegelt, sowohl im Barock als auch in der Nachkriegszeit.
- Quote paper
- Ousama Bijjou (Author), 2006, Das Treffen in Telgte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90642