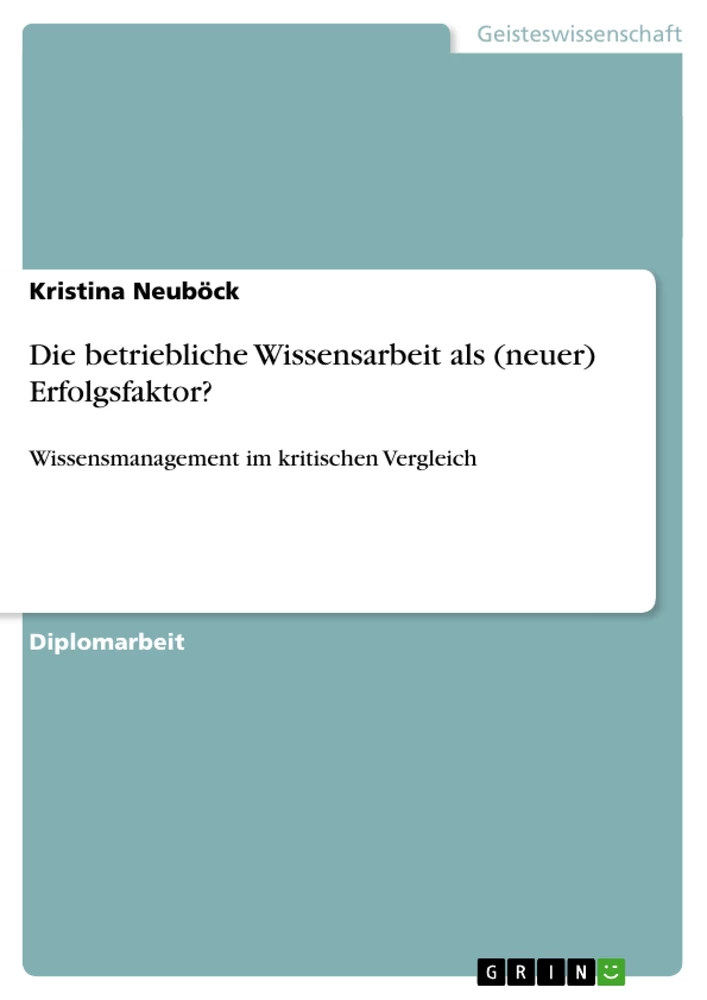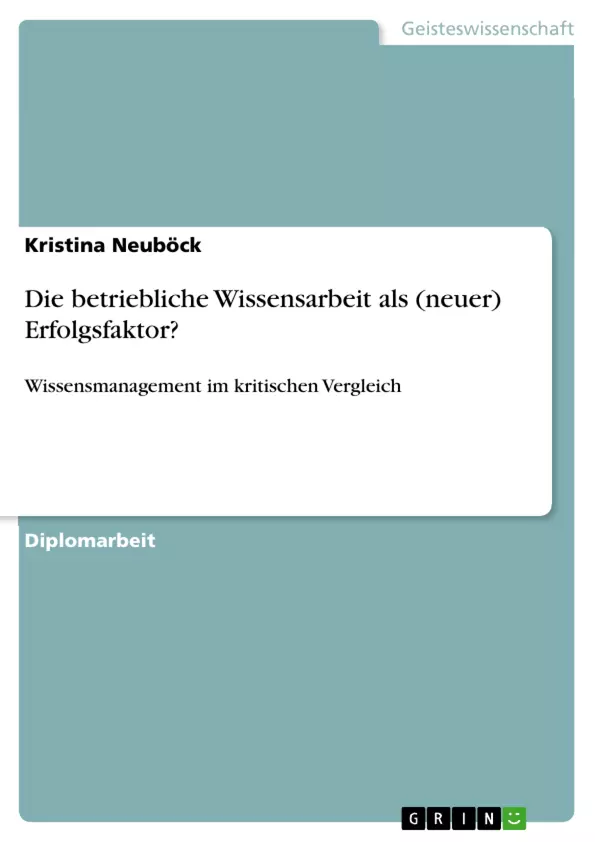Wissensmanagement gehört momentan zu den am meisten diskutierten Managementansätzen. Dabei werden die Weiterbildung der Mitarbeiter und das Verwalten von Wissen als bedeutendste Wettbewerbsfaktoren angesehen, und „Wissen wird neben Kapital und Arbeit zum neuen zentralen Unternehmenswert“. Die Diskussion um Wissensmanagement findet vor dem Hintergrund eines turbulenten Unternehmenskontexts mit explosionsartiger Vermehrung von Information und Wissen statt. Ihre Notwendigkeit wird besonders durch Laßlebens Geschichte „Von schwitzenden Fröschen im Zeitalter des Lernens“ deutlich (vgl. Laßleben 2002: 2ff). In ihr hält Laßleben fest, dass Umweltveränderungen Organisationen bedrohen und ein Fortbestand nur durch eine Adaption an die sich rasant wandelnden Rahmenbedingungen gesichert ist. Eine Annäherung an veränderte Umweltbedingungen kann, wie beim Frosch, der aus dem Glas hüpft, wenn es ihm zu heiß wird, nur durch Lernen geschehen. (Vgl. Laßleben 2002: 2ff) Wissensmanagement wird nun als ein neues, Erfolg versprechendes Managementprinzip gefeiert. Die Zahl der einschlägigen Publikationen hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, und vor allem in den USA wurde die lernende Organisation zum vieldiskutierten Konzept (vgl. Dehnbostel et al. 1998: 7). Leider ist die Disziplin des Wissensmanagements bis heute für viele unklar geblieben, denn die Konzepte und Ideen sind ausgesprochen komplex und unterscheiden sich fundamental. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, einen eingehenden Vergleich unterschiedlicher Wissensmanagementansätze vorzunehmen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einflussreiche Wissensmanagementansätze vorzustellen und im Anschluss daran kritisch die Vor- und Nachteile der Modelle aufzuzeigen. Bei der Auswahl der Ansätze wurde auf eine große Bandbreite Wert gelegt, um dem Leser die Diversität des Begriffs und der einzelnen Konzepte darzulegen.
Am Ende soll der Leser einen kritischen Einblick in verschiedenste Wissensmanagementansätze erhalten haben. Dabei wird vor allem auf die Aufdeckung und das Hinterfragen von Schwachpunkten in den einzelnen Theorien Wert gelegt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus fünf Kapiteln zusammen. Nach einer Einführung werden in Kapitel 2 die Grundlagen des Wissensmanagements dargelegt und unterschiedliche Definitionen von Wissensmanagement analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen des Wissensmanagements
- 2.1 Die Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen
- 2.2 Was ist Wissensmanagement?
- 2.3 Die Einbeziehung des Wissensmanagements
- 2.4 Wissensbilanzen
- 2.4.1 Wissen als Ressource?
- 2.4.2 Wie man Wissenskapital bilanzierbar machen könnte
- 3 Begriffe im Wissensmanagement
- 3.1 Der Begriff Wissen
- 3.1.1 Was ist Wissen?
- 3.1.2 Daten – Informationen – Wissen
- 3.1.3 Die Wissenstreppe
- 3.1.4 Und was ist relevantes Wissen?
- 3.1.5 Die Definitionen von Wissen
- 3.1.5.1 Der Wissensbegriff bei Gunnar Pautzke
- 3.1.5.2 Der Wissensbegriff bei Gilbert Probst et al.
- 3.1.5.3 Der Wissensbegriff bei Stefan Güldenberg
- 3.1.5.4 Der Wissensbegriff bei Jürgen Schüppel
- 3.1.5.5 Der Wissensbegriff bei Georg Schreyögg
- 3.1.5.6 Der Wissensbegriff von Michael Polanyi bei Nonaka Ikujiro und Hirotaka Takeuchi
- 3.1.6 Schlussfolgerungen
- 3.2 Der Begriff Lernen
- 3.2.1 Was ist Lernen?
- 3.2.2 Die Lernebenen
- 3.2.2.1 Lernen auf individueller Ebene
- 3.2.2.2 Lernen auf kollektiver Ebene oder organisationales Lernen
- 3.2.2.2.1 Der Begriff der lernenden Organisation
- 3.2.2.2.2 Die Arten des organisationalen Lernens bei Argyris und Schön
- 3.2.2.2.3 Die Arten des organisationalen Lernens bei Gunnar Pautzke
- 3.2.2.2.4 Die Arten organisationalen Lernens bei Stefan Güldenberg
- 3.2.2.2.5 Lernen bei Peter M. Senge
- 3.2.3 Lernbarrieren
- 3.2.3.1 Individuelle Lernbarrieren
- 3.2.3.2 Kollektive Lernbarrieren
- 3.2.3.3 Mentale Lernbarrieren
- 3.2.4 Schlussfolgerungen
- 4 Ein Vergleich von Wissensmanagementansätzen
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Systemisches Wissensmanagement bei Helmut Willke
- 4.2.1 Voraussetzungen der Lernenden Organisation
- 4.2.2 Wissensmanagement
- 4.2.2.1 Wissensmanagement: ein Geschäftsprozess
- 4.2.2.2 Bewertung von Intellektuellem Kapital
- 4.2.2.3 Ein konkretes Instrument des Wissensmanagements: MikroArt
- 4.2.3 Kritische Analyse des Willkeschen Ansatzes
- 4.3 Der Ansatz von Gilbert Probst et al.
- 4.3.1 Die lernende Organisation nach Gilbert Probst und Bettina Büchel
- 4.3.2 Der Wissensmanagementansatz von Gilbert Probst, Stefan Raub und Kai Romardt
- 4.3.2.1 Wissensziele definieren
- 4.3.2.2 Wissen identifizieren
- 4.3.2.3 Wissen erwerben
- 4.3.2.4 Wissen entwickeln
- 4.3.2.5 Wissen (ver)teilen
- 4.3.2.6 Wissen nutzen
- 4.3.2.7 Wissen bewahren
- 4.3.3 Kritische Analyse des Probstschen Ansatzes
- 4.4 Der Ansatz von Jürgen Schüppel
- 4.4.1 Die lernende Organisation
- 4.4.2 Der Wissensmanagementansatz
- 4.4.2.1 Die vier Akte zum Wissensmanagement
- 4.4.2.2 Die Dimensionen des Wissensmanagements
- 4.4.2.2.1 Das Management von inneren und äußeren Wissenspotentialen
- 4.4.2.2.2 Das Management aktueller und zukünftiger Wissenspotentiale
- 4.4.2.2.3 Das Management von explizitem und implizitem Wissen
- 4.4.2.2.4 Das Management von Erfahrungs- und Rationalitätswissen
- 4.4.3 Kritische Analyse des Schüppelschen Ansatzes
- 4.5 Der Ansatz von Stefan Güldenberg
- 4.5.1 Die lernende Organisation
- 4.5.2 Der Wissensmanagementansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht kritisch den Diskurs um Wissensmanagement und dessen Bedeutung als Erfolgsfaktor in Unternehmen. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Wissensmanagementströmungen herauszuarbeiten und Defizite aufzuzeigen. Die Analyse hinterfragt die meist unkritisch akzeptierte Annahme der überragenden Bedeutung von Wissensmanagement.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Wissen“
- Analyse verschiedener Wissensmanagementansätze
- Bedeutung des organisationalen Lernens
- Kritische Bewertung der Annahmen des Wissensmanagement-Diskurses
- Potentiale und Grenzen des Wissensmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beleuchtet die Bedeutung des Wissensmanagements im Kontext der Wissensgesellschaft. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit.
2 Grundlagen des Wissensmanagements: Dieses Kapitel beleuchtet die Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen auf Unternehmen. Es definiert den Begriff Wissensmanagement und seine Einbeziehung in Unternehmen, einschließlich der Diskussion von Wissensbilanzen und der Betrachtung von Wissen als Ressource.
3 Begriffe im Wissensmanagement: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit den zentralen Begriffen „Wissen“ und „Lernen“. Es werden verschiedene Definitionen von Wissen aus der Literatur vorgestellt und verglichen (Pautzke, Probst, Güldenberg, Schüppel, Schreyögg, Polanyi/Nonaka/Takeuchi), gefolgt von einer Analyse des Begriffs „Lernen“ mit Fokus auf individuellen und organisationalen Lernprozessen und den damit verbundenen Barrieren.
4 Ein Vergleich von Wissensmanagementansätzen: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Wissensmanagementansätze von namhaften Autoren wie Helmut Willke, Gilbert Probst et al., Jürgen Schüppel und Stefan Güldenberg. Für jeden Ansatz werden die jeweiligen Konzepte der lernenden Organisation und des Wissensmanagements detailliert dargestellt und kritisch analysiert. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wissensgesellschaft, organisatorisches Lernen, lernende Organisation, Wissensbilanzen, explizites Wissen, implizites Wissen, Wissensressourcen, kritische Analyse, Wissensmanagementansätze, Helmut Willke, Gilbert Probst, Jürgen Schüppel, Stefan Güldenberg.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Wissensmanagement
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert kritisch den Diskurs um Wissensmanagement und dessen Bedeutung als Erfolgsfaktor in Unternehmen. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Wissensmanagementströmungen, zeigt Defizite auf und hinterfragt die Annahme der überragenden Bedeutung von Wissensmanagement. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen wie Wissen und Lernen, vergleicht verschiedene Wissensmanagementansätze namhafter Autoren und bewertet deren Potentiale und Grenzen.
Welche Themen werden in der Diplomarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Abgrenzung des Begriffs "Wissen", Analyse verschiedener Wissensmanagementansätze (Willke, Probst, Schüppel, Güldenberg), Bedeutung des organisationalen Lernens, kritische Bewertung der Annahmen des Wissensmanagement-Diskurses, Potentiale und Grenzen des Wissensmanagements, Wissensbilanzen, explizites und implizites Wissen, und die Wissensgesellschaft.
Welche Wissensmanagementansätze werden verglichen?
Die Diplomarbeit vergleicht die Ansätze von Helmut Willke, Gilbert Probst et al., Jürgen Schüppel und Stefan Güldenberg. Für jeden Ansatz werden die Konzepte der lernenden Organisation und des Wissensmanagements detailliert dargestellt und kritisch analysiert, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden.
Wie ist die Diplomarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen des Wissensmanagements, ein Kapitel zu den Begriffen Wissen und Lernen, und ein Kapitel, das verschiedene Wissensmanagementansätze vergleicht. Zusätzlich enthält sie ein Vorwort, ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Definitionen von Wissen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht verschiedene Definitionen von Wissen von Gunnar Pautzke, Gilbert Probst et al., Stefan Güldenberg, Jürgen Schüppel, Georg Schreyögg und Michael Polanyi (im Kontext von Nonaka und Takeuchi).
Welche Aspekte des organisationalen Lernens werden behandelt?
Die Arbeit behandelt organisatorisches Lernen auf verschiedenen Ebenen, analysiert Lernbarrieren (individuelle, kollektive, mentale) und diskutiert die Konzepte der lernenden Organisation bei verschiedenen Autoren (Argyris und Schön, Gunnar Pautzke, Stefan Güldenberg, Peter M. Senge).
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Diplomarbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist implizit, aber die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung und die Annahmen des Wissensmanagements kritisch zu hinterfragen und dessen Potentiale und Grenzen aufzuzeigen.
Welche Methoden wurden in der Diplomarbeit verwendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung skizziert, der Fokus liegt auf der Literaturanalyse und dem kritischen Vergleich verschiedener Wissensmanagementansätze.
- Arbeit zitieren
- Mag. Dr. Kristina Neuböck (Autor:in), 2005, Die betriebliche Wissensarbeit als (neuer) Erfolgsfaktor?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90406