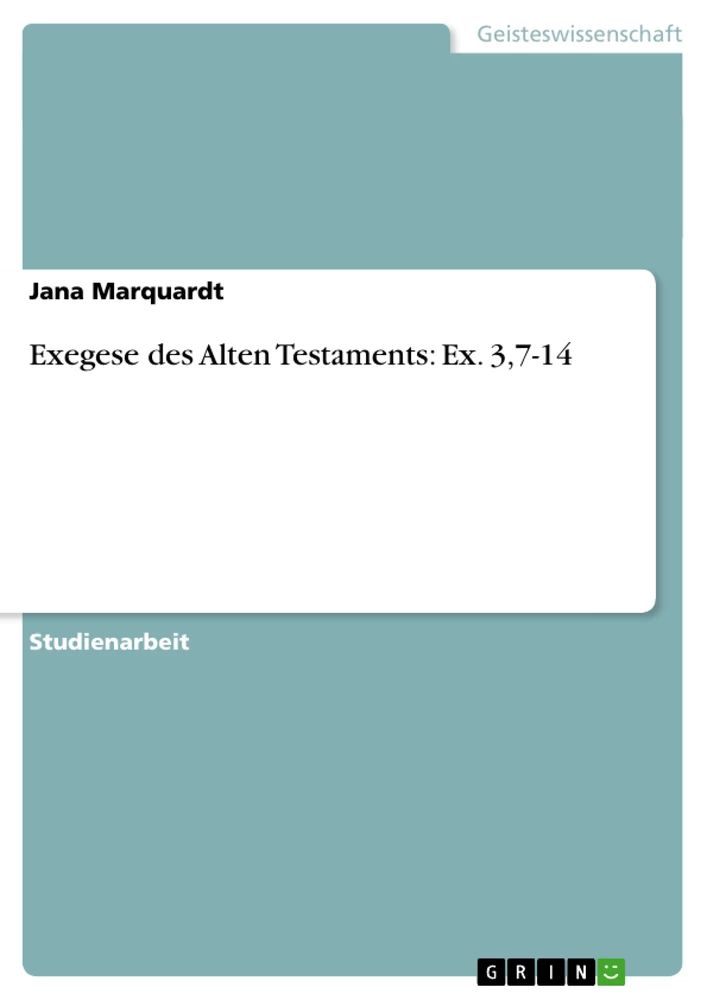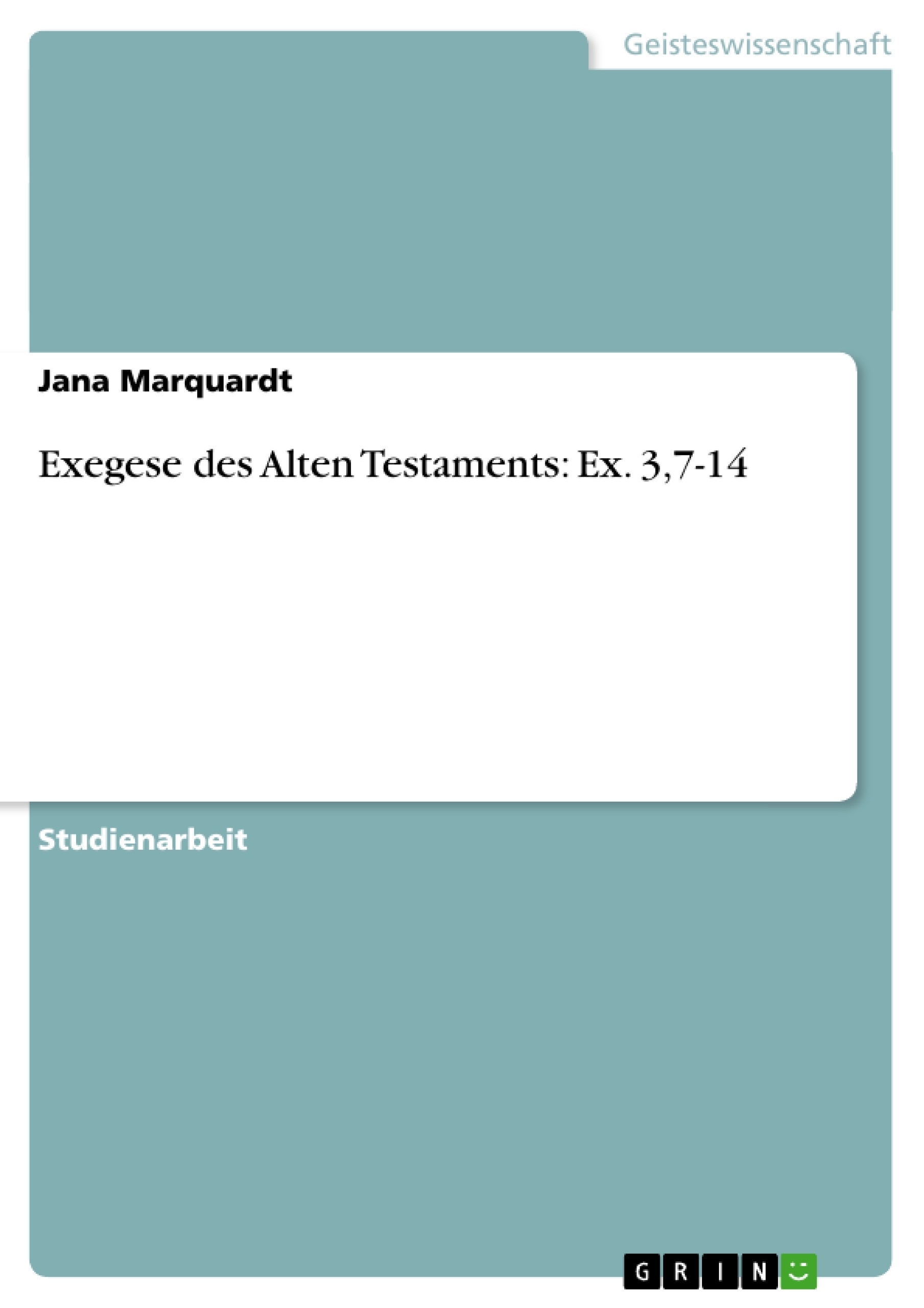Der folgenden Exegese liegt die Bibelübersetzung Luthers zugrunde . Die Lutherübersetzung ist zwar nicht die erste, aber dennoch wohl bedeutendste und am weitesten verbreitete deutsche Bibelübersetzung, wodurch sie eine überkonfessionelle Gültigkeit erlangte.
Bezeichnend für die Übersetzung Luthers ist es, dass er nicht, wie zu seiner Zeit üblich, an einer ‚Wort-für-Wort-Übersetzung’ interessiert war, sondern Sinnzusammenhänge in einer verständlichen Umgangssprache darzustellen versuchte. So ist die Lutherbibel, im Gegensatz beispielsweise zur Elberfelder Übersetzung , die sich sehr eng am ursprünglichen Text orientiert, weniger an der Form des Urtextes als vielmehr an einer genauen Wiedergabe des Inhalts interessiert. Dabei liegen die Grenzen einer formbetonenden Übersetzung auf der Hand. Bei einer konsequenten Anwendung entstehen oft unverständliche und sinnwidrige Übersetzungen, die am gemeinten Sinn des Textes, der sich häufig ja auch erst im Kontext erschließen lässt, vorbeigehen. Doch auch eine inhaltsbezogene Übersetzung wie diejenige Luthers kann nicht ohne Einschränkung als die beste Übersetzung gelten. Denn wie eine formbetonende Übersetzung den Leser mitunter überfordert, so enthalten ihm inhaltsbetonende Übersetzungen mitunter andere Übersetzungsmöglichkeiten vor oder führen ihn gedanklich in eine falsche Richtung, je nachdem welche theologische Richtung der betreffende Übersetzer vertritt.
Da meiner Meinung nach jedoch der Inhalt eines Textes wichtiger für das Verständnis ist als die exakte Wiedergabe der ursprünglichen Form, habe ich mich für die ‚freiere‘ Bibelübersetzung Luthers entschieden. Um dennoch den kritischen Blick auf diese Bibelübersetzung nicht zu verlieren, ziehe ich zu vereinzelten Untersuchungen noch eine zweite, und zwar die 1980 erschienene Einheitsübersetzung hinzu, um zu prüfen, inwieweit sich bei diesen beiden Übersetzungen nicht nur der Wortlaut, sondern vor allem auch der Sinn, unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorbereitung der exegetischen Arbeit.
- 1. Begründete Auswahl einer Bibelübersetzung.
- 2. Reflexion meines hermeneutischen Vorverständnisses
- 3. Kreativer Zugang zum ausgewählten Text...
- B. Exegetische Arbeit am ausgewählten Text.
- 1. Synchrone Arbeitsschritte
- 1.1 Abgrenzung der Texteinheit.….......
- 1.2 Einbettung der Texteinheit in den Kontext
- 1.3 Strukturanalyse der Texteinheit
- 1.4 Erläuterung der Versunterteilungskriterien:
- 1.5 Erläuterung der Gliederungskriterien.
- 2. Diachrone Arbeitsschritte..
- 2.1 Der Exodus als historisches Ereignis.
- 2.2 Die Entstehungs- bzw. Redaktionsgeschichte des Buches Exodus.
- 2.3 Trennung von Tradition und Redaktion in Ex 3,7-14
- 2.4 Form- und Gattungskritik:.
- C. Abschließende Bemerkungen
- D. Literaturangaben ......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, eine exegetische Analyse des Bibeltextes Ex 3,7-14 durchzuführen, um die Bedeutung dieses Abschnitts im Kontext des Buches Exodus und der Theologie des Alten Testaments zu erschließen. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl synchrone als auch diachrone Aspekte des Textes.
- Die Auswahl einer geeigneten Bibelübersetzung und die Reflexion des eigenen hermeneutischen Vorverständnisses.
- Die Analyse der Texteinheit in ihrem Kontext und die Untersuchung ihrer Struktur.
- Die Erforschung der historischen und redaktionellen Hintergründe des Buches Exodus.
- Die Anwendung form- und gattungskritischer Methoden auf den ausgewählten Text.
- Die Interpretation der Offenbarung Jahwes und der Bedeutung des Gottesnamens „Ich werde sein“.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Vorbereitung der exegetischen Arbeit. Hierbei werden die Gründe für die Auswahl der Lutherbibel als primäre Übersetzung sowie die Reflexion des eigenen hermeneutischen Vorverständnisses beleuchtet. Zudem wird ein kreativer Zugang zum Text durch die Methode des Elfworttextes vorgestellt, der als Ausgangspunkt für die Interpretation dient.
Der zweite Teil behandelt die exegetische Arbeit am ausgewählten Text. Es werden synchrone Arbeitsschritte wie die Abgrenzung der Texteinheit, die Einbettung in den Kontext, die Strukturanalyse und die Erläuterung der Versunterteilungskriterien durchgeführt. Anschließend werden diachrone Arbeitsschritte wie die Untersuchung des historischen Ereignisses Exodus, die Entstehungs- bzw. Redaktionsgeschichte des Buches Exodus sowie die Trennung von Tradition und Redaktion in Ex 3,7-14 analysiert. Abschließend werden form- und gattungskritische Aspekte des Textes betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der alttestamentlichen Exegese, wie der Offenbarung Jahwes, dem Gottesnamen „Ich werde sein“, der Berufung Moses, dem historischen Ereignis Exodus, der Entstehung und Redaktion des Buches Exodus, sowie der Anwendung form- und gattungskritischer Methoden. Die Analyse des Textes soll zur Vertiefung des Verständnisses der Theologie des Alten Testaments beitragen und die Verbindung zwischen jüdischem und christlichem Glauben herausstellen.
- Quote paper
- Jana Marquardt (Author), 2007, Exegese des Alten Testaments: Ex. 3,7-14, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90238